Die Lehrerbildung ist ein Thema. Zu Recht. Denn sie entscheidet darüber, ob es dem Bildungssystem gelingen wird, derzeitige pädagogische Herausforderungen wie Inklusion, Digitalisierung oder Lernrückstände zu meistern. Es gibt zahlreiche Ideen, wie die Lehrerbildung verbessert werden könnte. Im Vordergrund stehen hier Bemühungen, mehr Schulpraxis ins Studium zu bringen. Dabei wird verkannt, dass man seit Jahren damit beschäftigt war, ebendiese Praxis aus den Hochschulen zu verbannen.

Wie das? Lange Zeit war es eine Bedingung, dass Hochschullehrende der Pädagogik oder Didaktik eine mindestens fünfjährige Schulerfahrung vorzuweisen hatten. Diese Einstellungsvoraussetzung für Professorinnen und Professoren ist in den meisten Bundesländern weggefallen. Wer Schulerfahrung vorweisen kann, zählt heute zu den Dinosauriern seiner Fakultät.
Mit dieser Veränderung kam es auch zu einer Transformation der Fächer selbst. Die Schulpädagogik, die einst das Kernfach im Lehramtsstudium war, hat heute an Bedeutung verloren. An ihre Stelle getreten sind Erziehungswissenschaft oder Bildungsforschung. Das ist allerdings keine bloße Namensänderung. Vielmehr verbirgt sich dahinter das Vordrängen empirischer Methoden und – damit verbunden – der Niedergang einer geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Zwar brauchen Lehrpersonen heute zweifelsfrei Wissen über empirische Messinstrumente des Lernens, zum Beispiel um Erhebungen wie Pisa zu verstehen. Ohne einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund aber bleiben viele Erkenntnisse an der Oberfläche, da sich in der Schule eben nicht alles messen lässt.
Auch für die Karriere von angehenden Professorinnen und Professoren hat diese Veränderung Konsequenzen: Wer Schulerfahrung mitbringen möchte, muss neben dem Unterricht promovieren und habilitieren – und tritt danach in Konkurrenz zu all denen, die sich ganz auf die Wissenschaft konzentrieren konnten und folglich ein Vielfaches mehr publiziert haben. Und da Publikationen heute zentral in Bewerbungsverfahren sind, haben es Schulpraktiker sehr schwer, eine Professur zu bekommen. Die Folge: Die neuen Generationen derer, die Lehrer ausbilden, sind vielleicht bessere Forscher als früher, haben aber weniger Ahnung von der Realität an den

Das sei nicht schlimm, lautet die Verteidigung dieser Entwicklung. Schulerfahrung allein führe nicht zu einer besseren Lehre und werde überbewertet. Ein Gynäkologe, solche Beispiele werden dann angeführt, müsse, ja könne selbst keine Kinder bekommen.
Doch solche Analogien taugen wenig. Denn was ist das Besondere an Erfahrungen? Nicht das entsprechende Wissen, das vielfach in Büchern nachzulesen ist. Vielmehr sind es sinnstiftende Emotionen, die diese Erfahrungen wertvoll machen. Aus psychologischen Forschungen wissen wir, welchen Einfluss die Gefühlswelt auf Lernprozesse hat. Für Schulerfahrung gilt Entsprechendes: Wer selbst vor einer Klasse gestanden hat, weiß, was es bedeutet, sechs Stunden am Tag zu unterrichten, Freud und Leid in der Klasse zu erleben, Nähe und Distanz zu spüren. Nur so entsteht Glaubwürdigkeit, die bei den Einflussfaktoren der Lehrerprofessionalität ganz oben und weit vor der Fachkompetenz steht. Wer je eine Klasse geleitet hat, weiß nicht nur mehr, sondern kann auch überzeugender darüber berichten und Forschung mit Leben füllen. Genau das hilft bei der Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer.
Wollen wir die Lehrerbildung reformieren, sollten wir deshalb die Schulerfahrung wieder verbindlich machen. Es ist paradox, wenn Hochschullehrende auf Lebenszeitstellen sitzen und angehende Lehrpersonen unterrichten, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was all ihr Wissen in der Praxis wirklich bedeutet.
Dazu noch ein konkreter Vorschlag: ein verbindliches Praxissemester. Ähnlich dem Forschungssemester, das alle vier Jahre genommen werden kann, müssen Hochschullehrende regelmäßig ihre Schulerfahrung auffrischen. So erfahren sie, welcher Wind an Schulen heute weht.
Klaus Zierer ist Erziehungswissenschaftler und Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Der Artikel ist zuerst in der ZEIT erschienen.





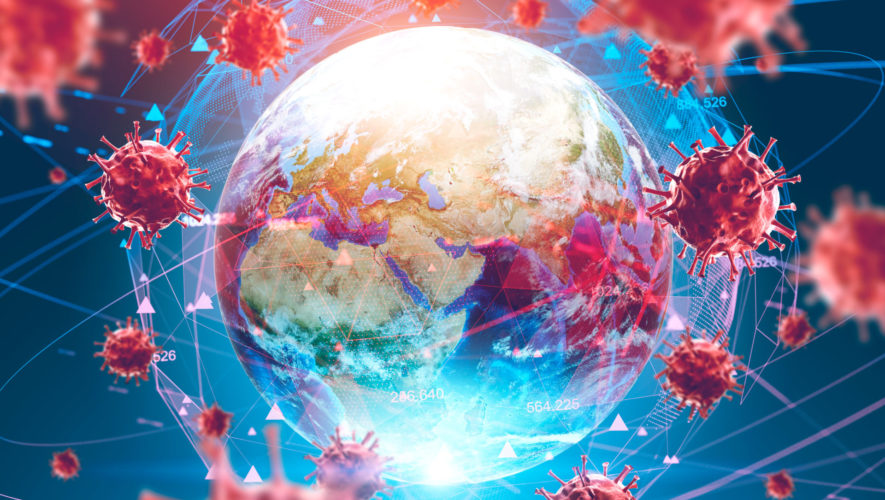

Ein Praxissemester alle vier Jahre? Da kann man auch gleich glauben, dass es besser wird, wenn man sich nur die Haare blond färbt. Tatsache ist, dass sich die Didaktik in Deutschland in die Bedeutungslosigkeit “geforscht” hat.