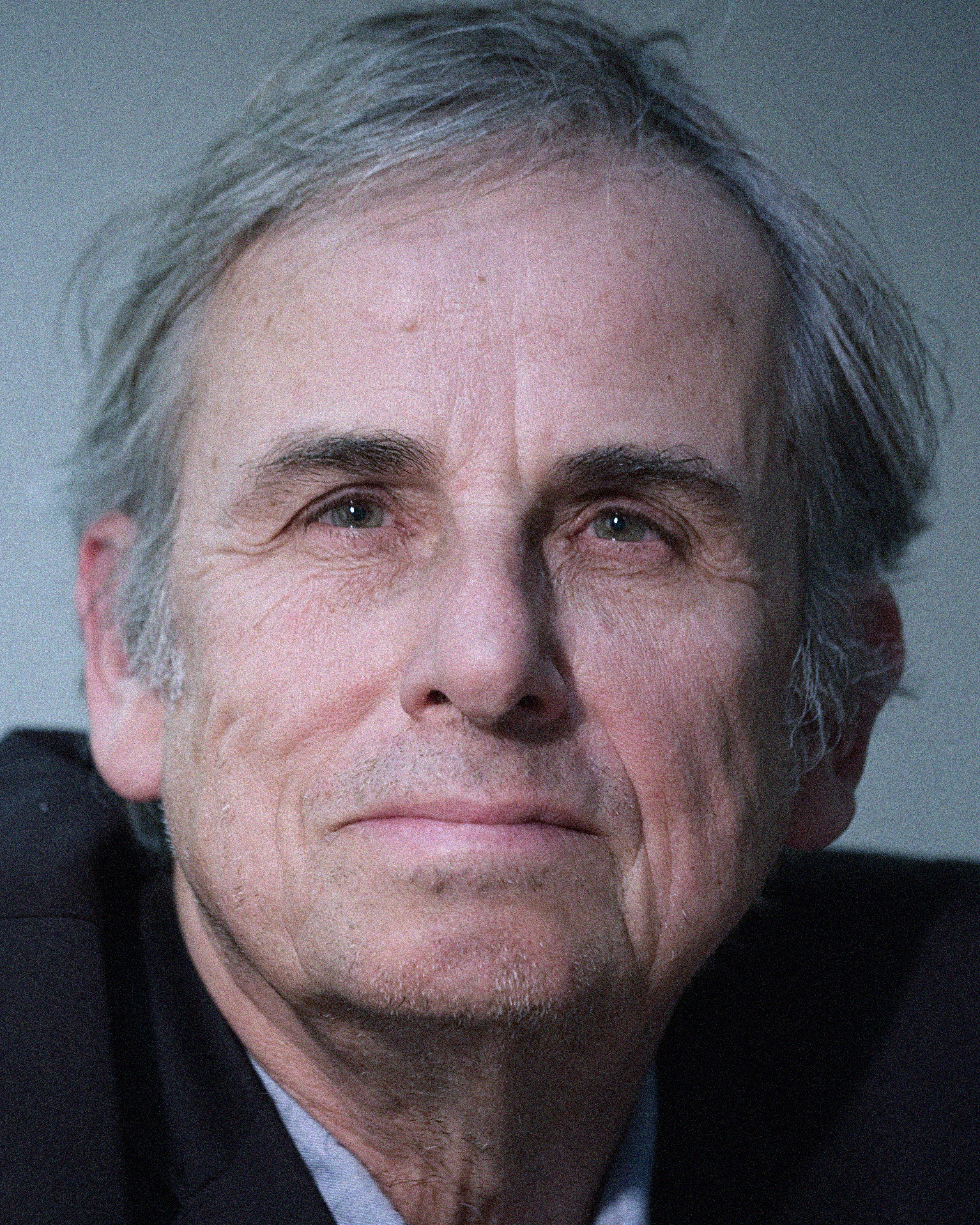Condorcet wurde in Ribemont, einem Ort der Picardie nahe der belgischen Grenze 1742 als Sohn eines Offiziers und einer Claude-Nicolas Gaudy geboren. Das Adelsgeschlecht der Condorcet verpflichtete sich traditionellerweise im französischen Militär. Jean-Marie lernte seinen Vater allerdings nie kennen, starb dieser doch 5 Wochen nach seiner Geburt, nicht etwa in einer Schlacht, sondern während eines Manövers. Seine Mutter, fromm und untröstlich über den Verlust, widmete fortan ihre ganzes Leben ihrem Sohn, den sie in Mädchenkleider steckte und überbetreute, eine Art Parzival-Syndrom. Es war damals nicht unüblich Knaben bis zum Alter von 4 Jahren in Mädchenkleider herumlaufen zu lassen. Condorcet wechselte aber den Rock mit den «culottes» erst im Alter von 9 Jahren, als sein Onkel ihn der Mutter wegnahm und sich um ihn kümmerte. Dieser Onkel wählte seinerzeit die kirchliche Karriere, wurde Bischof von Auxerres und war bekannt für sein rabiates Auftreten. Er schickte den 9-jährigen Condorcet in das Jesuitenkollegium in Reims und überwachte von Ferne dessen schulische Laufbahn. Der Aufenthalt im «Collège» war für Condorcet eine schwierige Zeit. Der abrupte Verlust der Mutter, die Lieblosigkeit der Lehrer, die Strenge und Eintönigkeit des Unterrichts und die vielen körperlichen Züchtigungen hinterliessen bei Condorcet Spuren, die sich in späteren Jahren u.a. in seiner Überzeugung widerspiegelten, dass die Schule laizistisch zu sein habe.
Die Mathematik als Disziplin war denn auch befreit von scholastischen Denkmustern, die es zu lernen und wiederzugeben galt.
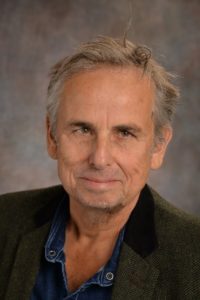
Mathematik – die Königsdisziplin der Aufklärung
Wir befinden uns im Zeitalter der Aufklärung. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass die Aufklärung geprägt war vom Glauben an die menschliche Vernunft. Mathematik – mit ihrer Klarheit, Logik und Beweisführung – wurde zum Ideal wissenschaftlichen Denkens. Im Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert spielte daher die Mathematik eine zentrale Rolle – nicht nur als wissenschaftliche Disziplin, sondern auch als Symbol für Vernunft, Ordnung und Fortschritt. Schon Galileo erkannte 100 Jahre zuvor, dass praktisch alles, was wir beobachten, mathematischen Strukturen folgte. Und er war es, der die Mathematik als Sprache der Natur bezeichnete. Die Integralrechnung wurde im 17. Jahrhundert entwickelt – im Rahmen der Entstehung der Infinitesimalrechnung, die eng mit den Namen Isaac Newton (England) und Gottfried Wilhelm Leibniz (Deutschland) verbunden ist. Dies war u. a. notwendig, um die Kurven der Planetenbahnen zu berechnen und deren Verlauf vorauszusagen. Philosophen wie René Descartes (mit seiner analytischen Geometrie) und später

Immanuel Kant sahen in der Mathematik ein Vorbild für den Erwerb sicheren Wissens. Die Mathematik als Disziplin war denn auch befreit von scholastischen Denkmustern, die es zu lernen und wiederzugeben galt. Es war auch das Refugium für den jungen Condorcet, der – unfähig mit den Mitschülern eine normale kompetitive Beziehung aufzubauen – sich in die Studien vertiefte und die Sprache der Mathematik zu lernen begann. Natürlich mute ich Ihnen hier etwas zu, wenn ich heute – da Mathematik das Hassfach Nr. 1 zu sein scheint, behaupte: Es gibt eine mathematische Begabung, die in allen Menschen steckt. Mathematische Begabung führt natürlich unterschiedlich weit. Es ist nicht jeder ein Mozart und nicht jeder ein Einstein, aber alle haben das Talent, die Sprache Mathematik in der Schule zu lernen. Genauso wie das Schreiben und Lesen der Muttersprache. In den kalten Leersälen der Jesuitenkollegien ging es noch nicht um Anwendungen. Mathematik galt als Training für den Verstand und als Teil der Allgemeinbildung des „vernünftigen Bürgers“.

Condorcet hingegen war ein Mozart der Mathematik, und dieses Talent entdeckte der Philosoph und Mathematiker d’Alembert, der diesen 15-jährigen Schüler anlässlich einer Präsentation eines Wettbewerbs entdeckte. Jean-Baptiste le Rond d’Alembert (1717–1783) war ein bedeutender französischer Mathematiker, Physiker, Philosoph und ein zentraler Vertreter der Aufklärung. Er ist bekannt für seine Beiträge zur Mechanik und zur Mathematik. Vor allem aber spielte d’Alembert eine wichtige Rolle als Mitherausgeber der berühmten Encyclopédie, die er zusammen mit Denis Diderot herausgab. Die 17-bändige Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (auf Deutsch: Enzyklopädie oder systematisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe) von Denis Diderot und Jean-Baptiste le Rond d’Alembert erschien zwischen 1751 und 1772 in Frankreich – und hatte zum Ziel, das gesamte Wissen der Zeit systematisch zu sammeln, zu ordnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Werk stand unter dem Motto: “Savoir pour tous” – Wissen für alle.
Es war ein Manifest für Vernunft, Wissenschaft, Bildung und Fortschritt. D’Alembert brachte den jungen Condorcet an das Collège de Navarre in Paris. Das Collège de Navarre war eine bedeutende Bildungseinrichtung im mittelalterlichen Paris und gehörte zur Universität von Paris. Sie war für ihre Zeit sehr fortschrittlich, weil sie begabten Talenten unabhängig ihrer Herkunft eine solide Ausbildung ermöglichte. Unter anderem besuchte auch sein späterer Todfeind Maximilien Robespierre diese Institution.
Condorcet überholte mit seinem Eifer und seinem Genie bald einmal seine Mitstudenten und überforderte auch seine Lehrkräfte. Er – der immer noch schüchterne und etwas ungelenkige junge Mann – musste von d’Alembert gemahnt werden, dass auch die mathematische Forschung nicht ein Soloprogramm sei, sondern dass der Austausch mit anderen unabdingbar für den Fortschritt sei.
Leider kann ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die vielen mathematischen Schriften und Leistungen Condorcets hier nicht im Einzelnen erklären. Sein Terrain war die Integralrechnung und seine Entdeckungen erzielte er in den Bereichen Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und Sozialwahltheorie. Berühmt ist hier vor allem das Condorcet-Paradoxon (Paradoxon der Mehrheitswahl). Kernidee: Bei Wahlen mit drei oder mehr Kandidaten kann es vorkommen, dass die kollektive Präferenz der Wähler nicht eruiert werden kann. Diese Entdeckung stellt ein fundamentales Problem für demokratische Entscheidungsprozesse dar. Das Condorcet-Paradoxon ist kein praktisches System, sondern eher ein theoretisches Problem, das zeigt, wie Mehrheitsentscheidungen manchmal zu Widersprüchen führen können.

Amüsant ist sicher auch die Begebenheit, die man sich vom Restaurantbesucher Condorcet erzählt. Er verkehrte in dem heute immer noch existierenden Restaurant Procope, wo sich die Elite der Aufklärer zu treffen pflegte. Der Wirt des Procope ärgerte sich über die Leute, die bei ihm einen Tisch reservierten, dann aber nicht auftauchten. Laut Überlieferung soll Condorcet dem Wirt vorgeschlagen haben, mehr Tische zu vergeben, als tatsächlich vorhanden waren – gestützt auf seine Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Berechnung der No-Show-Quote hatte das Ziel: Maximierung der Auslastung und Minimierung leerer Plätze. Und seine Berechnungen sind heute noch die Grundlage für die Überbuchungsstrategie der modernen Luftfahrt wie auch gewisser Hotels.
Die Mathematik nahm von Condorcet Besitz, so sehr, dass er sich eine Art mathematischen Humanismus zu eigen machte. Condorcet verband Mathematik mit aufklärerischem Idealismus – er glaubte, dass rationale, mathematisch fundierte Analyse zur Verbesserung der Gesellschaft führen könne. Auch seine Gegnerschaft zur Todesstrafe begründete er u. a. auch mathematisch. Er sagte, dass die Todesstrafe die absoluteste und irreversibelste Massnahme sei, die man ergreifen könne. Daher müsse auch die Begründung für die Todesstrafe absolut sicher und wahr sein, was nicht möglich sei.
1769 wurde er im Alter von nur 26 Jahren zum Mitglied der Académie royale des sciences gewählt.

Dort lernte er auch Robert Jacques Turgot kennen, den berühmten Ökonomen und Reformminister Ludwigs XVI. Es entwickelte sich eine enge persönliche und intellektuelle Freundschaft. Ihre Beziehung war geprägt von gemeinsamen Idealen der Aufklärung.
Im Jahr 1774, kurz nachdem Turgot zum Contrôleur général des finances (Finanzminister) Frankreichs ernannt wurde, holte er Condorcet als Inspektor der Münzprägung. Dort war er verantwortlich für die Geldstabilität, was in der chronisch überschuldeten Monarchie eine Mission impossible war. Turgot wollte den Getreidehandel liberalisieren und den Adel, sowie den Klerus besteuern. Er setzte sich für wirtschaftliche Effizienz ein, man würde ihn heute als Neoliberalen bezeichnen.
Condorcet bewunderte Turgot als praktischen Philosophen, der es schaffte, aufklärerisches Denken in staatliche Politik zu überführen. Das inspirierte ihn, später in die Politik zu gehen.
Turgot konnte sich mit seinen Reformvorschlägen nicht lange halten. Er wurde von den Profiteuren des Ancien régimes energisch bekämpft und schliesslich 1776 vom König entlassen. Condorcet verteidigte Turgot energisch gegen dessen konservative Gegner. Seine Voten für seinen ehemaligen Minister zeigen auch viel über die wachsende politische Überzeugung Condorcets.
In mehreren Artikeln verteidigte er seinen Vorgesetzten öffentlich :
« Il n’était pas fait pour plaire aux puissants, car il disait la vérité, et la vérité blesse toujours ceux qui vivent de l’erreur. »
(„Er war nicht dazu gemacht, den Mächtigen zu gefallen, denn er sagte die Wahrheit – und die Wahrheit verletzt immer jene, die von Irrtum leben.“)
➡ Condorcet kritisiert hier deutlich die Hofgesellschaft und zeigt, wie Turgots Aufklärungsideale mit der alten Ordnung unvereinbar waren.
« Le gouvernement n’a qu’une fonction : garantir la liberté et la sûreté de tous. » ( „Die einzige Aufgabe der Regierung ist es, die Freiheit und Sicherheit aller zu gewährleisten.“)
Die Entlassung Turgots bestärkte Condorcet in seinen späteren Forderungen nach einer radikalen politischen Änderung der Verhältnisse. Sie war die Geburtsstunde des Politikers Condorcet.