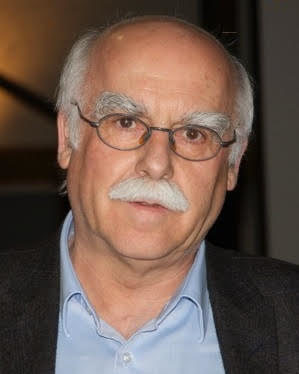Während die Bekämpfung der Corona-19-Pandemie der Wirtschaft beträchtlichen materiellen Schaden zufügte, sind in der Bildung vergleichbare Konsequenzen ausgeblieben. Der Fernunterricht konnte ohne finanzielle Nothilfe umgesetzt werden. Kosten ergaben sich allenfalls in ideeller Hinsicht, insofern nicht alle Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet waren, für ihr Lernen mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Die ungleichen Lernbedingungen während des Lockdowns veranlassten einige Kantone, die Maturitätsprüfungen in reduzierter Form oder gar nicht durchzuführen, was ebenfalls ohne Kostenfolgen möglich war.
Denkbar ist allerdings, dass das Lernen auf Distanz, das ohne ICT-Infrastruktur und entsprechende Anwenderkenntnisse nicht möglich gewesen wäre, der Digitalisierung von Schule und Unterricht Auftrieb geben wird. Damit wären dann sehr wohl Kosten verbunden, die aber nicht schadensbegrenzender Art wären, sondern eine nachhaltige Investition in unsere Schulen darstellen würden.
Technischer und pädagogischer Nutzen

Bei allem Nutzen einer à jour gebrachten ICT-Ausstattung, den die Corona-Krise offenbar gemacht hat, ist jedoch Zurückhaltung geboten, wenn die technischen gegenüber den pädagogischen Optionen abgewogen werden. Da sich durch technologische Innovationen vorwiegend der individuelle Lernprozess optimieren lässt, fehlt ihnen ein wesentliches Moment pädagogischer Wirksamkeit: der soziale Austausch im Kollektiv der Schulklasse und die diskursive Auseinandersetzung mit einer sachkompetenten Lehrperson. Auch dies hat das unfreiwillige Experiment mit dem Fernunterricht gezeigt. In der häuslichen Isolation fehlten vielen Schülerinnen und Schülern die Unterstützung durch die Lehrperson und der direkte Kontakt zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Noch wissen wir nicht, welcher Nachteil ihnen daraus erwachsen ist.
Verengung schulischer Lernziele

In pädagogischer Hinsicht ist aber nicht nur die soziale Isolierung, die mit digitalen Lernhilfen verbunden ist, zu bedenken, sondern auch die Gefahr einer Verengung schulischer Lernziele. Digitalisieren lassen sich Prozesse, über deren Funktionieren wir so viel wissen, dass wir sie zu beherrschen vermögen. Bei Lernprozessen heisst dies, dass eine Digitalisierung so weit möglich ist, wie es um die Aneignung von standardisiertem Wissen und Können geht. Davon gibt es in der Schule eine ganze Menge, und es spricht nichts dagegen, die betreffenden Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler durch Künstliche Intelligenz und adaptive Lerntechnologien zu unterstützen. Lernprogramme helfen aber nicht, um Bildungsziele zu erreichen, die sich nicht automatisieren lassen. Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit zum Denken, die unter dem Diktat der Kompetenzorientierung fast ganz aus den schulischen Lehrplänen verschwunden ist.
Die Fähigkeit zum Denken ist unter dem Diktat der Kompetenzorientierung fast ganz aus den schulischen Lehrplänen verschwunden.
Denken als Lernziel
Im Lehrplan 21 wird dem Denken zwar durchaus die Referenz erwiesen, insofern die Fähigkeit, über etwas nachzudenken, in die Beschreibung verschiedener Kompetenzstufen eingegangen ist. Eine eigenständige Kompetenz oder ein eigenes Lernziel stellt das Denken aber nicht dar. Gleiches gilt für die basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit, die 2016 per Beschluss der EDK für die Fächer Mathematik und Erstsprache in den Rahmenlehrplan der Gymnasien aufgenommen wurden. Das Denken findet an keiner einzigen Stelle Erwähnung.

Dabei sind es nicht zuletzt die Abnehmer der Gymnasien, nämlich die Hochschulen, die dem Denken hohe Bedeutung beimessen. So gab der ehemalige Präsident der ETH Zürich, Lino Guzzella, in einem Interview mit der NZZ am Sonntag zu verstehen, die wichtigste Aufgabe einer Hochschule sei nicht das Vermitteln von Fakten, «sondern den Leuten beizubringen, wie man denkt» (28. Dezember 2014, S. 19). «Wir wollen unsere Studierenden zu selbständigen, kritischen und kreativ denkenden Menschen anleiten» (ebd.). Ähnlich äusserte sich die Rektorin der ETH, Sarah Springman: «Unsere Studierenden brauchen mehr Zeit zum Denken. Lernen alleine genügt nicht» (NZZ am Sonntag vom 26. Juli 2015, S. 8).
Lernen in einer volatilen Zeit
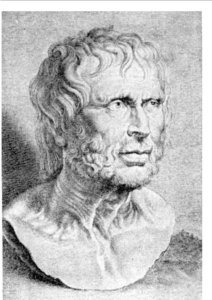
Das Denken zu fördern ist etwas anderes als Kompetenzen zu vermitteln. Bezeichnenderweise kommt der Kompetenzbegriff ohne Bezug auf das Denken aus. Definiert werden Kompetenzen zumeist als Verbindung von Wissen und Können unter Einschluss der Fähigkeit und Bereitschaft, das erworbene Wissen und Können auch anzuwenden. Damit wird ein ernsthaftes Problem institutionalisierter Bildungsprozesse thematisiert, nämlich die Schwierigkeit, Wissen so zu vermitteln, dass es nicht isoliert im Gedächtnis abgespeichert wird und schnell wieder vergessen geht. Indem das Wissen mit der Fähigkeit zu seiner Nutzung angereichert wird, lässt sich der seit Seneca wohlfeile Vorwurf, in der Schule werde nicht fürs Leben, sondern nur für die Schule gelernt, entkräften.
Doch in einer Welt, die in ständiger Bewegung ist, stets neue Anforderungen stellt und als Sicherheit fast nur mehr die Einsicht bleibt, dass es auch anders kommen kann als erwartet, genügt es nicht, über Kompetenzen für alles Mögliche zu verfügen. Was wir in volatilen Zeiten brauchen, sind Ressourcen, die ein angemessenes Können erst generieren lassen. Gerade die Corona-Krise zeigt, dass eingeschliffene Gewohnheiten hinderlich, ja gefährlich sein können, um den Herausforderungen, vor die uns das noch wenig verstandene Virus stellt, gewachsen zu sein. Zwar mag es Sinn machen, den Regeln des Bundesamtes für Gesundheit blind zu folgen, aber wirklich schützen können wir uns vor dem Virus nur, wenn wir die Regeln flexibel und situativ angepasst anwenden.

Langsames und schnelles Denken
Das Denken zu fördern, ist auch deshalb angezeigt, weil es den Menschen offensichtlich nicht leicht fällt zu denken. Wobei wir mit Daniel Kahneman zwei Formen des Denkens unterscheiden müssen, ein schnelles und ein langsames Denken. Das schnelle Denken ist ein Erbe unserer evolutionären Vergangenheit, in der eine ausgeprägte Denkfähigkeit nicht von Vorteil gewesen wäre. Gefragt waren vielmehr intuitiv begründete Entscheidungen, um in einer Umwelt, die wenig Schutz vor Gefahren bot, zu überleben. Demgegenüber scheint das langsame Denken, das von Aristoteles zum Kennzeichen des Menschen gemacht wurde, nicht zu unserem biologischen Erbe zu gehören, sondern ein Ergebnis der kulturellen Entwicklung darzustellen. Darin liegt begründet, weshalb es von jeder Generation im Rahmen von schulischen Bildungsprozessen wieder neu erworben werden muss.
Die Schule als Ort des Denkens
Die Schule ist so gesehen ein kulturgeschichtlich notwendiger Ort, der die nachwachsenden Generationen zum Denken zwingt. Ihre Unabdinglichkeit verdankt sie nicht dem schnellen, sondern dem langsamen Denken, einem Denken also, dessen Bezug zum Alltag oft schwer zu erkennen ist. Die Schule ist ein künstlicher Raum, der sich durch noch so viel ‹Öffnung› des Unterrichts nicht in eine normale Lebenssituation verwandeln lässt.
Das aber ist genau die Herausforderung dessen, was wir Bildung nennen. In der Bildung finden nicht Wissen und Können, sondern Wissen und Denken zusammen, insofern Bildung den Menschen ermöglicht, sich in der Welt zu orientieren. Das schliesst nicht aus, dass aus der Orientierung ein Handeln wird, vermeidet aber, dass das Denken aus dem Bildungsauftrag der Schule verbannt wird. Vielleicht ist das Gute an der Corona-Krise, dass sie uns hilft, zu dieser grundlegenden Einsicht in Sinn und Zweck von Schule und Unterricht zurückzufinden.