Von der Sprache und vom Denken
Als Erstes stellt R. Reichenbach klar, dass er die Sprache für einen entscheidenden Faktor der Inhalte seines Referats halte, weshalb er den Titel seines Vortrags entsprechend ergänzt habe. Sprache sei ungeheuer wichtig. Die Art, wie wir über die Dinge sprechen, drücke aus, wie wir denken. Das Denken an sich werde – er sagt es mit einem Augenzwinkern – insgesamt eher überschätzt, bleibe aber dennoch wichtig.
«Man kann intelligent sein, ohne sehr viel nachzudenken. Das ist zwar wenig wahrscheinlich, kommt aber trotzdem häufig vor.»

Das Denken sei im Übrigen eine Praxis, was bedeute, man könne es tun oder lassen. Und Denken habe wenig mit Intelligenz zu tun. So könne man intelligent sein, ohne sehr viel nachzudenken. Das sei zwar wenig wahrscheinlich, komme aber trotzdem häufig vor. Umgekehrt könne man weniger intelligent sein, aber viel nachdenken über sich und das Leben und zu Schlüssen kommen – womöglich brauche man ein wenig länger dafür, das wisse er nicht. Lukas Erni habe übrigens vorhin – ohne es so zu artikulieren – etwas über die Berner ausgesagt, dem er zustimme: Es sei dort nicht so viel los; ganz im Unterschied zum LVB, und darum sei er gerne hierher gekommen.
Privilegierte werden noch mehr privilegiert
«Die Pädagogik der Privilegierten» sei der Titel eines dünnen Bändleins, das er kürzlich herausgegeben habe. R. Reichenbach glaubt, dass das heutige pädagogische Denken und Sprechen, wie es im Mainstream auch an den Hochschulen gelebt und gelehrt werde, den Privilegierten diene. Früher hätte man dies als Ideologiekritik bezeichnet, aber dieser Begriff werde heute so nicht mehr verwendet.
«Das heutige pädagogische Denken und Sprechen dient den ohnehin schon Privilegierten.»
Was er mit seinen Studierenden tue: Hinschauen, wie man über Bildung, Erziehung und Schule spreche – und prüfen, welche Konzepte überzeugten und welche nicht. Und eben: Er komme zum Schluss, das derzeit vorherrschende Denken und Sprechen komme jenen zugute, die ohnehin schon privilegiert seien; obwohl es bei diesen jungen Menschen fast gar nicht darauf ankomme, welchen Konzepten sie zu folgen hätten, denn Privilegierte blieben in jeder pädagogischen und didaktischen Welt privilegiert.
Die Leistungsschwachen sowie die aus verschiedenen Gründen weniger Motivierten aber müssten anders behandelt werden, und das wisse eigentlich jede Pädagogin und jeder Pädagoge. Sie bräuchten mehr Führung, mehr Kontrolle, aber auch sehr viel mehr Ermutigung, das sei ganz wichtig. Man müsse zeigen, dass man sie gernhabe, aber sie auch fordern und nicht nur fördern. Für ihn sei es erschreckend zu sehen, wie die weniger Privilegierten zu wenig gefordert und herausgefordert würden.

Das Pädagogische am Kirchenbesuch
Das verwendete «moderne» Vokabular, er wiederhole es noch einmal, diene den Privilegierten. Das Selbst, die Autonomie, ja überhaupt alles, was gewissermassen von innen komme, habe einen guten Ruf. Das Selbst werde heute permanent überbetont. Und sobald man vom Selbst spreche, würden immer alle nicken. Das sei doch furchtbar, denn wenn alle immerzu im Gleichklang nickten, sei in der Regel etwas nicht in Ordnung. Das sei wie im Gottesdienst, wenn der Pfarrer frage, ob wir nicht alle Sünder seien – und alle würden vermeintlich schuldbewusst nicken.
«Die Kirche ist im Kern etwas sehr Pädagogisches.»
Er habe im Übrigen nichts gegen Gottesdienste, auch wenn er derzeit eigentlich nur wegen Beerdigungen zur Kirche gehe, aber im Kern sei für ihn die Kirche etwas sehr Pädagogisches, und das meine er nicht humoristisch. Früher seien ja die Predigten noch auf Latein gehalten worden und keiner der Kirchgänger/-innen habe etwas verstanden – das sei pädagogisch, ihm gefalle das. Leider sei das Gesagte mittlerweile verständlich geworden, wobei er sich nicht sicher sei, ob das tatsächlich stimme, ob da also wirklich verstanden werde. Ihm gefalle dabei auch, dass es keine Diskursivität gebe. Selbst wenn jemand inhaltlich während der Predigt etwas nachfragen würde (was ohnehin niemand tue), es werde nichts wiederholt.
Es fehle ferner jeder didaktische Aufbau, was R. Reichenbach ebenfalls sehr gefalle. Man wisse nie, was komme. Die Predigt von heute müsse nicht das Geringste mit jener vom vergangenen Sonntag zu tun haben. Und trotzdem seien alle aufgehoben. Man sei dabei, selbst wenn man schlummere. Jeder gehöre dazu. Dann heisse es vielleicht: «Wir erheben uns zum Gebet.» Jene, die könnten, würden in der Regel aufstehen, aber jene, die nicht wollten, manchmal nicht. Doch das spiele keine Rolle, niemand werde gemassregelt deswegen. Das sei doch Pädagogik!
Auch wenn man selbst nicht singen könne, irgendjemand könne immer singen. Dann heisse es: «Wir singen jetzt Psalm XY.» Und dann gebe es so einen Mix aus Singen, Summen, Brummen, Schweigen. Und am Ende gebe es keine Prüfung. Auch das gefalle ihm. Es gehe um diese ganze Unterstellung: Man tue so, als ob das, was da geschehe, bedeutungsvoll sei.
In Wahrheit müsse man üben, praktizieren – und daran glauben, dass es dann schon gut komme.
Baby-Pädagogik
Ganz ähnlich beginne die Pädagogik mit den Babys, den Neugeborenen. Wir holen sie nicht dort ab, wo sie stehen. Das mache überhaupt keinen Sinn, das sage man heutzutage nur ständig so pädagogisch dahin. Es werde ja niemand mit dem Baby lallen wollen. Nein, in Wahrheit tue man so, als ob das Baby einen verstehen würde, auch wenn es nichts verstehe. Doch es sei aufgenommen als voller Mensch, akzeptiert als Mitglied unserer Gemeinschaft. Und das Baby sehe sich konfrontiert mit der schwierigsten Aufgabe überhaupt: Laute und Bedeutungen in einen Zusammenhang zu bringen, ergo: Sprache.
«Babys werden pädagogisch nicht dort abgeholt, wo sie stehen. Das macht überhaupt keinen Sinn.»
Wenn man sich so ein Baby anschaue, dann sehe es, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick nicht gerade wie ein vielversprechender Kandidat für den Bildungserfolg aus. Es habe noch einen langen Weg vor sich. Aber: Es komme gut! Doch wie denken und sprechen wir heute? Man glaube immer, man erkläre etwas und das Kind müsse es gleich verstehen. Das sei abartig. In Wahrheit müsse man üben, praktizieren – und daran glauben, dass es dann schon gut komme.
Das konservierte Moment und notwendige Friktionen
Zudem würden die Kinder heute angesprochen, als ob sie ihre eigenen Bildungstheoretiker/-innen wären. Sie müssten ständig über etwas nachdenken und reflektieren. Metakognition und solche Sachen – fürchterlich! Das sei alles unnötig. Die Zuhörenden würden nun wohl denken, was für ein total konservativer Typ da vorne spreche. Selbst wenn dem so wäre, laute seine Antwort: Na und? Das sei ihm egal.
Wer pädagogisch denke, erkenne, dass man manche Dinge bewahren müsse, und das sei dann eben konservativ. Das konservierte Moment sei sehr wichtig. Was einem wichtig sei, das wolle man weitergeben. Wissen und Wissensweitergabe seien intrinsisch miteinander verbunden. Wenn einem die Welt wichtig genug sei, dann wolle man sie weitergeben. Dann sage man nicht: «Das kannst du machen, wie du willst!» Diese sogenannte permanente Offenheit in jeder Hinsicht sei seine Sache nicht. Offen zu sein für alles bedeute, nicht ganz dicht zu sein. Ein bisschen offen sein, ja, aber pädagogisch müsse man wissen, was man wolle und weitergeben wolle.
«Offen zu sein für alles, bedeutet nicht ganz dicht zu sein.»
Pädagogisch modern würde aber auch bedeuten, dies zu wissen: Was die jungen Menschen dann mit dem machen, was ich ihnen weitergebe, ist deren Sache, nicht meine. Meine Sache ist es zu zeigen, was mir wichtig ist, was ich für wichtig halte. Und ich muss zeigen, dass ich will, dass sie das übernehmen. Am Ende täten sie dann etwas anderes, das sei modern. Ich sage also: «In diese Richtung!», aber sie bewegen sich in die entgegengesetzte. Irgendwann lerne der junge Mensch, Nein zu sagen. Autonom werde man jedoch nur durch Emanzipation. Autonom werde man nicht dadurch, dass man machen könne, was man wolle, sondern dadurch, dass man sich befreie. Es brauche eine Friktion. Humboldt habe dies die Widerständigkeit der Welt genannt.

Wenn die Erwachsenen den jungen Menschen keinen Widerstand entgegenbrächten, ergebe sich ein Problem: Die Älteren meinten dann, sie seien sehr nahe bei den Jüngeren und dabei erst noch besonders pädagogisch, aber in Wahrheit handle es sich um einen Fehler.
Beispiel: Die Tochter kommt nach Hause und sagt, sie habe keinen Bock mehr auf Mathematik, mit der neuen Lehrerin mache es keinen Spass. Reaktion der Eltern: «Oh, das tut mir aber leid. Mit der vorherigen Lehrerin war es so toll und die neue ist nun viel weniger gut, das ist aber schade.» Die erwachsene Person stelle sich sozusagen auf die Seite des Kindes, was auch durchaus verständlich sei, und steigere sich oft in Formulierungen hinein wie: «Die binomischen Formeln wirst du ohnehin nie brauchen! Müsst ihr die heute wirklich noch lernen? Das ist doch Blödsinn!» Dadurch werde komplizenhaft ein Keil zwischen Kind und Lehrerin, Kind und Curriculum, Kind und Schule getrieben. Besser wäre es, zu fragen, wie denn die binomischen Formeln eigentlich schon wieder lauteten, ein Gespräch über den Inhalt aufzubauen. Das wäre eine gute Pädagogik.
→ Hier geht es zum ganzen Artikel: «Die Pädagogik der Privilegierten und die Sprache der Bildung»






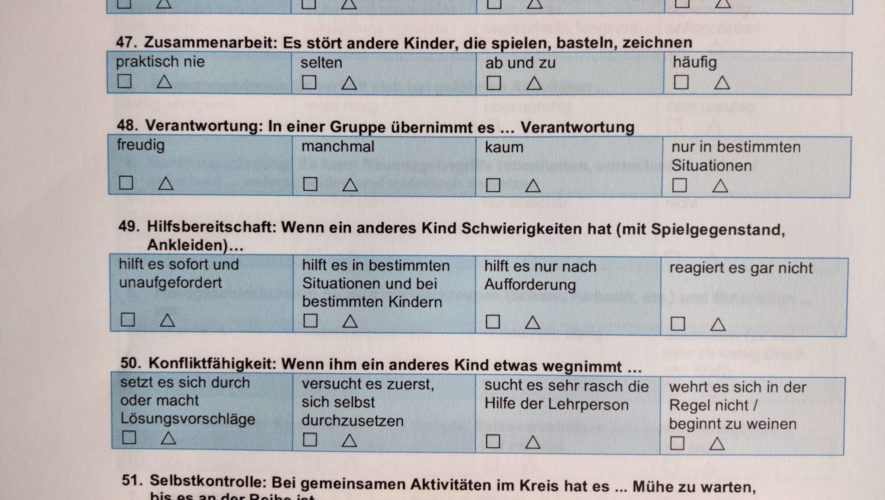
Das pdf download funktioniert beim Referat von Dr. Roland Reichenbach über “Die Pädagogik der Privilegierten und die Sprache der Bildung” nicht
Doch, es geht, wenn Sie auf den fettgedruckten Satz “Die Pädagogik der Privilegierten und die Sprache der Bildung” ganz am Ende des Textes klicken und nicht auf das PDF-Symbol.
Sehr geehrter Herr Hirt, aufgrund der Länge des Artikels haben wir nur den ersten Teil direkt im Blog veröffentlicht. Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie bitte auf «Die Pädagogik der Privilegierten und die Sprache der Bildung». Freundliche Grüsse, Philipp Loretz