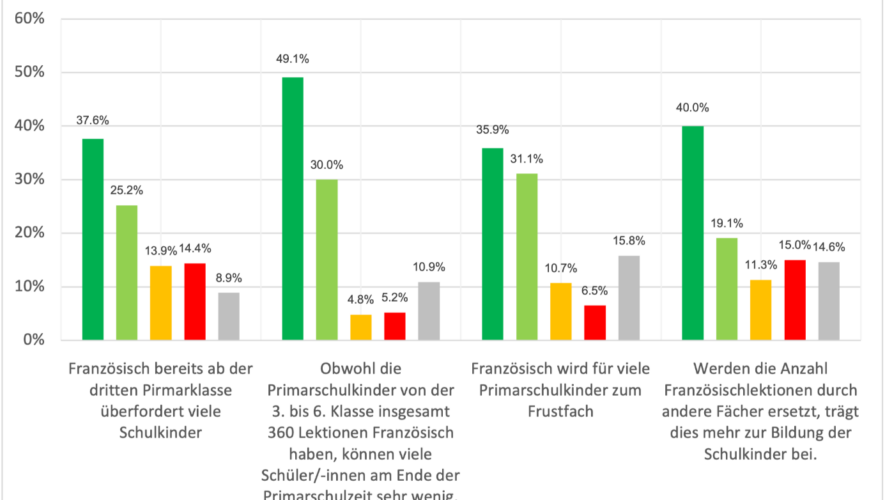Im letzten Moment habe man eine weitere verfehlte Bildungsreform stoppen können, schrieb die FDP am Freitag in einer Mitteilung. Der Bundesrat sei eingeknickt, die schriftliche Abschlussprüfung für Lehrlinge werde nun doch nicht abgeschafft. Das Staatssekretariat für Bildung (SBFI), das besagte Reform angestossen hatte, sprach gleichentags vor den Medien hingegen von einem Kompromiss. Es wollte vermeiden, als Verlierer zu gelten.
Erst klingt es wie ein Widerspruch, doch in gewisser Weise haben beide recht. Und beide liegen auch ein bisschen falsch.

Der Bund schafft die schriftliche Abschlussprüfung im allgemeinbildenden Unterricht (ABU) zwar nicht ab. Doch die Kantone können immer noch entscheiden, ob die Berufsschulen ihre Lehrlinge mündlich oder schriftlich prüfen.
Zudem war die Abschaffung der Schlussprüfung nur ein Punkt der Reform. Das einzige “Pièce de Résistance”, wie Rémy Hübschi vom SBFI vor den Medien sagte.
Damit könnte eine Kontroverse enden, die mit pointierter Kritik aus der Basis begann, von dort in die Medien drang und schliesslich im Bundeshaus ausgetragen wurde.
Prüfung oder Gespräch?
Angefangen hat sie, als das SBFI im vergangenen Frühling eine Verordnung in die Vernehmlassung schickte, welche die Ausbildung der Lehrlinge in der Schweiz reformieren sollte. Denn die geltende Verordnung stammt aus dem Jahr 2006, als es noch keine Smartphones und keine KI gab. Zudem war eine Reform schon seit 2019 geplant. Das SBFI erklärte deshalb, dass der Status quo nicht mehr zeitgemäss sei.
Kurz darauf kritisierten erst einige Lehrpersonen und Verbände ein Detail der Reform: Statt eine Schlussprüfung zu absolvieren, sollten Lehrlinge künftig während einer halben Stunde mündlich ihre Abschlussarbeit verteidigen und Fragen zum Schulstoff beantworten. In einem “vertiefenden Gespräch”.
Die Gesamtnote hätte sich künftig zu je 50 Prozent aus den Erfahrungsnoten und der Abschlussarbeit zusammengesetzt.
“Das ist eine Idee aus einer bestimmten Küche: Leistung wird verschmäht, den Schülern soll alles möglichst einfach gemacht werden, bloss keinen Stress verursachen.”
Konrad Kuoni, Präsident des Zürcher Verbandes der Lehrkräfte in der Berufsbildung
Doch aus der Kritik wurde in den folgenden Monaten eine Kontroverse. Kritiker aus der Basis sahen das Leistungsprinzip bedroht. Vor allem der Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung (ZLB) ging in die Offensive. Der Präsident Konrad Kuoni sagte in der NZZ: “Das ist eine Idee aus einer bestimmten Küche: Leistung wird verschmäht, den Schülern soll alles möglichst einfach gemacht werden, bloss keinen Stress verursachen.”
Das Staatssekretariat reagierte im Sommer zunächst nicht auf die ersten kritischen Stimmen. Man wollte die Vernehmlassung abwarten. Darin sprach sich schliesslich eine knappe Mehrheit der Kantone gegen eine Abschaffung aus. Auch mehrere Parteien waren dagegen. Die SP bemängelte in der Vernehmlassung sogar, dass im Bericht eine Begründung für die Abschaffung fehle.
Der ZLB und auch einzelne Lehrpersonen von der Basis kritisierten nun zunehmend öffentlich, dass das Staatssekretariat an der Basis vorbei eine Reform durchdrücken wolle, der Druck auf das SBFI stieg mit jedem neuen Artikel in den Medien.
Doch noch im Winter hielt das SBFI an seinen Plänen fest und teilte mit, die Reform spiegle einen “breit abgestimmten Konsens der Verbundpartner wider”. Das hat sich nun verändert.
Kampagne, Kontroverse, Kompromiss
Mitte Februar diskutierte die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates (WBK-S) über die Reform und liess sich die geplanten Änderungen von der Verwaltung erklären. Weil es sich um eine Verordnung handelte, konnte die WBK-S allerdings nur Empfehlungen an den Bundesrat aussprechen. In einer Mitteilung schrieb sie, der Verzicht auf die Abschlussprüfung sei ein falsches Signal an die Leistungsbereitschaft der Lehrlinge. Alternativ schlug sie vor, dass die Kantone zwischen zwei Prüfungsformen entscheiden sollten.
Am Freitag zeigte sich nun, dass das Staatssekretariat diesen Empfehlungen folgt. Rémy Hübschi vom SBFI sagte der NZZ: “Die Kontroverse hat uns überfahren.” Man habe die Reform in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern erarbeitet und den zeitgemässen Herausforderungen entsprechend aufgegleist. “Wir wollten nicht gar nicht, sondern anders prüfen.”
“Den Entscheid nun den Kantonen zu überlassen, führt zu einem Flickenteppich.”
Konrad Kuoni, Präsident des Zürcher Verbandes der Lehrkräfte in der Berufsbildung
Hübschi räumt aber ein, man habe Lehren aus den vergangenen Monaten gezogen und wolle die Basis künftig stärker einbeziehen. Die angepasste Reform, die er am Freitag vorstellte, ist denn auch ein Kompromiss. Die Abschlussprüfungen bleiben erhalten, sollen in ihrem Aufbau künftig aber die Abschlussarbeit ergänzen. Der Fokus soll auf Kompetenzen und weniger auf dem Abfragen von Fakten liegen.
Konrad Kuoni vom ZLB sagt, die neue Lösung sei ein Sieg für die Basis, aber auch ein fauler Kompromiss. “Den Entscheid nun den Kantonen zu überlassen, führt zu einem Flickenteppich.” Im Fall des Kantons Zürich bestehe die Hoffnung, dass sich dieser nun für die Beibehaltung der schriftlichen Prüfung ausspreche, wie es die grosse Mehrheit des betroffenen Lehrkörpers wünsche.
In den kommenden Wochen sucht das Staatssekretariat mit Bund, Kantonen und Verbänden das Gespräch, um die angepasste Verordnung breit abzustützen und fristgerecht einführen zu können. Nachdem die Reform nun entschärft worden ist, stehen die Chancen gut, dass sie fristgerecht am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.