An Weihnachten bringt Disney eine Neuauflage des Kinderfilms “König der Löwen” ins Kino. In der Originalgeschichte tötet sein Bruder den Löwenkönig Mufasa, übernimmt die Macht in der Savanne und zerstört das “empfindliche Gleichgewicht” der Natur, von dem der Löwenkönig seinem Sohn erzählt hatte: Alle Geschöpfe müssten gleichermaßen beschützt werden, betonte er.
Die Botschaft findet sich häufig in Kinderliteratur: Eingriffe in die Natur werden als Werk des Bösen beschrieben. Menschen, so steht es in Deutschland auch in Schulbüchern, sind Übeltäter, sie verursachen Umweltverschmutzung, “Fortschrittswahn” und Klimakatastrophe. Kaum ein Kind erfährt, dass Gesundheit und Wohlergehen Eingriffen in die Natur zu verdanken sind, ohne die die Umwelt für Menschen gefährlich und unergiebig wäre.

Hunderttausende Jahre starb fast die Hälfte der Menschen vor dem fünften Lebensjahr und die meisten Erwachsenen starben dann vor ihrem vierzigsten. Erst die industrielle Revolution vor 200 Jahren, ausgehend von Westeuropa und den USA und befeuert von fossiler Energie, ermöglichte Bergbau in großem Stil, Chemie-Industrie und moderne Landwirtschaft, wodurch sich die Menschheit Naturgefahren wie Krankheiten, wilde Tiere oder Wetterrisiken vom Hals halten konnte, sodass sich die Lebenserwartung weltweit verdoppelte.
Doch just mit der Generation des Wirtschaftswunders, die wie keine zuvor vom technologischen Fortschritt profitiert hatte, kamen in westlichen Staaten Anti-Technologie-Proteste in Mode, mit denen Wohlstandsbürgern politischer und gesellschaftlicher Aufstieg gelang, weil Kapitalismus auch seinen Kritikern prosperierende Märkte bietet. Publikumswirksam wurden vermeintliche “Grenzen des Wachstums” ausgerufen – aber die Prognosen traten nicht ein, weil Wirtschaftswachstum nicht auf linear wachsenden Ressourcenbedarf angewiesen ist, sondern auch auf Effizienz und Kreativität basiert.
Was auf den ersten Blick nach vernünftiger Sensibilisierung für das Klimaproblem aussieht, entpuppt sich auf den zweiten als Krux: Nicht Fortschritt, Innovationen und ökonomische Bildung – Königswege zur Lösung des Klimaproblems – stehen auf dem Unterrichtsplan, sondern dirigistische Verhaltensregulierungen, kontrolliert von kollektivistisch orientierten Gremien.
Dennoch bekommen Schüler die Litanei weiterhin eingetrichtert – verbunden mit der Handlungsmaxime: Verzicht. Hunderte Schulen in Deutschland haben “Klimaschutzpläne” beschlossen, welche die Einschränkung von Energiebedarf und CO2-intensiver Lebensweise vorsehen, die mit Auszeichnungen wie dem “Klimasiegel” bedacht werden. Heizungen werden heruntergedreht, Ausflüge überdacht, Fleischgerichte gestrichen, Schulmaterialien eingeschränkt, Abfälle vermieden, “Geh-Gemeinschaften” gebildet.
Was auf den ersten Blick nach vernünftiger Sensibilisierung für das Klimaproblem aussieht, entpuppt sich auf den zweiten als Krux: Nicht Fortschritt, Innovationen und ökonomische Bildung – Königswege zur Lösung des Klimaproblems – stehen auf dem Unterrichtsplan, sondern dirigistische Verhaltensregulierungen, kontrolliert von kollektivistisch orientierten Gremien. Der Klimaschutzplan eines Hamburger Gymnasiums schwärmt von den Einschränkungen während der Corona-Zeit: Weil Menschen auf Autofahren und Fliegen verzichteten, wären “Tiere an Orte zurückgekehrt, an denen man sie schon über Jahrzehnte nicht mehr finden konnte”.
Voll von katastrophistischen Übertreibungen
Diese Schülergeneration erbt ein Land, das laut Bundesbank in die schlimmste Wirtschaftskrise seit 1949 schlittert – wie will sie zu Wohlstand kommen, wenn sie lernt, dass menschliche Aktivitäten die Welt zerstören? Im Unterricht gelesen werden Schriftsteller, die vor “Machbarkeitswahn” warnen: Max Frischs “Homo faber”, Bertolt Brechts “Der gute Mensch von Sezuan”, Öko-Dystopien von Frank Schätzing oder schon in den 1980ern Gudrun Pausewangs “Die Wolke”, das den Deutschen die Kernkraft abspenstig machte.
Selten fänden sich Inhalte, die technologischen Fortschritt als Erfolgsgeschichte lehren, stattdessen bestimme Wachstumskritik den Unterricht, klagt Robert Benkens, Lehrer an einem Gymnasium in Oldenburg. Grüne Umweltorganisationen gelten als seriöse Quelle für Unterrichtsmaterial, nicht aber Unternehmerverbände. Eine Recherche von WELT hat gerade ergeben, dass Schulbücher zum Thema Klimawandel voll sind von katastrophistischen Übertreibungen. Eine App des WDR für den Schulunterricht geht noch weiter: Sie zeigt Schülern, wie sie in der Klimakatastrophe umkommen könnten.

Jeder soll einen Beitrag leisten, um die Apokalypse zu verhindern: “Genau wie Ameisen können wir gemeinsam viel erreichen”, proklamiert das Kinderbuch “Welt retten. Was jede*r dafür tun kann” (Sauerländer-Verlag). Unternehmertum hingegen kommt schlecht weg: Wissenschaftler des Zentrums für ökonomische Bildung haben 40 Schulbücher untersucht und festgestellt, dass ökonomisches Denken darin kaum eine Rolle spielt.
Es werde der Eindruck erzeugt, technischer Fortschritt “falle vom Himmel” und Marktwirtschaft führe vor allem zu Ausbeutung und Umweltverschmutzung. Der Staat hingegen werde als “fürsorglicher, paternalistischer Akteur verkauft, der über seine Bürger wacht und stets das Gute will”. Nur folgerichtig scheint, dass sich die Quote der Firmengründer in Deutschland seit der Jahrtausendwende halbiert hat und seit Jahren nur noch der staatliche Sektor wächst.
Technischer Fortschritt? Fällt vom Himmel.
Blind scheint der Schulunterricht für positive Entwicklungen: dass Wirtschaftswachstum beispielsweise täglich Zehntausende aus extremer Armut befreit. Dass dank genetischer Veränderungen an Getreide weltweit ein Drittel mehr Kalorien pro Person zur Verfügung stehen als vor 60 Jahren. Dass industrielle Landwirtschaft und Verstädterung den Bedarf an Land massiv verringern, Wildtiere schonen und Naturschutzgebiete Rekordflächen erreicht haben.
Dass selbst der Uno-Klimarat eine prosperierende Welt erwartet. Dass moderne Medizin die Kindersterblichkeit dramatisch gesenkt hat. Dass die Wahrscheinlichkeit in einer Wetterkatastrophe zu sterben um mehr als 95 Prozent gesunken ist. Dass Ingenieure auch für die Energiewende an Lösungen arbeiten, die keinen Verzicht auf Wirtschaftswachstum und Wohlergehen erfordern – das kommt kaum vor im Schulunterricht.
Neue Lehrpläne wären nötig, sofern der jungen Generation ein Aufbruch gelingen soll. Starten könnte der Unterricht mit einem Artikel der “New York Times” vom 9. Oktober 1903. Ein bis zehn Millionen Jahre würde es noch dauern, bis es bemannte Flugzeuge gebe, hieß es unter der Überschrift “Flugmaschinen, die nicht fliegen”. Neun Wochen später gelang den Gebrüdern Wright der erste bemannte Flug.
WELT-Chefreporter Axel Bojanowski berichtet seit 1997 als Wissenschaftsjournalist vor allem über Klimaforschung, Geowissenschaften und Klimapolitik. In seinem neuen Buch “Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten” erzählt der Geologe vom Klimawandel zwischen Lobbyinteressen und Wissenschaft.





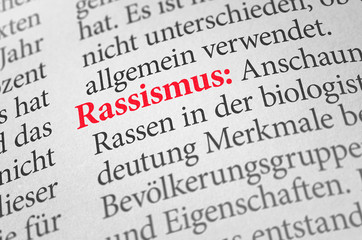

Ach du meine Güte – Frisch und Brecht haben wir in den 1970ern auch gelesen, und ich glaube nicht, dass die uns geschadet hätten. “Die Wolke” hat in den 1980ern in der Anti-Atomkraftbewegung kaum eine Rolle gespielt; eher dann doch die Tatsache, dass die Konzerne die Gewinne einstreichen und die Folgekosten, was den radioaktiven Abfall angeht, für die nächsten 100.000 Jahre die Gesellschaft tragen soll. Und dass man hierzulande wenig Firmen gründet liegt weniger am Lehrplan als an der überbordenden Bürokratie und der Unzahl von Vorschriften.
Und für die Hauptproblemen der Schulen von heute sind nicht zuletzt die vielen Experten von außerhalb verantwortlich, also diejenigen, die seit 50 Jahren keine Schule mehr von innen gesehen haben.
… stimme Herrn Lemmermeyer zu, etwas zu einseitig, dieser Text; obwohl ich mit der Grundhaltung dahinter durchaus einverstanden bin: Zu viele Köche verderben den Brei – seit Jahrzehnten stimmt dieses Sprichwort für die (Volks-)Schule leider viel zu stark. Auch die zu forcierte Inklusion ist einer guten Grundbildung für alle abträglich, überfordert LP wie SuS und gibt nicht unbedingt eine Heimat für die Klassengemeinschaft, jedenfalls nicht so wie beabsichtigt. Chancengleichheit ist ein Phantom; Chancengerechtigkeit ist anzustreben – eine genug grosse, auszutarierende Herausforderung, die nicht immer gelingt.
Nicht verzichten müssten nur die, welche eh schon alles haben und grossmäulig Verzicht predigen an Kongressen, zu denen sie mit dem Privatjet angereist sind. Oder um Klaus Schwab zu zitieren: Du wirst nichts besitzen und glücklich sein – gilt natürlich nicht für die Privatjet-Gilde.
Nur noch widerlich, diese Arroganz!