
Dagmar Rösler, die Präsidentin des Schweizer Lehrerverbands (LCH), ist eine Frau mit gutem Gespür für die bildungspolitische Stimmungslage in diesem Land. Darum ist die Bildungslobbyistin das Megafon für viele Schweizer Pädagogen. Gibt es Probleme, gibt sie ein Interview. Ihre Funktion als «oberste Lehrerin» mag überhöht sein, wirkmächtig ist sie allemal.
Es ist demnach durchaus bemerkenswert, was Rösler in einem Schreiben als Losung für das gerade angebrochene Jahr herausgibt: «2026 wird ein Jahr der Klärung.» Inhaltlich spricht sie mehrere Themen an, aber eigentlich geht es nur um eines: die integrative Schule.
In vielen Kantonen hat sich die Meinung durchgesetzt, dass dieses Konzept gescheitert ist, den Schülern nicht nur wenig bringe, sondern sogar schade. Im Kanton Basel-Stadt werden bereits wieder Förderklassen angeboten. In Zürich ist dasselbe geplant, in Luzern gibt es ebenfalls Bestrebungen. Konservativere Kantone wie der Aargau setzen längst wieder auf separativere Systeme.

Auch der politische Druck wächst: Die SVP und die FDP wollen die integrative Schule abschaffen
Der LCH hat lange am Status quo festgehalten. Offiziell tut er das immer noch, von einer Abkehr will er offiziell nichts wissen. Rösler betont mantraartig, dass die integrative Schule nicht gescheitert sei. Also die Handhabe, dass alle in einer Regelklasse unterrichtet werden, mögen ihre Defizite – psychische Einschränkungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Lernrückstände – noch so gross sein.
Dass es Probleme gibt, wird aber mittlerweile eingestanden. Viele Schüler sind überfordert, hängen ab. Oder stören den Unterricht so stark, dass für die Mehrheit an anständiges Lernen nicht mehr zu denken ist. Wer sich konzentrieren will, trägt heute einen Gehörschutz. Viele Kinder haben ein Sondersetting, die Heilpädagogen und Assistenten kommen und gehen, es herrscht oftmals Unruhe.
Im vergangenen Jahr sagte Rösler, dass die Lehrer «an Grenzen» stiessen, es so nicht weitergehen könne. Gefordert wurden Korrekturen, wie etwa halbintegrative Modelle wie Lerninseln, und vor allem: mehr Geld für mehr Personal.
Nun hat sich die Dringlichkeit offensichtlich nochmals verschärft. Der Verband will unter seinen Mitgliedern in einer Umfrage klären, ob die Unterstützung für die integrative Schule überhaupt noch gross genug ist, um diesen Weg weiter zu beschreiten.
Das Wording wurde bereits in früheren Positionspapieren angepasst, nun wird es auch öffentlich nach aussen getragen: Da es sich bei der «integrativen Schule» nicht mehr um eine positiv konnotierte Begrifflichkeit handelt, wird sie entsorgt. Neu wird von einem «inklusionsorientierten Schulsystem» gesprochen. Orientierung klingt weniger nach Pflicht, mehr nach einem Ziel, einer Möglichkeit. Rösler setzt dabei auf eine Formel, die beliebig interpretiert werden kann: «Integration wo möglich, Separation wo nötig.»
Das ist eine neue Öffnung des Meinungskorridors, der bislang eher eng gehalten wurde: Mit Verve wurde die Überzeugung vertreten, dass die meisten Pädagogen hinter dem integrativen Modell stehen.
Fertig progressiv?
Wie das in der Realität umgesetzt werden kann, wird jetzt abgefragt. Rösler sagt es deutlich: Der Verband wolle herausfinden, wie die Situation vor Ort sei, also in den Schulklassen, und wie die Lehrer die Lage beurteilten. Kurz: wie sie «grundsätzlich zur inklusionsorientierten Schule» stünden. Das ist eine neue Öffnung des Meinungskorridors, der bislang eher eng gehalten wurde: Mit Verve wurde die Überzeugung vertreten, dass die meisten Pädagogen hinter dem integrativen Modell stehen. Vertreten von Rösler und dem LCH, die – bei allen eingestandenen Problemen – den sogenannten progressiven Weg weiterführen wollten.
Rösler sagte in einem Interview offen: «Ja, ich bin woke.» Sie spricht sich gegen Noten an Primarschulen aus, sie hält den Schulen zugute, dass sie das Handy «im Griff» hätten. Sie ist überzeugt, dass die Schulen wegkommen müssten von der Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gebe. Und warum nicht den Genderstern verwenden, wenn man sich darauf einigte? Der NZZ sagte sie: «Die Schule hat den Auftrag, alle Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft, Kultur, geschlechtlichen Orientierung, zu integrieren.»
Die Schule als ultimativ integrative Umgebung.
Das klingt gut. Wer kann da dagegen sein? Das war auch die Idee bei der Einführung. Verkrustete Strukturen sollten überwunden werden. Jedes Kind sollte im integrativen Modell bestmöglich betreut werden. Chancengerechtigkeit war das Schlagwort. Kein Stigma mehr für die Schwächeren, keine Ausgrenzung. Alle zusammen in einer Regelklasse? Klang wunderbar, fair, divers, fortschrittlich.
Ausweg für Ideologen
Die Probleme wurden lange kleingeredet oder als lösbar dargestellt, wenn man nur einen Flickenteppich von Massnahmen – wie «Schulinseln» oder «erweiterten Lernraum» – einführte. Am besten für jedes Kind ein Sondersetting. Hauptsache, die integrative Schule als Ganzes muss nicht hinterfragt werden.
Dabei ist unbestritten, dass es in jeder Klasse einen Kipppunkt gibt: Gibt es zu viele verhaltensauffällige Kinder, leidet die Leistung von allen. Dieser Kipppunkt liegt gemäss Forschung bei etwa 20 Prozent. Das bedeutet: Wären von zwanzig Kindern vier in einem getrennten Unterricht besser aufgehoben, scheitert das integrative System.

Dass nun auch Rösler explizit von «separaten Formen» spricht, könnte tatsächlich auf einen Richtungswechsel hindeuten. Womöglich auch, weil die Basis das integrative Modell nicht mehr stützt.
Diesen Eindruck teilt auch Martina Bircher, Bildungsdirektorin im Kanton Aargau und dezidierte Kritikerin der integrativen Schule. Bircher ist das neue Wording ebenfalls aufgefallen.
Für sie klingt die neue Haltung, wie sie Rösler schildert, ziemlich vertraut: Es klinge nach dem Konzept, das der Kanton Aargau seit dem vergangenen Jahr umsetze. Das heisst: Alle Kinder gehen in dasselbe Schulhaus, aber eben nicht zwangsläufig in dieselbe Klasse.
Das sei, das hat Bircher jüngst schon in einem NZZ-Interview gesagt, wirklich integrativ. Was dagegen überhaupt nicht funktioniert habe: alle in die Regelklasse zu schicken, in der viele überfordert seien, im schlimmsten Fall die Leistung aller Schüler runterzögen. Und jene, mit denen es gar nicht gehe, würden in die Sonderschule weit weg von den regulären Schulhäusern geschickt. Bircher sagte: «Heute fordern genau diejenigen, die alle Kinder in dieselbe Klasse schicken wollen, mehr Sonderschulplätze. Dieser Widerspruch ist ein Witz. Wie so oft bei Ideologien.»
Dass man sich beim Lehrerverband nun am Aargauer Modell zu orientieren scheint, kann Bircher gut nachvollziehen. Diese Art von wahrlich integrativer Schule habe zu einer politischen Entspannung geführt – weil sich eine Mehrheit darauf einigen könne. Vor allem, weil es «Ideologen ermöglicht, weiterhin ihr Gesicht zu wahren». Da sie weiterhin von Inklusion sprechen, aber gleichzeitig wieder separativer unterrichten können. Es könne deswegen gut sein, sagt Bircher, «dass diese Entwicklung dem Lehrerverband nicht verborgen geblieben ist».
Das ist durchaus denkbar. Denn wenn jemand feine Sensoren für die Stimmungslage der Pädagogen in diesem Land hat, dann ist das Dagmar Rösler.






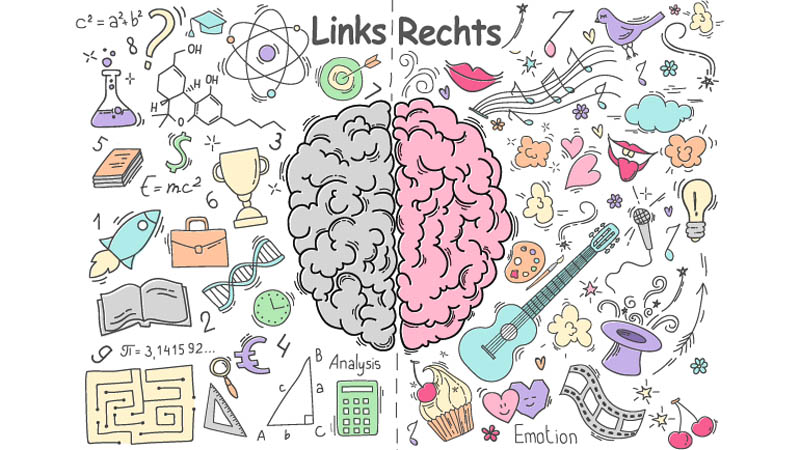
Dagmar Rösler hat m. E. eher eine sehr schlechte Wahrnehmung, was die Belange der Volksschule anbelangt – sonst hätte sie nicht so lange am integrativen System festgehalten, das sie notabene immer noch verteidigt. So geht linke Ideologisierung.
Ich arbeite als SHP. Bereite quasi Einzelunterricht auf mehreren Niveaus in der Regelklasse vor. Mit den wenigen Lektionen in der Klasse, erkläre und fördere ich bestmöglich. Den Rest der Stunden sitzen die Kinder im Unterricht und wir hoffen, sie lenken die anderen Schüler nicht zu sehr ab. Es stimmt für niemanden mehr. In unserer Schule sind in jeder Klasse mehr als 20% mit Förderbedarf. Das aktuelle System ist das Unfairste für ruhige und gute Lerner. Die Lehrer brennen aus, weil sie niemandem mehr gerecht werden können.