Dass es um die Bildung in Deutschland nicht zum Besten steht und dass insbesondere in den MINT-Fächern, die für ein Land essenziell sind, das durch Innovationen auf dem Weltmarkt bestehen will, nur ein mäßiges Niveau erreicht wird, hat mittlerweile viele Menschen erreicht, und man sucht nach Erklärungen, Entschuldigungen oder nach Auswegen. Dazu will ich hier gar nichts beitragen, sondern nur drei Anekdoten berichten, die für meinen persönlichen Blick auf die Misere prägend waren.

1. Vor 50 Jahren war ich Grundschüler und lernte mit Plastikplättchen von Klett Grundlagen der Mengenlehre: Es gab kleine, mittlere und große Kreise, Quadrate und Dreiecke in verschiedenen Farben, und man hat in Einzelarbeit beispielsweise die Vereinigungsmenge der roten Figuren oder der kleinen Kreise gelegt. Vor wenigen Jahren habe ich eine analoge Stunde im Schulpraktikum gesehen, und diese hat den Fortschritt der Didaktik gezeigt: Die Komplexität wurde reduziert durch die Beschränkung auf zwei Merkmale, jeweils mit nur zwei Merkmalsausprägungen. Zudem wurden die abstrakten Merkmale durch lebensnahe ersetzt. Die Aufgaben wurden nicht in Einzelarbeit erledigt, sondern kooperativ – und auch nicht im Klassenraum, sondern man ist herausgegangen und hat die Mengen dort enaktiv gebildet. Vor allem aber wurde das Thema nicht in einer Grundschulklasse behandelt, sondern in der 12. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums.
2. Nach dem Referendariat habe ich zunächst kurz in der Umweltmesstechnik gearbeitet und war beeindruckt von der Flexibilität, mit der die Mitarbeiter dort algebraische Gleichungen zum Modellieren und Analysieren von Systemen verwendet haben. Als ich dann Lehrer war, habe ich Ideen entwickelt, wie man auch Schülern sinnhaft diese algebraische Flexibilität nahebringen kann. Bei einem meiner ersten didaktischen Vorträge habe ich dies vorgestellt und wurde am Ende von einem bekannten Didaktiker zurechtgestutzt: Was immer in einem Labor passiere, dürfe keinen Einfluss auf den Mathematikunterricht haben.
Naiv wie ich war, dachte ich, dass in der Didaktik das wichtig sei, was meine Tätigkeit als Lehrer dominiert hat.
3. Nach einigen Jahren als Lehrer wechselte ich auf eine Didaktik-Professur. Naiv wie ich war, dachte ich, dass in der Didaktik das wichtig sei, was meine Tätigkeit als Lehrer dominiert hat. Also habe ich einer Mathematikzeitschrift, die sich an Lehrkräfte wendete, vorgeschlagen, ein Themenheft zum Erklären zu machen. Das Echo der etablierten Didaktiker war aber eindeutig: So etwas geht im Zeitalter des Konstruktivismus gar nicht. Lehrer sollen nichts erklären, sondern Lernumgebungen schaffen, in denen die Schüler alles selbst entdecken sollen. Dass das nur funktioniert, wenn man das Inhaltsniveau deutlich absenkt, konterte ein Kollege mit dem Konzept der Kompetenzorientierung: Es komme gar nicht darauf an, ein bestimmtes Inhaltsniveau zu erreichen. Immerhin, dieses Ziel wurde erreicht.
Anekdoten haben keine Beweiskraft, sie sind zufällig. Aber ich könnte die Liste noch erweitern, etwa um das quasi-religiöse Bekenntnis zum Konstruktivismus, das im Referendariat eingefordert wurde, oder um die Aussage eines Kollegen, dass wegen der Bildungsstandards die Didaktik nicht mehr über Inhalte nachdenken müsse. Nicht schlecht gestaunt habe ich auch, als mir ein Kollege erklärte, ein mathematischer Satz könne für Lehramtsstudierende richtig, für Diplomstudierende aber falsch sein; schließlich hänge Wahrheit von der sozialen Gruppe ab. Schlechter werdende PISA-Ergebnisse haben viele Ursachen, für die der Bildungsbetrieb selbst nichts kann, aber meine Erfahrungen legen nahe, dass die starken konstruktivistischen Strömungen der letzten Jahrzehnte auch erheblich dazu beigetragen haben.


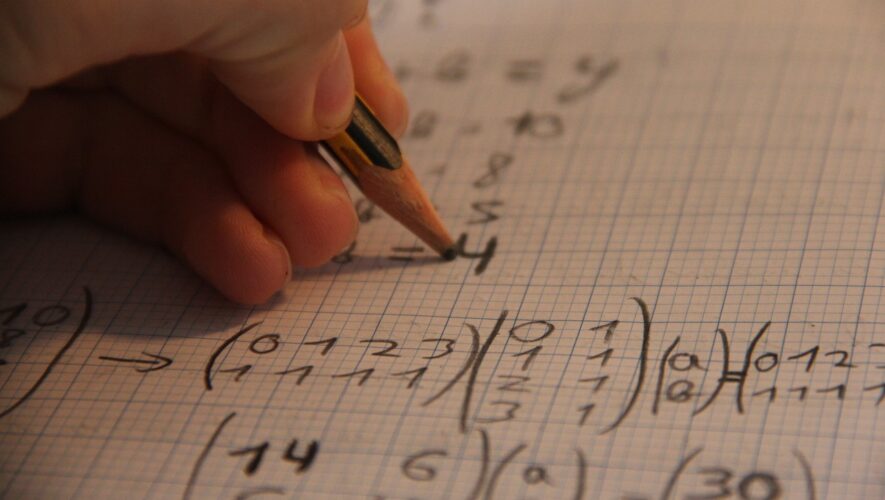




Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben.