Der Philosoph Immanuel Kant hätte vielleicht eine einfache Antwort gegeben. Bereits im 18. Jahrhundert schrieb er: «Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.»[1] Doch was hat das mit Bildungspolitik zu tun?

Zwischen Steuerungseuphorie und Praxisfrust
Seit Jahren wird das Bildungssystem von oben immer stärker durchorganisiert: mehr Kontrolle, mehr Evaluation, mehr Kompetenzraster, mehr Vergleichbarkeit. Alles folgt einer Logik, die auf Effizienz, Output und Steuerbarkeit setzt – als gäbe es einen Bauplan, um bessere Schulen zu schaffen. Dabei übersieht diese Denkweise, dass Pädagogik nicht im Modus technischen Herstellens funktioniert.
Die Praxis zeigt jedoch das Gegenteil: Trotz wohlmeinender Reformabsichten beklagen Lehrerinnen und Lehrer zunehmende Bürokratie, kritisieren realitätsferne Konzepte und leiden unter Zeitmangel für das Wesentliche – das Unterrichten. Was politisch sinnvoll erscheint, scheitert oft an der schulischen Realität. Warum ist das so?

Politische Entscheidungen zeigen oft unmittelbare Folgen, doch die pädagogische Wirklichkeit sieht anders aus. Deshalb sind Verordnungen ohne echtes Verständnis der schulischen Realität bestenfalls Wunschdenken – schlimmstenfalls Ideologie. Die Praxis reagiert darauf mit pragmatischen Notlösungen: Improvisationen, vorschnellen Anpassungen und bürokratischen Auswüchsen. Der Versuch, ideologische Vorgaben umzusetzen, scheitert an der schulischen Realität – die Schule selbst scheitert, weil es dort keinen linearen Zusammenhang zwischen Entscheidung und Wirkung gibt.
Gedanken ohne Inhalt sind leer
Abstrakte bildungspolitische Steuerungsideen ohne Bezug zur pädagogischen Wirklichkeit sind – mit Kant gesprochen – «Gedanken ohne Inhalt». Sie ignorieren, dass pädagogisches Handeln nicht als ein einfacher Steuerungsmechanismus funktioniert. Es vollzieht sich stets zwischen Generationen und zwischen Menschen – und ist daher zwangsläufig von Widersprüchen geprägt. Kant stellte die Frage: «Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?»[2] Und Hannah Arendt schreibt: «In der Erziehung entscheidet sich auch, ob wir unsere Kinder genug lieben, um sie weder aus unserer Welt auszustossen und sich selbst zu überlassen, noch ihnen ihre Chance nehmen, etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu unternehmen.»[3]
Solche Widersprüche prägen den Schulalltag: durchsetzen oder gewähren lassen, festhalten oder öffnen, einfordern oder Widerspruch zulassen, begrenzen oder ermutigen, entscheiden oder beteiligen, schützen oder etwas wagen. Diese Liste liesse sich beliebig erweitern.
Pädagogik lebt vom Ausbalancieren: zwischen Bestehendem und Neuem, Freiheit und Zwang, Individuum und Gemeinschaft – eine Praxis, die Lehrerinnen und Lehrer täglich mit unzähligen Entscheidungen gestalten.
Eine Bildungspolitik, die sich ausschliesslich auf Daten, Modelle oder Ideologien stützt, verkennt das Wesen der Pädagogik. Sie reduziert Bildung auf ein Produkt, das effizient gemanagt werden soll, und übersieht dabei die Widersprüche und das zutiefst Menschliche, das Bildung ausmacht. Pädagogik lebt vom Ausbalancieren: zwischen Bestehendem und Neuem, Freiheit und Zwang, Individuum und Gemeinschaft – eine Praxis, die Lehrerinnen und Lehrer täglich mit unzähligen Entscheidungen gestalten. Nur so kann das fragile Gleichgewicht bewahrt werden, das gewährleistet, dass die nächste Generation weder allein gelassen noch für politische Zukunftsvisionen instrumentalisiert wird.
Wer das vergisst, betreibt keine Bildungspolitik, sondern reine Verwaltung – basierend auf einem technokratischen Verständnis, das in immer unverständlicheren Lehrplänen mündet, inzwischen auch auf der Gymnasialstufe.
Wer das vergisst, betreibt keine Bildungspolitik, sondern reine Verwaltung – basierend auf einem technokratischen Verständnis, das in immer unverständlicheren Lehrplänen mündet, inzwischen auch auf der Gymnasialstufe. Diese Lehrpläne zielen auf messbaren Output in Form vermeintlicher Kompetenzen ab. Selbst wenn die Überprüfung der Grundkompetenzen ernüchternde Ergebnisse zeigt, werden diese häufig relativiert oder ignoriert. Ein Denken, das seine Wirksamkeit nicht hinterfragt, sondern einfach voraussetzt, ist kein Fortschritt – sondern Stillstand mit Statistik.
Mehr Diagnosen führen zu mehr Stellen; Beurteilungen mit Sternchen und Blumen verschleiern die Selektion, welche in einer integrativen Schule höchst Ungleiche miteinander vergleicht; vermeintliche Augenhöhe täuscht über die Asymmetrie der pädagogischen Beziehung hinweg.

In der Praxis führt dies zu unbeabsichtigten Folgen: zur Schwächung der Volksschule, zum schwindenden Vertrauen in das Bildungssystem – und letztlich zum Ausbleiben des Bildungserfolgs.
Anschauungen ohne Begriffe sind blind
Lehrerinnen und Lehrer haben längst erkannt, dass viele Reformen der Komplexität des pädagogischen Alltags nicht gerecht werden. Angesichts dieser Diskrepanz entwickeln sie eigene Strategien, um auf Herausforderungen wie die integrative Schule, die zunehmende Heterogenität, den früheren Schuleintritt, den Fremdsprachenunterricht an der Primarschule oder kompetenzorientierte Beurteilung zu reagieren – Konzepte, auf welche sich keine pädagogische Antwort finden lässt, weil sie einem technokratischen Steuerungsgedanken entspringen.
Deshalb gleichen viele Lösungsansätze in der Praxis einem beruflichen Überlebensmodus: Mehr Diagnosen führen zu mehr Stellen; Beurteilungen mit Sternchen und Blumen verschleiern die Selektion, welche in einer integrativen Schule höchst Ungleiche miteinander vergleicht; vermeintliche Augenhöhe täuscht über die Asymmetrie der pädagogischen Beziehung hinweg, die in Zeiten und ständig hinterfragter Autoritäten zunehmend ihre Selbstverständlichkeit zu verlieren scheint ; selbstorganisiertes Lernen schwächt die Schwächsten – und verstärkt den Zusammenhang zwischen Herkunft und Zukunft, genau das, was man eigentlich vermeiden möchte; altersdurchmischtes Lernen verstärkt die Heterogenität so weit, dass erfolgreiches Unterrichten kaum mehr möglich ist – eine «Lösung», die deshalb kaum als pädagogische gelten kann.
Die aus pädagogischer Sicht theorielosen Gedanken der Bildungspolitik machen die Praxis blind. Wenn die pädagogischen Begründungen und Begriffe fehlen, kann sie ihr eigenes Handeln nicht mehr reflektieren und verliert die Orientierung. Vor dreissig Jahren wies die Praxis noch auf die Theorielosigkeit der Reformen hin – vergeblich. Heute wird sie von ihnen überrollt. Sie reagiert auf Vorgaben, die ihr aufgebürdet werden, und die sie belasten. Der Ruf nach Entlastung wird immer lauter. Pädagogisches Handeln im Entlastungsmodus ist jedoch eine widersprüchliche Idee. Es verlangt eigentlich das Gegenteil: Engagement und Verantwortung, Begeisterung und Zutrauen, Wirksamkeit und Vertrauen.
Zwischen «Gedanken ohne Inhalt» und «Anschauungen ohne Begriffe»
Eine Bildungspolitik, die die Bedeutung pädagogischer Theorie für die Praxis vernachlässigt, läuft ins Leere und lässt die Praxis blind auf die Steuerungsmechanismen reagieren. Obwohl Reformen das Bildungssystem verbessern sollen, führen sie in der Realität häufig zu Überforderungen bei Kindern und Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehrern und letztlich bei einem Bildungssystem, das so seiner Aufgabe nicht mehr gerecht werden kann.
Immanuel Kants Satz – «Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind» – wird zur treffenden Diagnose einer Entwicklung, in der an Schulen weder Theorie noch Praxis ihrem pädagogischen Anspruch gerecht werden. Grund dafür ist die politische Perspektive, die eine Steuerbarkeit der pädagogischen Wirklichkeit voraussetzt. In diesem Zwischenraum zwischen leerer Steuerung und blinder Reaktion geht verloren, was pädagogisches Handeln eigentlich ausmacht.
Wer Bildung primär als Steuerungsaufgabe versteht, unterschätzt die Komplexität und verkennt den Kern des Pädagogischen – was zu «Gedanken ohne Inhalt» führt.
Der Politik das Steuerbare – der Schule das Pädagogische
Wenn die Gesellschaft heute besorgt auf die Schule blickt, die Politik ungenügende Leistungen beklagt und die Praxis an den Anforderungen scheitert, wird spätestens dann deutlich, dass wir nicht länger wegsehen dürfen, sondern uns tatsächlich um die Schule kümmern müssen.
Doch die beklagten Missstände dürfen nicht durch noch mehr Steuerung behoben werden – ein Ansatz, der leider weiterhin zu beobachten ist. Steuerungswissen darf nicht mit pädagogischer Theorie und Praxis gleichgesetzt werden, denn Schule und Politik sprechen unterschiedliche Sprachen. Wer Bildung primär als Steuerungsaufgabe versteht, unterschätzt die Komplexität und verkennt den Kern des Pädagogischen – was zu «Gedanken ohne Inhalt» führt. Einer Praxis, die auf Steuerung statt auf ihren pädagogischen Auftrag vertraut, fehlen die nötigen Begriffe, wodurch sie in dieser Hinsicht blind wird.
Es geht nicht darum, den politischen Steuerungsauftrag gegen den pädagogischen Auftrag der Schule auszuspielen, sondern darum, das Steuerbare zu steuern und der Schule zugleich zu vertrauen, dass sie ihrer anspruchsvollen pädagogischen Aufgabe trotz aller Komplexität und Widersprüchlichkeit gerecht wird.
Bildungspolitik muss nicht Schulen managen, Outputs und Indikatoren generieren oder ihnen immer mehr gesellschaftliche Aufgaben und fragwürdige Zukunftsvisionen aufbürden. Stattdessen sollte sie einen Rahmen schaffen, der pädagogisches Handeln ermöglicht und den Schulen so erlaubt, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen.
Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, wie sehr eine Steuerung, die über pädagogische Tatsachen hinwegsieht und der Schule eine Sprache aufzwingt, die sie nicht versteht, letztere irritiert hat. Das zeigt sich darin, dass das, was beabsichtigt war, sich ins Gegenteil verkehrte: Die integrative Schule produziert immer mehr Diagnosen, das Frühfranzösisch hat dem Ansehen dieser wunderschönen Landessprache enorm geschadet, der Lehrplan 21 hat den Lernerfolg gemindert und die Digitalisierung verdrängt das pädagogische Wirken.
Bildungspolitik soll steuern, was steuerbar ist. Versucht die Politik jedoch, das pädagogische Handeln mit ihrer eigenen Sprache zu steuern und zu kontrollieren, wird sie unverständlich. Denn nicht alles ist messbar, planbar oder kontrollierbar. So verliert sie den Zugang zu dem, was Schule wirklich ausmacht – die Schule wiederum verliert daraufhin ihre eigene Sprache und reagiert teilweise rätselhaft und blind.
Plädoyer für die Differenz
Die Sprache der Politik ist nicht die Sprache der Pädagogik. Deshalb bleiben politische Gedanken in dieser Hinsicht leer. Übernehmen Schulen die Sprache der Politik und damit deren aus pädagogischer Sicht oft unverständliche Aufträge, werden sie gegenüber der Realität – der täglichen Anschauung – blind, weil ihnen die eigenen Begriffe fehlen.
Die Politik muss sich darauf beschränken, die Rahmenbedingungen für Bildung – Gesetze, Finanzierung und bildungspolitische Zielvorgaben – innerhalb ihrer eigenen Logik von Macht und Steuerung zu setzen. Das Bildungssystem hingegen muss seine eigene Sprache zurückgewinnen, die einer ganz anderen Logik folgt.
Nur wenn beide Systeme ihre je eigene Sprache bewahren und die Differenz anerkennen, kann Bildung zugleich politisch verantwortet und pädagogisch sinnvoll gestaltet werden.
[1] Kant, I. (2009). Kritik der reinen Vernunft (I. Heidemann, Hrsg.). (S. 120). Reclam.
[2] Kant, I. (1977). Schriften zur Anthropologie (W. Weischedel, Hrsg.). (S. 711). Suhrkamp.
[3] Arendt, H. (2012). Die Krise in der Erziehung. In Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Übungen im politischen Denken I. (S. 276). Piper.


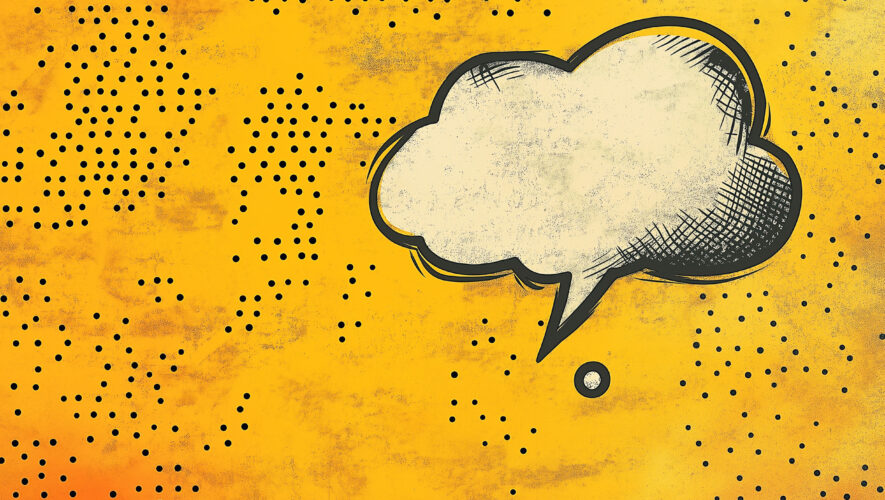



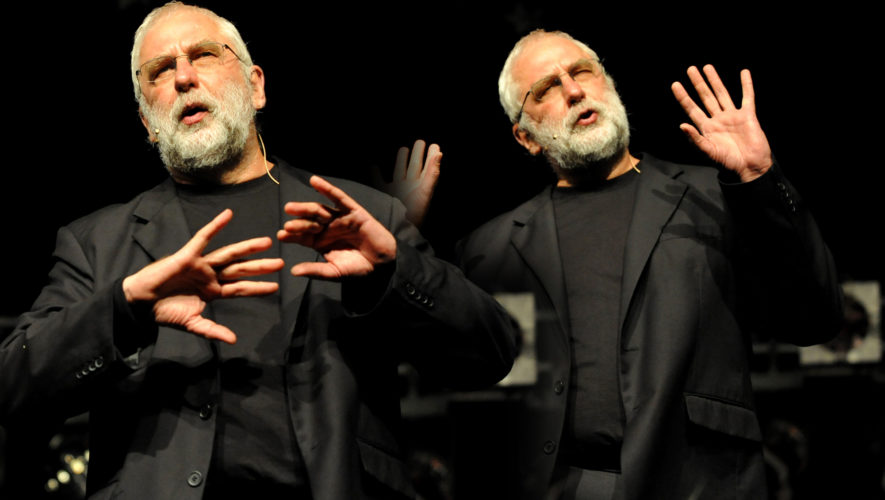
Die zwei grossen Probleme der Bildung sind einerseits der ausufernde Narzissmus in der Bildungspolitik, verbunden mit einem komplett krankhaften Machbarkeitswahn und andererseits der Hang zur Leistungsverweigerung und Bequemlichkeit, hofiert von KI-gestützter Technik und blind agierenden Chancengleichheits-Schwurblern.