«Levana oder Erziehlehre» erschien erstmals 1807 und zählte zu dieser Zeit mit einer Auflage von 2500 Exemplaren zu den beliebtesten Werken Jean Pauls. Gegenüber dem Braunschweiger Buchhändler Friedrich Vieweg pries Jean Paul als mittlerweile dreifacher Vater sein pädagogisches Werk folgendermassen: «Das Werk selber ist für die höhere (elegante) Welt und für die Mütter didaktisch geschrieben – geht von dem Allgemeinsten, dem Geiste der Zeit, der Bildung zur Religion (…) bis zu den bestimmtesten Regeln herab, über Spiele, Freuden, Strafen (…) der Kinder – Von der Ausbildung des Menschen bis zu einem Briefe über Bildung der Fürsten, der Weiber (…) und bis zur physischen Erziehung – Es ist wie meine Aesthetik eine Frucht oder Blüte langer Sammlungen und Jahre und Erfahrungen. Nur zuweilen wird der didaktische Ton durch den Nachschlag eines komischen unterbrochen oder geschlossen.»

Die 2019 verstorbene Schriftstellerin Brigitte Kronauer empfiehlt in ihrem Portrait «Kosmonaut mit Winkelsinn» (NZZ vom 23.3.2013) aus Anlass des 250. Geburtstages von Jean Paul Friedrich Richter das 1818 verfasste autofiktionale Fragment «Selberlebensbeschreibung» als Einstieg in das Werk eines Autors zu nehmen, das ebenso populär wie zugleich schwer verständlich sei und dessen Urheber sich um 1800 wie kein anderer «mit solcher Konsequenz ausschliesslich als Schriftsteller verstand», wie es der Germanist Helmut Pfotenhauer in seiner Jean Paul – Biographie «Das Leben als Schreiben» (München 2013) betont, denn schon mit 18 Jahren brach Jean Paul sein Theologiestudium ab und beschloss Berufsschriftsteller zu werden! Am Ende seines von grosser ökonomischer Not und ebensolchen literarischen Erfolgen geprägten Arbeitslebens hinterliess der autodidaktische Universalgelehrte Jean Paul eine vieltausendseitige Zettelkastensammlung von Exzerpten aus Geschichte, Meteorologie, Botanik, Astronomie, Physik und Chemie sowie eine Vielzahl literarischer Prosa-Werke in Form von 11’000 Druckseiten, 40’000 Seiten in Handschrift und einer 4000 Seiten umfassenden Briefsammlung.
«Selberlebensbeschreibung»
«Geneigteste Freunde und Freundinnen!»
«Verehrteste Herren und Frauen!»
Mit diesen Worten richtet sich der selbsternannte «Professor der Selbergeschichte» an sein Publikum und es ist kein Zufall, dass neben den Männern auch die Frauen explizit in den ersten beiden Vorlesungen angesprochen werden, waren sie doch die wichtigste Gruppe seines Lesepublikums. Er schildert den Tag seiner Geburt gleich zu Beginn mit folgenden Worten: «Es war im Jahre 1763, wo der Hubertsburger Friede zur Welt kam und gegenwärtiger Professor der Geschichte von sich; – und zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehrere Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März: – und zwar an dem Monattage, wo, falls Blüten auf seine Wiege zu streuen waren, gerade dazu das Scharbock- oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten, desgleichen der Ackerehrenpreis oder Hühnerbissdarm, nämlich am 21sten März; – und zwar in der frühesten frischesten Tageszeit, nämlich am Morgen um 1 ½ Uhr; was aber alles krönt, war, dass der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes war.» Wann hat jemals ein deutscher Schriftsteller mit einer solch sorgfältigen und kundigen Naturbeobachtung seine Geburt in den Kreislauf der Natur und zugleich in einen geschichtlichen Kontext eingebettet!
Bewunderer Rousseaus
Der junge Johann Paul Friedrich – die Umformulierung ins französische Jean ab dem Jahre 1792 hatte mit seiner Bewunderung für Jean-Jacques Rousseau zu tun – war an sich ein wissensdurstiges, neugieriges Kind: «Alles Lernen war mir Leben, und ich hätte mit Freuden, wie ein Prinz, von einem Halbdutzend Lehrern auf einmal mich unterrichten lassen, aber ich hatte kaum einen rechten.» Der Vater, ein verarmender protestantischer Landpfarrer, Lehrer und Organist, nahm nach einem Zwischenfall seine beiden Söhne aus der Dorfschule von Joditz und unterrichtete sie selbst. «Vier Stunden vor- und drei nachmittags gab unser Vater uns Unterricht, welcher darin bestand, dass er uns bloss auswendig lernen liess, Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter und Langens Grammatik.» Es war ein Lernen ohne zu verstehen. Seltsamerweise unterrichtete der klavierfertige Vater seine Söhne nicht einmal in Musik! Und auch Geschichte, Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Arithmetik, Astronomie und Orthographie kamen im väterlichen Privatunterricht bis in sein zwölftes Lebensjahr nicht vor. Bei fehlerhaftem Lernen oder Lernunwilligkeit wurde sein Bruder Heinrich, der sich 1789 aus Verzweiflung wegen der prekären ökonomischen Situation der Familie das Leben nahm, vom Vater oft geschlagen. Dass der «Allherrscher Vater» Johann Paul verschonte, lag daran, dass dieser stets darum bemüht war, «das Seinige immer zu wissen».
Entscheidend für seine persönliche Entwicklung war die Entstehung eines philosophischen Zugangs zur Welt, eine Art «Weltweisheit».
Im Pfarrhof von Joditz lebten die Brüder eingeschlossen und abgesondert von der Dorfjugend. Zum Glück kamen immer wieder der Frühling und der Sommer: «Da werden wir armen, vom ganzen Winter und Kerkermeister in den Pfarrhof eingeschlossnen Kinder durch den vom Himmel gesandten Engel der Jahrzeit befreiet und hinausgelassen in die freien Felder und Wiesen und Gärten.» Ab dem dreizehnten Lebensjahr ging Johann Paul dann in Schwarzenbach in den geregelten Unterricht einer Dorfschule, die er folgendermassen beschreibt: «Die Schulstube oder vielmehr die Schularche fasste Abc-Schützen, Buchstabierer, Lateiner, grosse und kleine Mädchen – welche, wie an einem Treppengerüste eines Glashauses oder in einem alten römischen Theater, vom Boden bis an die Wand hinauf sassen – und Rückkehr und Kantor samt allem dazugehörigen Schreien, Summen, Lesen und Prügeln in sich.»

Jean Paul gehörte in dieser Gesamtschule zur Spezialgruppe der Lateiner, und neben dem Unterricht in der öffentlichen Schule genoss er auch noch Privatunterricht bei Kaplan Völkel, der ihn in Philosophie und Geographie unterrichtete und ihm sogar noch Klavierstunden gab. Entscheidend für seine persönliche Entwicklung war die Entstehung eines philosophischen Zugangs zur Welt, eine Art «Weltweisheit». Ein Wort, das ihm wie eine Himmelspforte Einblick verschaffte in «lange, lange Freudengärten», und die zu einer Art von individuellem Erweckungserlebnis führte, an das er sich genau erinnerte: «Nie vergess ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der Geburt meines Selbstbewusstseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiss. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustüre und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht: ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mir fuhr und seitdem leuchtend stehenblieb: da hatte mein Ich zum ersten Mal sich selber gesehen und auf ewig.»
Der kleine Johann Paul übernahm jedes Mal ohne Widerrede das Trägeramt, obwohl der Preis schrecklich war.
Und dieses Ich war von schier unerschöpflicher Phantasie erfüllt, die ihm leider im Umgang mit der Angst vor Gespenstern arg in die Quere kam: «Manches Kind voll Körperfurcht zeigt gleichwohl Geistermut aber bloss aus Mangel an Phantasie, ein anderes hingegen – wie ich – bebt vor der unsichtbaren Welt, weil die Phantasie sie sichtbar macht». So wie Goethe davon erzählte, dass er sich als Student in Strassburg im Kreise seiner Kommilitonen die Gespensterfurcht systematisch auszutreiben versuchte, so wurde der kleine Jean Paul von seinem Vater brutal mit seiner «Geisterscheu» konfrontiert, indem er immer wieder gezwungen wurde, bei Beerdigungen die Bibel seines Vaters durch die leere Kirche in die Sakristei zu tragen, wenn «der Leichenzug mit Pfarrer, Schulmeister und Kindern und Kreuz und mir von der Pfarrwohnung an bei der Kirche vorüber zu dem Kirchhof neben dem Dorfe sich mit seinem Singgeschrei hinausbewegte.» Und der kleine Johann Paul übernahm jedes Mal ohne Widerrede das Trägeramt, obwohl der Preis schrecklich war: «aber wer von uns schildert sich die bebenden, grausenden Fluchtsprünge vor der nachstürzenden Geisterwelt auf dem Nacken und das grausige Herausschiessen aus dem Kirchentore?»
Phantasie als Plage und Geschenk
Die Phantasie war aber nicht nur eine Plage, sondern auch ein Geschenk, das ihn früh zur Dichtkunst führte und das ihn mit Mut erfüllte, sobald er ins Reden und Schreiben kam. Dabei verstieg er sich in seinem Leben in den Kontakten mit anderen Menschen – gebildete Frauen, Adlige, Dorfleute – zu skurillen Selbstinszenierungen, die typisch sind für diesen so angepassten und doch wieder so rebellischen Kauz, dass er sogar selbst ins Schmunzeln kam: «Nahm er nicht an einem Nachmittage, wo sein Vater nicht zu Hause war, ein Gesangbuch und ging damit zu einer steinalten Frau, die jahrelang gichtbrüchig darniederlag, und stellte sich vor ihr Bette, als sei er ein erwachsener Pfarrer und mache einen Krankenbesuch, und hob an, ihr aus den Liedern Sachdienliches vorzulesen? Aber er wurde bald unterbrochen von dem Weinen und Schluchzen, mit welchem nicht etwan die alte Frau das Gesangbuch anhörte – diese liess sich kalt auf nichts ein-, sondern er selber.»
Auch wenn er davon spricht, dass «die reine Liebe nur geben will», so hat man eher den Eindruck, dass es ihm vor allem um seine eigenen Gefühle geht, für die er kaum nach aussen einstehen will.
Die Freude an der verspielten Selbstinszenierung zeigte sich auch in seiner ersten Liebe: «Es war ein blauaugiges Bauernmädchen seines Alters, von schlanker Gestalt, eirunden Gesicht mit einigen Blatternarben, aber mit tausend Zügen, welche eben wie Zauberkreise das Herz gefangennehmen.» Und auch wenn er davon spricht, dass «die reine Liebe nur geben will», so hat man eher den Eindruck, dass es ihm vor allem um seine eigenen Gefühle geht, für die er kaum nach aussen einstehen will. Da ist viel unaussprechliche «Süssigkeit», ein «Herzens-Auseinanderwallen, ein himmlisches Vernichten und Auflösen des ganzen Menschen», aber wenig Bezogenheit auf ein geliebtes Gegenüber, so dass er seine erste Liebe mit folgenden lakonischen Worten bilanziert: «Dennoch blieb ihm mehr das Gefühl als ihr Gesicht, von welchem er nichts behalten als die Narben.»
Und er bezeichnet es als eine Eigenart von ihm, «dass er jedes weibliche Gesicht, dessen sogenannte Hässlichkeit nur keine moralische sein darf, ohne alle kosmetische Kunstgriffe, ohne Schmink- und Salbbüchse, ohne März- und Seifenwasser und ohne Nachtlarven im höchsten Grade reizend und bezaubernd zu machen vermag, wenn man ihm dazu nur einige Abende, Gesänge, Herzworte einräumt, dass wohl niemand schöner erscheint als eben die gedachte Person – aber natürlich nur in seinen eignen Augen; denn wer spricht von andern?» Auch aus seiner Erinnerung an den Besuch des Höferjahrmarktes mit seiner Mutter wird deutlich, wie sehr er es liebte, sich in sicherer Distanz in alle Frauen schwärmerisch zu verlieben: «und er verliebte sich unten vorbeimarschierend überall hinauf», wo die «vornehmsten und schönsten Damen» aus den Fenstern schauten. Seine Devise dem weiblichen Geschlecht gegenüber brachte er gegen Ende seines autobiographischen Fragments folgendermassen auf den Punkt: «Ferne schadet der rechten Liebe weniger als Nähe.»
Jean Pauls «erotische Akademie»
Ganz ähnlich taucht die Reinheit der ersten Liebe im 1790 entstandenen «Leben des vergnügten Schulmeisterlein Wutz in Auenthal» auf. Da heisst es nicht etwa, dass sich das Schulmeisterlein verliebt habe, sondern «er wurde verliebt». Er erliegt jedem weiblichen Begehren und er ist ihm auf passive Weise ausgeliefert: «Denn einem Schnupftuch in einer weiblichen Hand erlag er stets auf der Stelle ohne weitere Gegenwehr, wie der Löwe dem gedrehten Wagenrade und der Elefant der Maus.»
Kurze Zeit später benennt er dasselbe Beziehungsmuster auf noch zugespitztere Weise folgendermassen: «Ueberhaupt hab ich bisher mir unnütze Mühe gegeben, es zu verstecken, dass er in alles sich verliebte, was wie eine Frau aussah;» Wenn der Erzähler von den auf Distanz verehrten Frauen zu seiner Ehefrau Justine wechselt, spricht er diese als «Mutter» an, und er umschreibt die Vorteile der ehelichen Beziehung folgendermassen: «Er prahlte vor niemand als vor seiner Frau; und ich schätze den Vorteil so hoch, als er wert ist, den die Ehe hat, dass der Ehemann durch sie noch ein zweites Ich bekommt, vor welchem er sich ohne Bedenken recht herzlich loben kann.» So schwach ist der Mann, der sich in der Ehe als der Starke, Ueberlegene inszeniert, dass er noch ein zweites Ich benötigt, das ihm die Frau auf mütterliche Weise von aussen zuführen soll, wobei es zu dieser patriarchalen Selbstverständlichkeit zu bedenken gilt, dass wir uns hier am Anfang des 19.Jahrhunderts befinden.
Nicht lieben, sondern die Liebe nur schildern
Viermal verlobte sich Jean Paul und er erweiterte seine «erotische Akademie» zu einem Kreis gebildeter und hochgestellter Frauen aus ganz Deutschland. Zu den Verehrerinnen gehörten etwa Charlotte von Kalb, Rahel Levin, spätere Varnhagen, Karoline von Feuchtersleben oder sogar die preussische Königin Louise. Im Oktober 1799 versprachen sich Karoline und Jean Paul die Ehe, die dann einige Monate später nicht wegen der empörten adligen Familie ob dieser unstandesgemässen Verbindung wieder aufgelöst wurde, sondern wegen Jean Paul, der die Liaison unvermittelt mit folgenden Worten aufkündigte: «Nicht ihr Stand, sondern moralische Unähnlichkeiten scheiden uns». Johann Gottfried Herder meinte in einem Trostbrief an Karoline treffend, Jean Pauls Beruf sei nicht zu lieben, sondern die Liebe zu schildern und so «aller Frauen Mann zu sein.» Der Dichter hatte eben Karoline und ihre höfische Umgebung vor allem als Material für sein literarisches Schaffen benützt.

Im Sommer 1800 lernte er dann in Berlin seine spätere Ehefrau Karoline Mayer kennen, die ihn verehrte und die als gebildete Frau trotzdem bereit war, «zu ihm aufzublicken und ihm ein häusliches Leben zu garantieren», wie es Pfotenhauer in seiner Biographie formulierte. In einem Brief an Ludwig Gleim umschrieb Jean Paul, was er von den Frauen wollte: «Ausser der Ehe verstrikt man sich durch die Phantasie in so viele Verbindungen mit Weibern, die immer eine oder gar zwei Seelen auf einmal beklemmen und unglücklich machen. Mein Herz wil die häusliche Stille meiner Eltern, die nur die Ehe giebt. Es will keine Heroine – denn ich bin kein Heros -, sondern nur ein liebendes sorgendes Mägden: denn ich kenne jetzt die Dornen an jenen Pracht- und Fackeldiesteln, die man genialische Weiber nent.» Am 22.November 1800 wird die Verlobung angezeigt und am 27.Mai 1801 heiraten Jean Paul und Karoline Mayer. 1802 wird die Tochter Emma geboren, 1803 der Sohn Max und 1804, nach dem Umzug der Familie nach Bayreuth, kommt Odilie als drittes Kind zur Welt.
Toleranz und möglichst grosse Zurückhaltung mit Autorität und Strenge
Auch wenn Jean Paul gleich wie sein Vorbild Jean Jacques Rousseau im Kind den reinen, unschuldigen, idealen Menschen sah, den erst der Prozess der Zivilisation verderbe, so kombinierte er in der Erziehung seiner eigenen Kinder wie auch in seiner Pädagogik als Hauslehrer immer Toleranz und möglichst grosse pädagogische Zurückhaltung mit Autorität und Strenge. Ueber Erziehungsfragen kam es zwischen den Eltern immer wieder zu schweren Konflikten, die die ersehnte häusliche Stille empfindlich störten. Seine Kinder durften frei reden, auch Spass war erlaubt. Trotzdem war er auch wieder streng, tadelte seine Mädchen und den Knaben züchtigte er auch körperlich. Waren die Kinder krank, so wollte sie der Vater selbst kurieren und dabei mutete er ihnen auch viel Schmerz zum Zwecke der Abhärtung zu, während die Mutter eher auf den Rat der Aerzte hörte. Der Vater liess die Kinder barfuss gehen und sie durften auch auf den Boden spucken. In einem Bericht von 1809, so berichtet der Biograph Pfotenhauer, hiess es deshalb, «er erziehe seine Kinder wie das Vieh».
Und nach den Vormittagsstunden folgte er den Kindern nach Hause, «da er sich’s ausgebeten hatte, reihum bei den einzelnen Familien mittags zu speisen.»
Seit 1805 führte er ein Tagebuch über seine Kinder, das er zusammen mit seiner jahrelangen Lehrtätigkeit in Schwarzenbach und Hof für seine Erziehlehre «Levana» direkt verwendete. Ab 1790 war er für 4 Jahre als Lehrer in Schwarzenbach für 6 Knaben und 1 Mädchen verantwortlich. Er unterrichtete diese Kinder, die zwischen 7 und 15 Jahre alt waren, 30 Wochenstunden in 15 (!) verschiedenen Fächern: Biblische Geschichte, Moral, Logik, Latein, Französisch, Deutsch, Mythologie, Geschichte, Geographie, Physik, Naturgeschichte, Anatomie, Astronomie, Rechnen und Kurztexte verfassen. Und dies alles in räumlich prekären Verhältnissen, denn er klagte gemäss Karl Lange in einem Brief, «dass unter ihm gespult, neben ihm gezwirnt und draussen gehämmert werde.» Und nach den Vormittagsstunden folgte er den Kindern nach Hause, «da er sich’s ausgebeten hatte, reihum bei den einzelnen Familien mittags zu speisen.»
Eine seiner didaktischen Eigenheiten war es, die Kinder zu Verknüpfungen und unterhaltsamen Aehnlichkeiten verschiedener Wissensgebiete anzuregen. Er verleitete sie zu Wortspielen und Witzen, um nach oberflächlichen Analogien zu suchen. Zucht und Ordnung waren aber in den Schulregeln ebenfalls wichtig. Nach 4 Jahren Gesamtschule mit verschiedenen Niveaus – binnendifferenzierter integrativer Unterricht heisst das heute! – wurde diese kleine Privatschule aufgelöst und Jean Paul ging zu seiner seit 1779 verwitweten Mutter nach Hof zurück, wo er auch wieder Kinder im kleinen Kreis unterrichtete.
«Ueberall das Ganze meinend»
In der Vorrede zur ersten Auflage von «Levana» 1806 formuliert er das Hauptanliegen seiner Pädagogik folgendermassen: «Allein obgleich der Geist der Erziehung – überall das Ganze meinend – nichts ist als das Bestreben, den Idealmenschen, der in jedem Kinde umhüllt liegt, frei zu machen durch einen Freigewordenen». Die «rechte Erziehung» besteht für ihn in der «entfaltenden, durch welche die lange zweite, die heilende, oder die Gegenerziehung zu ersparen wäre.» Dies führt ihn zu folgender Maxime: «Jeder neue Erzieher wirkt weniger ein als der vorige, bis zuletzt, wenn man das ganze Leben für eine Erziehanstalt nimmt, ein Weltumsegler von allen Völkern zusammengenommen nicht so viele Bildung bekommt als von seiner Amme.» Dieser Rousseauschen Idealkonzeption kann Jean Paul trotzdem nicht ganz nachkommen, denn die Erziehung in der frühen Kindheit in den ersten 3 bis 5 Lebensjahren ist ihm sehr wichtig, entscheide sich doch in dieser Phase die ganze Entwicklung des Menschen.

Es ist erstaunlich, mit welcher Radikalität Jean Paul an dieser Stelle den Staat und die Gesellschaft kritisiert: «Leider raubt entweder der Staat oder die Wissenschaft dem Vater die Kinder über die Hälfte; die Erziehung der meisten ist nur ein System von Regeln, sich das Kind ein paar Schreibtische weit vom Leibe zu halten und es mehr für ihre Ruhe als für seine Kraft zu formen, höchstens wöchentlich einige Male ihm unter dem Sturmwinde des Zornes so viel Mehl der Lehren zuzumessen, als er verstäuben kann.» Es wird an dieser Stelle deutlich, wie willkürlich und zwanghaft die Konstruktion des reinen, guten Menschen ist, der lediglich durch den Zivilisationsprozess in seinem späteren Leben verdorben werde.
Weil ihm grundsätzlich die Widersprüchlichkeit des Menschen zu widersprüchlich war, rettete er sich in eine Idealkonstruktion, die schlussendlich in einer vagen und pauschalisierenden Kritik der städtischen Kultur und des zeitlichen Verlaufs aller Dinge endete: «Aber ich möchte die Geschäftsmänner fragen, welche Bildung der Seelen mehr auf der Stelle erfreuend belohne, als die der unschuldigen, die dem Rosenholze ähnlich sind, das Blumenduft austreuet, wenn man es formt und zimmert? Oder was jetzt der fallenden Welt – unter so vielen Ruinen des Edelsten und Altertums – noch übrig bleibe als Kinder, die Reinen, noch von keiner Zeit und Stadt Verfälschten. Nur sie können in einem höheren Sinn, als wozu man sonst Kinder gebrauchte, in dem Zauberkrystall die Zukunft und Wahrheit schauen und noch mit verbundenen Augen aus dem Glücksrade das reichere Schicksal ziehen.»
Bei Jean Paul ist die Dringlichkeit der Gesellschaftskritik im Verbund mit pädagogischen Visionen um einiges heftiger und man spürt die sich anbahnende Revolutionierung der Gesellschaft durch die Industrielle Revolution in der verwendeten Maschinenmetaphorik.
Jean Paul steht mit seiner pädagogischen Kritik des Drills und des Gehorsams in einer langen Tradition, wie sie etwa schon der ihm bekannte französische Humanist Michel de Montaigne in seinem berühmten Essay «Ueber die Schulmeisterei» Ende des 16. Jahrhunderts folgendermassen vorgetragen hatte: «In Wahrheit zielen Sorge und Aufwand unserer Väter auf weiter nichts ab, als uns den Kopf mit Wissen anzufüllen; von Urteil und Charakter ist nicht viel die Rede (…) Wir mühen uns nur, das Gedächtnis vollzupfropfen, und lassen Verstand und Gewissen leer.» Doch bei Jean Paul ist die Dringlichkeit der Gesellschaftskritik im Verbund mit pädagogischen Visionen um einiges heftiger und man spürt die sich anbahnende Revolutionierung der Gesellschaft durch die Industrielle Revolution in der verwendeten Maschinenmetaphorik. So etwa in den «Selberlebensbeschreibungen», wo sich der Erzähler gegen Ende der Autobiographie richtig in Rage redet: «Aber so sind die Menschen durch alle Aemter hinauf; sie haben keine Lust, knechtische Maschinen zu freien Geistern zu machen und dadurch ihre Schöpf-, Herrsch- und Schaffkraft zu zeigen, sondern sie glauben diese umgekehrt zu erweisen, wenn sie an ihre nächste oder Obermaschine aus Geist wieder eine Mittelmaschine und an die Zwischenmaschinen endlich die letzte anzuschienen und einzuhäkeln vermögen, so dass zuletzt eine Mutter-Marionette erscheint, welche eine Marionettentochter führt, die wieder ihrerseits imstande ist, ein Händchen in die Höhe zu heben. Gott, der Reinfreie, will nur Freie erziehen; der Teufel, der Reinunfreie, will nur seinesgleichen.»

Sein Hang zur ernst gemeinten Spiritualität ohne viel Respekt vor der kirchlichen Dogmatik liess ihn auch trotz seiner Bewunderung für das höfische Leben den Untertanengeist der feudalen Welt schonungslos kritisieren: « Und doch sag ich: wie glücklicher seid ihr jetzigen Kinder, die ihr aufgerichtet erzogen werdet, zu keinem Niederfallen vor dem Range belehrt und von innen gegen den äusseren Glanz gestärkt!» Für die Stärkung von innen heraus war ihm als Deist Gott «ein ordentliches Lebensbedürfnis» und er war «ein Christ, der zwar von kirchlichen Dingen wenig hält, dafür aber mit einer Wärme und Festigkeit seine religiösen Ueberzeugungen lebt, wie sie in dem dürren Zeitalter der Aufklärung nur sehr wenigen ‘starken Geistern’ eigen war», wie Karl Lange es formuliert, denn «wer keinen Gott im Himmel und keine Hoffnung auf ein Jenseits im Herzen hat, der mag bis zu den höchsten Spitzen menschlicher Weisheit durchgedrungen sein – zum Erziehen taugt er nicht.» 120 Jahre nach Lange betonte auch Roman Bucheli in der NZZ vom 23.März 2013: «Gegen den Tod und gegen die Leere einer drohenden Gottlosigkeit mobilisiert er fortan die Kunst.»
«Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab»
Am eindrücklichsten kommt das in der «Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei» zum Ausdruck, die sich innerhalb des Romans «Siebenkäs» findet. In dem «ersten Blumenstück» taucht dieses bekannte Pamphlet auf, das die atheistische Vorstellung von der Nichtexistenz Gottes als veritablen Albtraum schildert: «Niemand ist im All so sehr allein als ein Gottesleugner – er trauert mit einem verwaisten Herzen, das den grössten Vater verloren, neben dem unermesslichen Leichnam der Natur, den kein Weltgeist regt und zusammenhält, und der im Grabe wächset; und er trauert so lange, bis er sich selber abbröckelt von der Leiche.
Die ganze Welt ruht vor ihm wie die grosse, halb im Sande liegende ägyptische Sphinx aus Stein; und das All ist die kalte eiserne Maske der gestaltlosen Ewigkeit.» Und es erinnert schon fast an die Episode mit dem sowjetischen Kosmonauten Gagarin, der als erster Mensch im Weltraum war und nach seiner Rückkehr auf die Erde gesagt haben soll: «Ich war im Weltraum, aber Gott bin ich nicht begegnet». Jean Paul lässt Christus in seiner Rede sagen: «Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstrassen durch die Wüsten des Himmels; aber es ist kein Gott.»
Schade, dass sich Jean Paul nicht zu einem pantheistischen Verständnis eines Spinoza durchringen konnte, wonach Gott Natur ist.
Die Säkularisierung und die zunehmende Individualisierung enden in dieser Rede von Christus in einer grossen, unaushaltbaren Einsamkeit: «Wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir sind ohne Vater.» Und dieses «starre, stumme Nichts» hat schreckliche Folgen: «Ach wenn jedes Ich sein eigner Vater und Schöpfer ist, warum kann es nicht auch sein eigner Würgeengel sein?» Doch der Albtraum – «mein Gott, warum hast du mich verlassen?» – endet versöhnlich, denn nach dem Erwachen folgt die grosse Erleichterung: «Meine Seele weinte vor Freude, dass sie wieder Gott anbeten konnte – und die Freude und das Weinen und der Glaube an ihn waren das Gebet.»
Schade, dass sich Jean Paul nicht zu einem pantheistischen Verständnis eines Spinoza durchringen konnte, wonach Gott Natur ist, denn gerade Jean Pauls Beziehung zur Natur hätte ihm dieses Verständnis nahebringen können. Stattdessen landet er am Ende dieser Rede in einer Art katholischem Vater-Idyll, das sein ganzes Werk immer wieder kitschig einfärbt: «Und als ich aufstand, glimmte die Sonne tief hinter den vollen purpurnen Kornähren und warf friedlich den Widerschein ihres Abendrotes dem kleinen Monde zu, der ohne eine Aurora im Morgen aufstieg; und zwischen dem Himmel und der Erde streckte eine frohe vergängliche Welt ihre kurzen Flügel aus und lebte, wie ich, vor dem unendlichen Vater; und von der ganzen Natur um mich flossen friedliche Töne aus, wie von fernen Abendglocken.»
ENDE TEIL 1 VON 3
(* Ich beziehe mich im Folgenden auf die von Karl Lange in der «Bibliothek Pädagogischer Klassiker» herausgegebene «Levana», die 1892 in Langensalza in einer zweiten, verbesserten Auflage erschienen ist. Der Text kann aber auch online und kostenlos beim Projekt Gutenberg gelesen werden.)





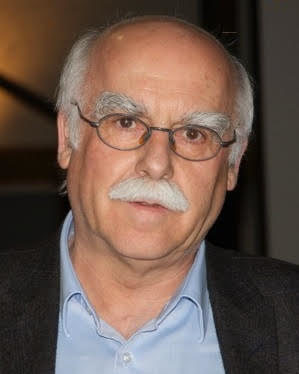

Ist das Zitat
Wenn du in das Gesicht eines Kindes blickst, siehst du in das Antlitz Gottes
Von Paul??
Das Zitat stammt wohl von Dostojewski