Dass sich unsere Sprache dauernd wandelt, ist längst ein Gemeinplatz. Wörter und ihre Bedeutungen haben sich im Verlaufe der Geschichte verändert und verändern sich weiter. Unser Wort “Dirne” etwa meinte in mittelhochdeutscher Zeit, ja noch bis zu Goethe so viel wie “Jungfrau”; und heute, da ist eine Dirne wohl alles andere als eine Jungfrau. Sprachwandel ist ein Vorgang, der sich nicht gezielt lenken lässt, der sich ganz im Gegenteil der bewussten Steuerung durch die Sprecher weitgehend entzieht.

Was aber die sog. gendergerechte Sprache betrifft, hat mit Sprachwandel, obwohl dies von den Befürwortern immer wieder behauptet wird, nichts zu tun, ist vielmehr bewusste Sprachlenkung, ja Sprachdiktat. Es ist eine feministische Minderheit, die der Sprachgemeinschaft das Gendern aufoktroyiert hat, um so eine angebliche Gleichstellung der Geschlechter durch die Sprache zu bewirken. Das aber entspricht nicht der Realität: Die Sprache reagiert erst auf Veränderungen in der uns umgebenden Welt und nicht umgekehrt. Die Unterscheidung von Frau und Fräulein verschwand beispielsweise erst, nachdem auch die unverheiratete Frau gesellschaftlich emanzipiert war.
Es ist eine feministische Minderheit, die der Sprachgemeinschaft das Gendern aufoktroyiert hat, um so eine angebliche Gleichstellung der Geschlechter durch die Sprache zu bewirken.
Die Befürworter des Genderns argumentieren damit, dass im Deutschen grammatisches und natürliches Geschlecht gerne gleichgesetzt würden. Wie kam es aber zu dieser Gleichsetzung, ja Verwechslung von Genus und Sexus? Ein Blick in die deutsche Sprachgeschichte kann uns da Aufschluss geben. Im 17.Jahrhundert, zurzeit der barocken Sprachgesellschaften, übersetzten deutsche Grammatiker, unter ihnen Justus Georg Schottelius, das lateinische Wort “Genus” mit (grammatisches) “Geschlecht” und nannten den Artikel “Geschlechtswort”.
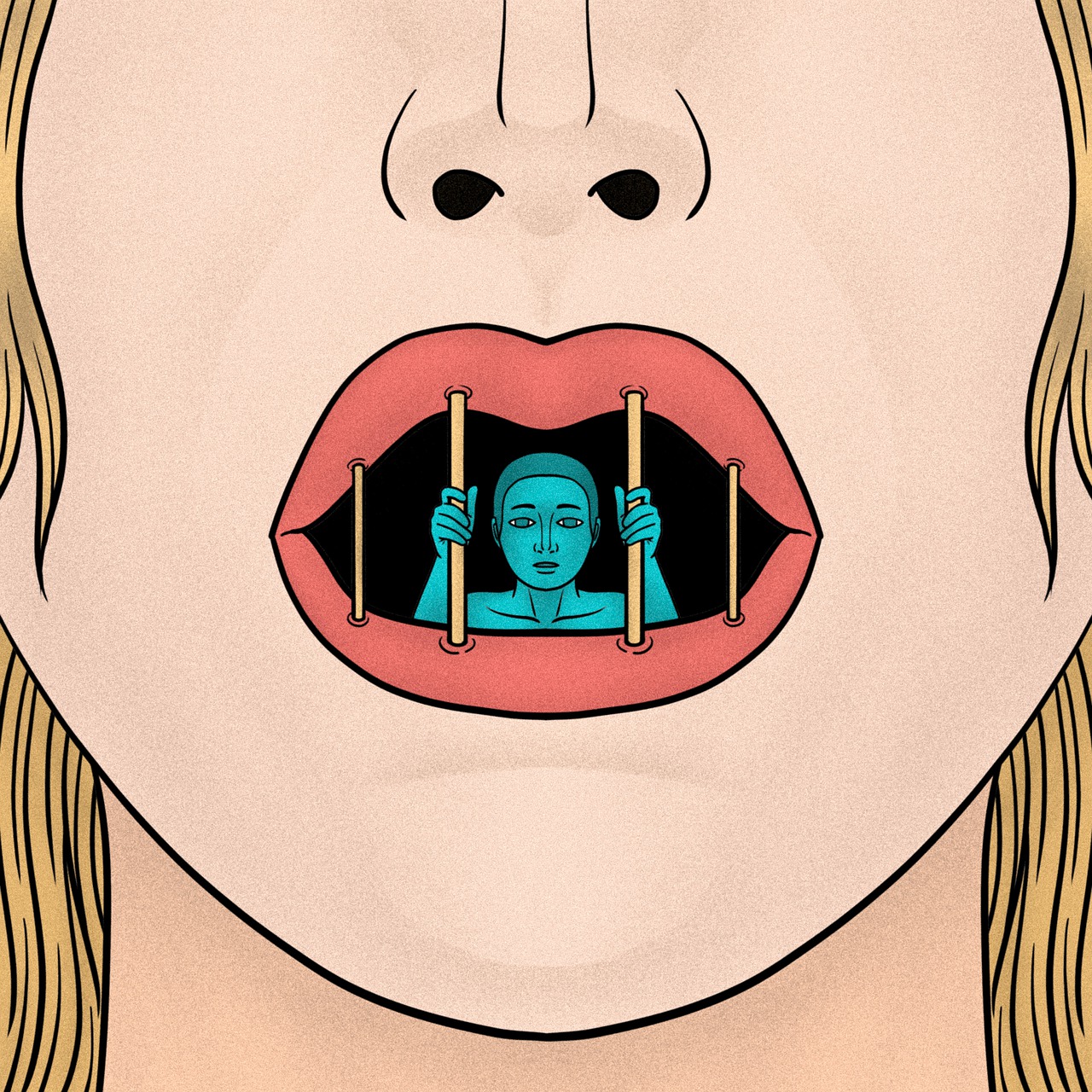
Das öffnete der Verwechslung mit “Sexus” Tür und Tor, und dies umso mehr, als die Genera nun männlich (der), weiblich (die) und sächlich (das) genannt wurden. Johann Christoph Adelung, der bedeutendste deutsche Grammatiker des 18. Jahrhunderts, nannte die Neutra “Wörter ungewissen Geschlechts” und “geschlechtslos”, wobei er das dritte Geschlecht unserer Tage noch nicht im Auge hatte. So wurde die deutsche Grammatik durch eine fragwürdige Übersetzung gleichsam sexualisiert, indem ein Fachbegriff eine alltagssprachliche Zusatzbedeutung erhielt. Die meisten Kinder hören im Sprachunterricht noch heute vom Hauptwort und dessen Geschlecht.
Dabei wissen wir längst, dass grammatisches und natürliches Geschlecht in der deutschen Sprache, aufs Ganze gesehen, wenig miteinander zu tun haben.
Diese Zusatzbedeutung liegt dem vor allem von Feministinnen geschürten Streit über die angebliche Diskriminierung der Frauen bei der Unterlassung weiblicher Wortformen zugrunde. Dabei wissen wir längst, dass grammatisches und natürliches Geschlecht in der deutschen Sprache, aufs Ganze gesehen, wenig miteinander zu tun haben. “Spitzel” als grammatisches Maskulinum bezeichnet ebenso wenig nur Männer, wie etwa “Person” als Femininum nur Frauen meint. Und ein “Lehrerzimmer steht Lehrern wie Lehrerinnen offen; ein Führerschein berechtigt Frauen wie Männer zum Autofahren. So gesehen, entpuppt sich das Genderproblem am Ende als das, was es ist: als Scheinproblem.
Am Ende nur ein Scheinproblem
Trotzdem fordern heute vermeintlich emanzipierte Kreise beinahe stereotyp, es dürften nur noch Wörter verwendet werden, die nicht a priori “männlich” zu verstehen seien, ordnen Arbeitgeber und Behörden an, ihre Mitarbeiter hätten sich im Dienstbetrieb einer gendergerechten Sprache zu bedienen. So kam es schliesslich zu Texten, die uns in dumpf aufgeblähter, mit Gendersternen oder Sprechpausen verunstalteter Sprache begegnen oder die nur noch aus z.T. schwerfälligen neutralen Partizipien (Zu-Fuss-Gehende statt Fussgänger) bestehen.
Doch all diese Vorschläge sind im Grunde keine Lösungen, da sie zum einen in der gesprochenen Sprache nicht funktionieren und zum andern partizipiale Formen sich längst nicht bei allen Nomen herstellen lassen. Die “Abgeordneten” erlauben das beispielsweise nicht. Und das Bedenklichste daran: Die Suche nach einer gendergerechten Sprache hat nicht zur gewünschten Gleichberechtigung der Geschlechter geführt, sondern zu zerstörerischen Eingriffen in die deutsche Sprache.
Prof. Dr. Mario Andreotti, ehem. Gymnasiallehrer und heute Dozent für Neuere deutsche Literatur, ist ein profunder Kenner der schweizerischen Bildungs- und Sprachlandschaft. 2019 veröffentlichte er im Verlag FormatOst dazu das vielbeachtete Buch “Eine Kultur schafft sich ab. Beiträge zu Bildung und Sprache”.


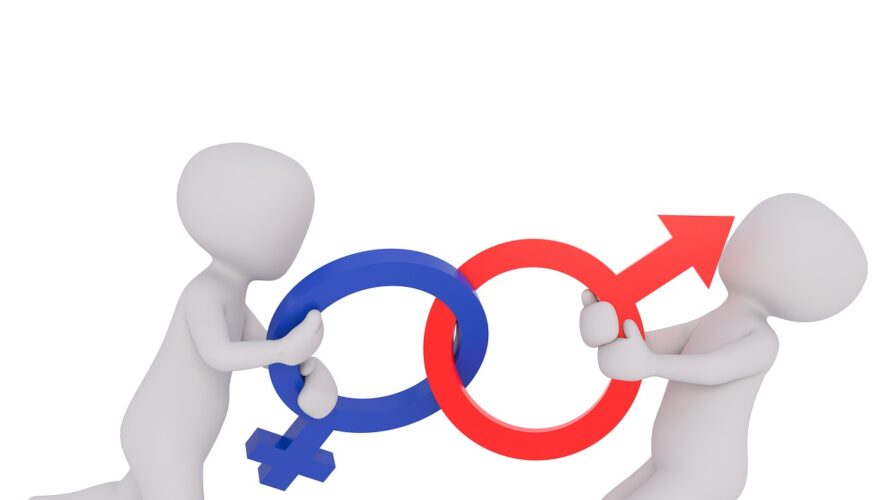




Danke schön, Herr Professor Andreotti für die klare, sachliche Ansage. Bitte mehr in diesem Sinne!