Niemand mit gesundem Menschenverstand wird dem ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte widersprechen wollen, der das solidarische zwischenmenschliche Band über alle Unterschiede hinweg als moralischen Imperativ unterstreicht: Alle Menschen, heisst es am Ende des Artikels, “[…] sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.” Der englische Philosoph, Dichter und Zeitgenosse Shakespeares, John Donne, hat in seinem berühmten Gedicht “Kein Mensch ist eine Insel, ganz für sich allein” (1) die natürliche Verbundenheit von uns Menschen, die als Sehnsucht im Herzen jedes Menschen waltet und für ein gelingendes und glückliches Leben Voraussetzung ist, in ergreifende Worte gefasst.

Trotz des gemeinhin vorhandenen Konsenses wird der Weg, wie die gesellschaftliche Integration aller Menschen vollzogen und wie die Schule dazu beitragen kann und soll, sehr unterschiedlich beurteilt. Um zu verstehen, wie es zu dieser Differenz gekommen ist, muss die geschichtliche Perspektive einbezogen werden.
Kurze historische Rückblende
Angesichts grausamer Nazi-Verbrechen an behinderten Menschen während des 2. Weltkrieges und der Tatsache, dass früher die öffentliche Bildung wenig für diese Menschen angeboten hat, reifte im deutschen Sprachraum der Entschluss, dafür zu sorgen, dass zukünftig alles getan wird, sie als gleichwertigen Teil der Gesellschaft zu behandeln, also ihre Gleichstellung zu garantieren. Damals war man der Meinung, eine umfassende, längerfristige gesellschaftliche Integration werde am besten schulisch mit homogenen Sonderschulklassen (in der Schweiz setzte sich aufgrund der reduzierten Klassengrössen letztlich der Begriff der Klein- bzw. Sonderklasse durch) und speziell für eine Art von Behinderung ausgebildete Heilpädagoginnen und -pädagogen erreicht.
Die evidente Logik war, dass auf diese Weise die besten Förderungsbedingungen für diese Kinder gewährt würden. Lange Zeit genossen diese Kleinklassen sowohl in Deutschland (dort nannte man sie Förderschulen) als auch in der Schweiz einen guten, zuweilen sogar sehr guten Ruf aufgrund einer recht erfolgreichen Bilanz. Dies erklärt sich insbesondere daraus, dass Kleinklassenschüler meist gerne in eine solche Schule gingen, weil sie auf besonders engagierte Lehrkräfte trafen. Später konnten sie sich beruflich nicht selten erstaunlich erfolgreich entwickeln. Zugleich gab es aber allerdings auch die leider verbreitete Stigmatisierung der Kleinklassen- bzw. Sonderschüler als “dumm”, was diese Kinder und Jugendlichen jeweils sehr getroffen, gedemütigt und im sozialen Zusammenleben stark verunsichert hat. Dies hatte jedoch nichts mit der Qualität des Unterrichts zu tun. Scham und Gefühle von Minderwertigkeit waren die langfristigen Folgen.
Lange genossen diese Kleinklassen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz einen guten, zuweilen sogar sehr guten Ruf aufgrund einer recht erfolgreichen Bilanz.
Diese Problematik wurde im Zuge der Bildungsreform in den 1960er-Jahren als Ausdruck der Diskriminierung in einer von sozialer Ungleichheit geprägten Gesellschaft thematisiert und zusammen mit dem leistungsdifferenzierenden Schulsystem gesellschaftspolitisch heftig kritisiert. Es wurde argumentiert, das bestehende Schulsystem mit seinen unterschiedlichen Schulniveaus bis hinab zu den Kleinklassen bzw. Sonderschulen sei vor allem ein Instrument zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Klassengesellschaft. Als schulisches Gegenmodell wurde die “Schule für alle” gefordert, die die unterschiedlichen Leistungsniveaus aufheben und den Weg für schulische Integration oder gar Inklusion frei machen sollte. Ende der 1980er Jahre setzte sich dieses Konzept bildungspolitisch durch: In den verschiedenen Kantonen wurden in der Folge die öffentlichen Sonderschul- bzw. Kleinklassen schrittweise abgeschafft und deren Schülerinnen und Schüler in Regelklassen integriert.
Polarisierung der Standpunkte – auch nach 30 Jahren Erfahrung mit Integration
Bezüglich der erwähnten Polarisierung der Standpunkte zur Integration zeigte sich, dass es zumeist die Experten aus Lehrerbildung, Bildungsverwaltung und Politik waren, die die Integration und somit die Abschaffung der Kleinklassen begrüssten, während die praktisch tätigen Lehrpersonen und Heilpädagogen skeptisch bis ablehnend dieser Reform gegenüberstanden und -stehen.
Aktuell ist im Zusammenhang mit dem öffentlich gewordenen Fiasko des Lehrermangels häufig zu vernehmen, die chronische Überforderung der Lehrpersonen durch unangemessene Integrationslösungen in den einzelnen Klassen trage wesentlich dazu bei, dass nicht zuletzt viele junge, nicht selten sehr begabte und hochmotivierte Lehrpersonen nach wenig Jahren Praxis sich vom Lehrberuf abwenden. Aufhorchen liess unlängst die Stadt Basel, und zwar der Kanton, der über Jahrzehnte sämtliche Schulreformen zielstrebig und mit besonderem Eifer und Engagement umsetzte. Hier lancierte die Lehrersynode eine Initiative zur Wiedereinführung der Kleinklassen. Auch im Grossen Rat wurde dieses Anliegen von einer politischen Motion unterstützt.
Bezeichnendes Podiumsgespräch über die integrative Schule
Roger von Wartburg, langjähriger Präsident des baselländischen Lehrervereins, zeigt in seinem Artikel “Warum eigentlich erst jetzt? Ein Kommentar zur Basler Förderklassen-Initiative” (2) in der aktuellen Nummer der Vereinszeitschrift auf, dass diese Initiative eigentlich schon vor Jahren hätte lanciert werden müssen. Von Wartburg schildert dazu basierend auf seinen Notizen den Verlauf eines Podiumsgesprächs über die integrative Schule Basel-Stadt an der Basler Schulsynode des Jahre 2015, an die er als baselländischer Lehrervereinspräsident eingeladen war. Sein Bericht bietet einen repräsentativen Einblick in die Argumente der kontrovers ausgerichteten Podiumsteilnehmer – die Leiterin der Fachstelle Förderung und Integration der Volksschule Basel-Stadt, ein erfahrener Heilpädagoge sowie ein Vater mit einem behinderten Jugendlichen.

Zunächst muss betont werden, dass keine dieser drei Personen Integration grundsätzlich ablehnte. Laut von Wartburg war der Einstieg der Fachstellenleiterin für die Anwesenden irritierend, weil diese die Abschaffung der Kleinklassen und die Einführung der Integration als unumkehrbare Direktive aufgrund einer Gesetzesänderung darstellte. Im Unterschied dazu plädierte der Heilpädagoge mit Berufung auf seine langjährige Erfahrung für differenzierte Lösungen, die die strikte Umsetzung der Integration einhergehend mit der vollständigen Auflösung sämtlicher Kleinklassen in Frage stellte. Der Vater eines betroffenen Jugendlichen berichtete in seinem Votum über das Versagen der Integration seines Sohnes in einer Regelklasse der Volksschule und umgekehrt über die Wohltat, die der Sohn erlebte, als er in ein Sonderschulheim eintreten konnte. Er begründete die Entgleisung seines Sohnes in der Integrationssituation damit, dass dieser zunehmend unruhig und sogar aggressiv wurde, weil seine erheblichen kognitiven Einschränkungen ihn gegenüber sämtlichen Mitschülerinnen und Mitschülern zunehmend ins Minus abgleiten liessen. Die chronische Überforderung und Frustration, im Unterricht nicht aktiv mittun und mithalten zu können, führte über die Monate letztlich zu massiven Verhaltensauffälligkeiten, mit denen er sich und die Schulklasse belastete, die erst mit der Umplatzierung des Schülers zu beruhigen war.
Entgleisungen und Eintritt in ein Sonderschulheim
Symptomatisch für den Verlauf des Podiumsgesprächs war, dass es den Teilnehmenden nicht gelang, sachlich-inhaltlich miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen. Die Fachstellenleiterin etwa, die sich ausschliesslich auf Forschungs- und nicht auf Praxiserfahrung berufen und nur Studien mit sehr dürftigen Daten anführen konnte, beharrte auf der Behauptung, integrierte Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden auf diese Weise besser lernen können als in einer Kleinklasse. Von Wartburg fasst im Artikel den typischen Verlauf solcher Debatten und Kommentare – wie den geschilderten oder wie sie jetzt im Zusammenhang mit der Basler Förderklassen-Initiative in den Medien publik gemacht werden – mit folgenden Worten zusammen:
“Irritierend an der Berichterstattung zur Initiative ist, dass das letzte Wort immer einer Bildungssoziologin oder einem Bildungsforscher gehört, nie einer Vertretung der Schulpraxis.” (3)
Die zahlreichen bildungspolitisch relevanten Leserbriefe in unseren Zeitungen, die sich mit bildungspolitischen Fragen auseinandersetzen und häufig auch im Zusammenhang mit dem Lehrermangel oder mit Umfragen unter Lehrpersonen verfasst werden, widerspiegeln die sehr verbreitete Skepsis oder gar Ablehnung gegenüber der topdown-implementierten
Integrationsreform. Gehäuft ist zu hören:
- viele Lehrerpersonen seien angesichts äusserst komplexer pädagogischer Herausforderungen bei der Integration überfordert;
- viele Schülerinnen und Schüler, ganz besonders die unsicheren, beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen würden sich im Integrationssetting oft im Stich gelassen fühlen, in der Schule resignieren und unruhig werden; sie müssten dann mit den Eltern zuhause abends und am Wochenende nacharbeiten, dies häufig verbunden mit sehr viel Aufwand und Unruhe zuhause;
- es herrschten nicht selten chaotische Zustände in den Klassenzimmern, sodass die Lernwilligen mit Gehörschutzgeräten versuchen müssten, sich aufs Lernen zu konzentrieren;
- zahlreiche junge, begabte Lehrkräfte würden nicht zuletzt wegen den Anforderungen durch die Integration nach kurzer Zeit aus dem Schuldienst ausscheiden und sich beruflich anderweitig orientieren; mit anderen Worten: der so wichtige Lehrerberuf würde sehr an Attraktivität verlieren;
- das Konzept der Integration sei ein ideologisches Top-Down-Experiment, dessen Auswirkungen nicht wirklich evaluiert würden, was sonst aber ständig der Fall sei;
- trotz des offensichtlichen häufigen Versagens der Integration, werde von der Politik, der Lehrerbildung, den Schulleitungen und -verwaltungen etc. partout daran festgehalten.
Letztere verweisen häufig auf positive Beispiele von gelungener Integration, die es auch tatsächlich gibt. Tatsächlich wird oft vergessen, dass in den 6 Jahren Primarschule viele der Lehrpersonen per se schon gewohnt sind, mit heterogenen Klassen, also in gewissem Sinne integrativ zu arbeiten und dass es früher, insbesondere auf dem Land, durchaus üblich war, sämtliche Kinder und Jugendlichen in den Regelklassen zu integrieren. Interessanterweise gelang es dabei nicht wenigen der dafür angestellten Lehrpersonen in erstaunlichem Masse, mit der Heterogenität zurecht zu kommen.
Zwingende Voraussetzungen für erfolgreiche Integration
Was in den Augen verschiedener kritischer Erziehungswissenschaftler bei den Promotoren der Integration fehlt, ist eine differenzierte anthropologische Grundlage für die sachgerechte Beurteilung von Integrationssettings und ihren Folgen. So schreibt der deutsche Erziehungswissenschaftler Traugott Böttinger:
“In der öffentlichen Darstellung von Integration und ihrer Zielgruppe in den Medien wird schnell die Dominanz einer vereinfachenden Sichtweise deutlich. Ebenso wie die innere Logik von Integration (Vielfalt als Bereicherung) führt diese dazu, dass Schwierigkeiten beim gemeinsamen schulischen Leben und Lernen beeinträchtigter und nicht beeinträchtigter Menschen häufig ausgeklammert werden und unerwähnt
bleiben. Es wird suggeriert, Integration sei ein einfaches und problemlos zu verwirklichendes Projekt, das bisher lediglich am fehlenden Willen der Gesellschaft und ihrer Bildungsinstitutionen gescheitert ist”. (4)

Was Böttinger also bemängelt, ist eine fehlende, vertiefte anthropologische Sichtweise auf den Bildungsprozess. Sie ist mit der grundlegenden Frage verbunden, was Kinder und Jugendliche – damit sind alle Kinder, auch Kinder mit gewissen Einschränkungen gemeint – generell benötigen, um unbeschwert lernen zu können. Diese zentrale Fragestellung soll in diesem Beitrag beantwortet werden. Verbunden damit ist auch das Anliegen auszuloten, welche Risiken dazu führen, dass der «Bogen überspannt» wird, d.h. für Lehrperson und Klasse aufgrund ihrer Zusammensetzung eine Überforderungssituation mit allen angesprochenen negativen Folgen entsteht.
Es fehlt eine anthropologische Sichtweise auf den Bildungsprozess
Von den Heilpädagogen ist zu lernen, dass behinderte junge Menschen exakt dieselben emotionalen und sozialen Grundbedürfnisse haben wie alle anderen Kinder: Sie möchten beim Lernen erfolgreich sein, von der Lehrperson und der Klasse soziale Anerkennung erfahren, in freundschaftlichen Kontakt mit den Gleichaltrigen stehen, ermutigt und unterstützt werden, wenn sie am Lernen sind und laufend durch begeisternde Lehrpersonen eine Erweiterung ihres Horizonts erfahren. Der einzige Unterschied liegt darin, dass sie je nachdem höhere Hindernisse zu überwinden haben und deshalb manchmal mehr Zeit sowie mehr fachlichen wie emotionalen Rückhalt benötigen.
Bei näherer Betrachtung ist ersichtlich, dass es v.a. die unruhigen, verhaltensauffälligen, sozial-emotional beeinträchtigten und die äusserst langsam auffassenden Schülerinnen und Schüler sind, die für die Lehrpersonen im Klassenverband zur Herausforderung werden können. Hör- und sehbehinderte sowie körperbehinderte Kinder können normalerweise mit den erforderlichen Hilfsmitteln und gezielter heilpädagogischer Unterstützung recht problemlos integriert werden, falls die körperliche Einschränkung nicht einen wesentlich intensiveren Förderbedarf nötig macht. Die Gruppe der fremdsprachigen Kinder werden hier nicht einbezogen, da, um ihnen gerecht werden zu können, dies eine eigene vertiefende Auseinandersetzung erfordern würde. Auf die geistig behinderten jungen Menschen und deren Integration soll erst später eingegangen werden.
Ende 1. Teil
Beat Kissling, 20. November 2022
(1) John Donne, 1623, Mediation 17
(2) lvb inform. Zeitschrift des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland, Schuljahr 20/23, Nummer 01, September
2022, S. 8 ff
(3) dito, S. 11
(4) Böttinger, T. (2017): Exklusion durch Integration? Stolpersteine bei der Umsetzung. Stuttgart: Kohlhammer





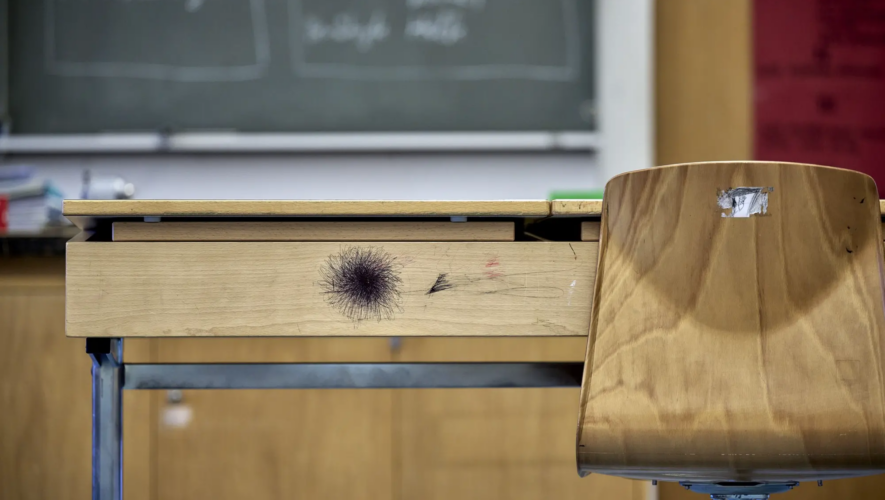
Überall dort, wo die Ideologie über der Praxistauglichkeit thront, wird es über kurz oder lang sektiererisch. Das passiert heute vielerorts – die übertriebene Inklusionsdebatte ist nur ein Beispiel dazu.