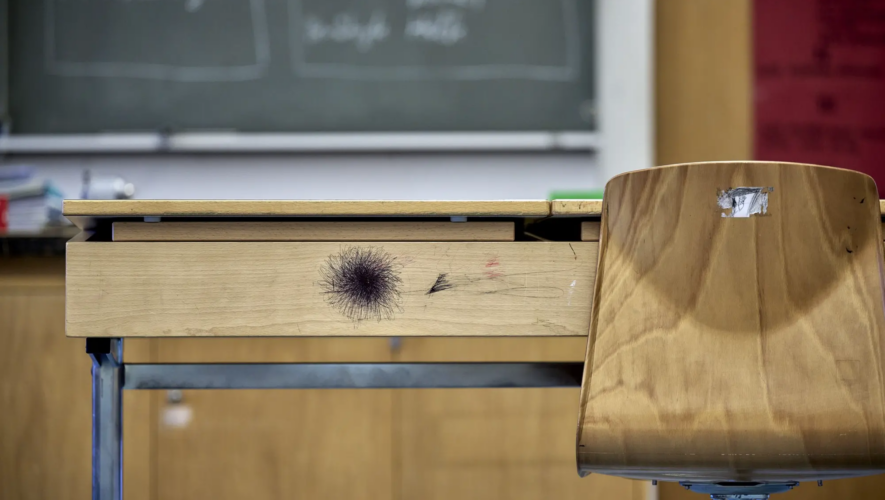Erinnerungen an eine eindrückliche Veranstaltung
Aufgrund der vielen Medienberichte fiel mir wieder ein, dass ich vor fast sieben Jahren als LVB-Präsident an eine Delegiertenversammlung unseres basel-städtischen Partnerverbandes FSS (Freiwillige Schulsynode Basel-Stadt) eingeladen gewesen war, wo in Form eines Podiumsgesprächs über die integrative Schule Basel-Stadt gestritten wurde. Das Wiederauffinden meiner damaligen Notizen förderte Erstaunliches wie Erhellendes zutage – und legt die Frage nahe: Warum kommt diese Initiative eigentlich erst jetzt?
An jenem 28. November 2015 hatte die FSS zu einer «dialogischen Zwischenbilanz» über «Chancen und Grenzen» der schulischen Integration geladen. Der Versammlungsraum war rappelvoll und auf dem Podium trafen die damalige Leiterin der Fachstelle Förderung und Integration der Volksschule Basel-Stadt, ein erfahrener Heilpädagoge sowie der Vater eines Jungen mit besonderen Bedürfnissen aufeinander.
Bürotisch vs. Klassenzimmer
Für ein erstes Raunen unter der versammelten Lehrerschaft sorgte die Fachstellen-Leiterin mit ihrem Eingangsvotum, das von vorneherein jegliche Zweifel an ihrer Kernbotschaft des Abends ausräumte: Die integrative Schule in Basel-Stadt sei eine Gesetzesänderung, die anzunehmen sei wie jede andere Gesetzesänderung. Die Würfel seien gefallen, unumkehrbar (die vormalige deutsche Bundeskanzlerin hätte wohl den Begriff «alternativlos» verwendet). Basel-Stadt befinde sich hinsichtlich Integration im Rückstand gegenüber der restlichen Schweiz und Europa. Es gebe folglich keine Debatte mehr über das «Ob», sondern nur noch über das «Wie», und die Hauptfrage laute nun, wie die Haltung der Lehrpersonen zur Integration sei und was sie bräuchten, um diese im Sinne des Gesetzes umzusetzen. Den Satz «Wir müssen die Schule neu denken» wiederholte die Expertin im Laufe des Abends so oft, dass ich eine Strichliste zu führen begann, das Unterfangen jedoch nach einiger Zeit aufgab.
Das Endziel müsse primär in der Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft bestehen.
Der Heilpädagoge seinerseits kritisierte die Vorstellung, dass «Integration» gemäss der basel-städtischen Umsetzung meine, alle Kinder müssten permanent im gleichen Schulzimmer zusammen sein. Er plädierte stattdessen für integrative Ziele, die über die Schule hinausreichten; das Endziel müsse primär in der Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft bestehen. Ausserdem könne nicht von entfernten Bürotischen aus festgeschrieben werden, wie die Integration vor Ort an den Schulen zu passieren habe.
Der Bericht eines betroffenen Vaters

Sodann meldete sich die dritte Person auf dem Podium zu Wort und erzählte in eindrücklichen und einfühlsamen Worten von dem 15-jährigen Sohn. Dieser habe zuerst die Montessori-Schule besucht, bevor er an die Volksschule wechselte. Zunächst habe es ihm durchaus gefallen und er sei gerne dabei gewesen, aber als es inhaltlich anspruchsvoller wurde und seine erheblichen kognitiven Einschränkungen dadurch immer stärker ins Gewicht fielen, seien Konflikte entstanden, die dann innerhalb eines Jahres vollständig eskaliert seien. Der Junge sei aggressiv geworden, wohl aus einer Mischung von schulischer Überforderung und aufkeimender Pubertät heraus. Er habe andere Schüler körperlich attackiert und sogar gebissen, sodass den Eltern klar geworden sei, dass dieses Modell für die Situation ihres Sohnes und der Klasse nicht passe.
Der Sohn sei dann in ein Sonderschulheim eingetreten, wo es ihm sehr gut gehe. Rückblickend hätten sie als Eltern den Eindruck, ihr Kind habe wohl zunächst die Erwartungen von Schule und Eltern nach Integration in der Regelschule adaptiert und bedient, doch sei dies gar nie sein eigener Anspruch gewesen. Im Sonderschulheim sei er glücklich und nicht mehr aggressiv.
Von der Forschung
Die Fachstellen-Leiterin betonte in ihrem folgenden Votum, sie komme primär aus der Forschung, und obwohl noch nicht viele brauchbare Studien dazu vorlägen, sei gemäss aktuellem Forschungsstand unbestritten, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen besser lernen würden, wenn sie in Regelklassen integriert seien, und auch die anderen Kinder in solchen Klassen würden deswegen nicht schlechter lernen. Schliesslich zog sie unter schwerlich nachvollziehbaren Bezügen auch noch die Hattie-Studie als Beleg für die Richtigkeit des integrativen Modells Basel-Stadt heran.
Auf keinen Fall dürfe verallgemeinernd behauptet werden, Kindern mit besonderen Bedürfnissen gehe es in einem integrativen Modell gut, aber in anderen Modellen nicht.
Dies wiederum rief den Heilpädagogen auf den Plan, welcher die Fachstellen-Leiterin davor warnte, Schwarz-Weiss-Bilder zu malen. Auf keinen Fall dürfe verallgemeinernd behauptet werden, Kindern mit besonderen Bedürfnissen gehe es in einem integrativen Modell gut, aber in anderen Modellen nicht. Man müsse stattdessen stets situativ schauen, ob das jeweilige Modell dem einzelnen Kind auf seinem Lebensweg dienlich sei.
Da mischte der Saal sich ein
Alsbald wurde das Mikrofon für die anwesenden Lehrpersonen geöffnet und es entlud sich eine Mischung aus Enttäuschung, Frustration und Unverständnis. Ein Primarlehrer hielt der Fachstellen-Leiterin vor, bei der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes habe man über das Ziel hinausgeschossen. Die Fachstellen und die Erziehungsdirektion hätten es in Eigenregie so ausgestaltet, wie sie es haben wollten, nämlich unter grösstmöglicher Abschaffung von Einführungs- und Kleinklassen sowie Sonderschulen, würden nun aber so tun, als wäre gar keine andere Umsetzung möglich gewesen. Dies stimme jedoch nicht. (Eine ähnliche Argumentation vertrat auch Roland Stark, Heilpädagoge und ehemaliger Präsident der SP Basel-Stadt, in einem Gastbeitrag[1] im «lvb inform» vor sechs Jahren.)
Die integrative Förderung für Kinder mit Lernschwierigkeiten sei gut und sinnvoll, stark verhaltensauffällige Kinder jedoch könnten im bestehenden Setting nicht erfolgreich integriert werden.
Weitere Wortmeldungen von Lehrpersonen brachten zum Ausdruck, dass infolge der Belastung durch die Integration fast niemand mehr 100 % arbeite, dass man überlastet sei, dass sich die Dinge in die falsche Richtung entwickelten, die Berufspraxis aber nicht gehört werde, ja dass man schlicht nicht mehr könne. Klare Voten wandten sich gegen die Schliessung von Sonderschulen und forderten stattdessen die Rückkehr von Einführungs- und Kleinklassen. Die Frage wurde aufgeworfen, ob Renitenz von Schülerinnen und Schülern auch als Behinderung gelte. Resümierend liess sich die Stimmung unter den Anwesenden so umreissen: Die integrative Förderung für Kinder mit Lernschwierigkeiten sei gut und sinnvoll, stark verhaltensauffällige Kinder jedoch könnten im bestehenden Setting nicht erfolgreich integriert werden.

Als die sichtlich unter Druck geratene Fachstellen-Leiterin noch einmal dazu anhob, die Schule neu denken zu müssen, platzte dem neben ihr sitzenden Heilpädagogen der Kragen. Er stellte sich unmissverständlich hinter die Wortmeldungen der Lehrpersonen und meinte, man könne doch auf derartige Bekundungen der Überforderung bis Verzweiflung nicht mit abstrakten Phrasen reagieren. Wenn die Lehrpersonen sagten, sie könnten nicht mehr, dann müsse die Erziehungsdirektion das akzeptieren und Massnahmen dagegen ergreifen.
Sieben Jahre später
Liest man heute den Unterschriftenbogen und das Argumentarium des Basler Initiativkomitees, so stellt man fest, wie sehr die dort getroffenen Aussagen den Voten der Versammlung von 2015 ähneln. Es ist die Rede davon, dass «Verhaltensauffälligkeiten von Schülern» von «90 % der Lehrpersonen als ein Hauptproblem ihres Berufsalltags» gesehen würden; dass Kinder und Jugendliche mit «sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen bei der jetzigen Form der schulischen Integration häufig überfordert» seien und die Regelschule damit «nicht allein gelassen werden» dürfe; dass Förderklassen «das unter Druck geratene System Volksschule» wirksam entlasten könnten und dass «die Praxis die Grenzen des theoretischen Modells der integrativen Schule aufzeige».
Es erstaunt daher etwas, dass auf dem Unterschriftenbogen zu lesen ist, es zeige sich «jetzt», dass das System «für die Lehr- und Fachpersonen zunehmend zum Problem» werde. Angesichts der Wortmeldungen von 2015 hätte dieser Eindruck sich durchaus schon früher verfestigen können. Allerdings entspricht es der politischen Realität, dass getroffene Entscheide in aller Regel nicht nach kurzer Zeit wieder umgestossen werden. Der Leidensdruck jedenfalls muss in der Zwischenzeit so gross geworden sein, dass die Sammlung der erforderlichen Unterschriften im Nu zustande kam.
Ein Wort zur Berichterstattung

Zum Gesicht der Förderklassen-Initiative wurde Primarlehrer Markus Harzenmoser, seit fast 40 Jahren im Beruf, tätig in Kleinbasel, ein Pädagoge mit Leib und Seele, wie man sofort erkennt, wenn er über Kinder und Schule spricht. Das Label «integrationsfeindlich» lässt sich einem Lehrer wie Harzenmoser, der sich im Radio-Interview als «Anwalt für die Kinder» bezeichnete, nicht einmal mit schändlichstem Vorsatz anhängen.
Höchst eindrücklich vielmehr ist es, wie Harzenmoser die Realität in seinem Klassenzimmer schildert. Von Kindern, die sich auf den Boden werfen, herumschreien, die es nicht aushalten, wenn es einfach ruhig und schön ist, wenn gemeinsam gesungen wird, und die dann mit aller Macht das Geschehen sabotieren und die anderen Kinder stören oder gar verstören. Und Harzenmoser weist darauf hin, dass die Anzahl Kinder mit solchen Verhaltensweisen im Zeitraum seines Arbeitslebens deutlich gestiegen sei.
Etwas irritiert war ich beim Verfolgen der Berichterstattungen von Radio und Fernsehen SRF, deren Arbeit ich grundsätzlich sehr schätze, darüber, dass in allen mir bekannten Sendungen das Schlusswort jeweils einer Bildungssoziologin (ich hatte ehrlicherweise bis dahin nicht einmal gewusst, dass es das gibt) oder einem Bildungsforscher gehörte, welche die Botschaft der Fachstellen-Leiterin von 2015, wonach aus wissenschaftlicher Sicht das integrative Modell nur Vorteile für alle aufweise, einmütig erneuerten.
Nun ist mir zwar sehr wohl bewusst, dass bei einer Reportage über eine Initiative richtigerweise Befürworter und Gegner zu Wort kommen sollen, dennoch war es auffällig, dass sich zuerst stets der Praktiker Harzenmoser äussern durfte, das letzte Wort aber den Hochschul-Vertretungen vorbehalten blieb. Nicht ohne Grund meint die Redensart «das letzte Wort haben» so viel wie «die Befugnis besitzen, bei einem Streitfall zu entscheiden». Dies sollte meines Erachtens bei der Konzeption eines medialen Berichts beachtet und entsprechend ausgeglichen gehandhabt werden.
Wissenschaft und Bildungspolitik
Ganz allgemein verspüre ich stets ein gewisses Unbehagen, wenn im schulischen Kontext wissenschaftliche Befunde wie Naturgesetze proklamiert werden. Pädagogik ist nicht Physik. Oder wie Carl Bossard, früherer Rektor der PH Zug, es formuliert hat: «Bildungspolitische Massnahmen und Aussagen über Schule und Unterricht beruhen auf normativen Zielvorstellungen wie Weltanschauung oder Zeitgeist, Menschenbild oder Gesinnung. Sie sind nicht beweisbar, sondern nur begründbar.»[2]
Die Urteile von Lehrpersonen werden in der medialen Berichterstattung, wenn auch nur unterschwellig, als eher «anekdotisch» konnotiert, während die Aussagen von Hochschul-Dozierenden dagegen als fundiert und neutral gelten dürfen.
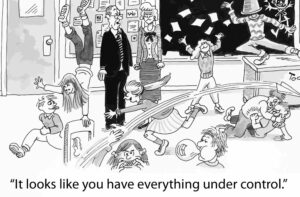 Umso stärker müssten meines Erachtens die Einschätzungen erfahrener Vertretungen der Berufspraxis beachtet werden. Ich habe jedoch zunehmend den Eindruck, dass in der medialen Berichterstattung die Urteile von Lehrpersonen, wenn auch nur unterschwellig, als eher «anekdotisch» konnotiert werden, die Aussagen von Hochschul-Dozierenden dagegen als fundiert und neutral gelten dürfen.
Umso stärker müssten meines Erachtens die Einschätzungen erfahrener Vertretungen der Berufspraxis beachtet werden. Ich habe jedoch zunehmend den Eindruck, dass in der medialen Berichterstattung die Urteile von Lehrpersonen, wenn auch nur unterschwellig, als eher «anekdotisch» konnotiert werden, die Aussagen von Hochschul-Dozierenden dagegen als fundiert und neutral gelten dürfen.
Kommt hinzu, dass wir in der Vergangenheit abschreckende Beispiele «wissenschaftlicher Beweise» erlebt haben, die zur Begründung folgenschwerer bildungspolitischer Entscheide herangezogen wurden. So hatte etwa der damalige Zürcher Erziehungsdirektor Ernst Buschor 2002 ein «wissenschaftliches Gutachten» bei Dr. Otto Stern von der PH Zürich in Auftrag gegeben, um das von Buschor vehement angestrebte Frühfremdsprachen-Konzept legitimieren zu lassen.
Über ebenjenes Gutachten von 2002 urteilte der vergleichende Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Rudolf Wachter von der Universität Basel in einer Stellungnahme vom Januar 2004 entwaffnend nüchtern: «Da Stern in Projekten rund um den Fremdsprachunterricht an der Primarschule des Kantons Zürich und in der Entwicklung von dafür vorgesehenen Lehrmitteln massgeblich beteiligt ist, kann freilich von einem unabhängigen Gutachten nicht die Rede sein […], und Stern weist einleitend auf die tendenziöse Stossrichtung seines Dokuments in durchaus offenherziger Weise hin. […] Solche Insider-Gutachten durch die öffentliche Hand für die öffentliche Hand werden heutzutage leider sehr oft erstellt. Sie sind in ihrem wissenschaftlichen Wert grundsätzlich fragwürdig.»[3]
Im Lichte des Lehrpersonenmangels
Doch selbst wenn wir annehmen würden, dass sich das basel-städtische Integrationsmodell auf alle beteiligten Schülerinnen und Schüler tatsächlich ausschliesslich positiv auswirken würde, wäre ein damit verknüpftes Problem nicht aus der Welt geschafft: Die Lehrpersonen brennen aus, wenn sie neben der naturgemäss schon gros-sen Heterogenität von Schulklassen sich zusätzlich täglich mit hoch- und höchstgradig verhaltensauffälligen Kindern oder Jugendlichen auseinandersetzen müssen. Sie senken ihre Pensen oder verlassen gar den Beruf. Auch darüber müsste man in Zeiten akuten Lehrpersonenmangels nachdenken.
 Und noch ein Aspekt sollte erwähnt sein: Rufen Sie sich die Schilderungen von Markus Harzenmoser noch einmal in Erinnerung! Herumschreiende, sich auf den Boden werfende, das Unterrichtsgeschehen massivst störende, Gegenstände umherwerfende Kinder im Schulzimmer – integriert in eine Regelklasse, welche zwangsläufig weitere Herausforderungen wie Fremdsprachigkeit, grosse leistungsmäs-sige Unterschiede oder körperliche Gebrechen birgt. Wirken derartige Arbeitsbedingungen attraktiv auf junge Menschen, die sich vor dem Abschluss ihrer Fachmaturität oder gymnasialen Maturität im Entscheidungsprozess für ein anschliessendes Studium befinden?
Und noch ein Aspekt sollte erwähnt sein: Rufen Sie sich die Schilderungen von Markus Harzenmoser noch einmal in Erinnerung! Herumschreiende, sich auf den Boden werfende, das Unterrichtsgeschehen massivst störende, Gegenstände umherwerfende Kinder im Schulzimmer – integriert in eine Regelklasse, welche zwangsläufig weitere Herausforderungen wie Fremdsprachigkeit, grosse leistungsmäs-sige Unterschiede oder körperliche Gebrechen birgt. Wirken derartige Arbeitsbedingungen attraktiv auf junge Menschen, die sich vor dem Abschluss ihrer Fachmaturität oder gymnasialen Maturität im Entscheidungsprozess für ein anschliessendes Studium befinden?
Fazit und Prognose
Die Förderklassen-Initiative in Basel-Stadt ist keineswegs radikal. Sie fordert keine Rückkehr zu Tendenzen aus fernerer Vergangenheit, als etwas «schwierige» Kinder vorschnell in Sonderklassen gesteckt wurden. Der Grundgedanke des integrativen Charakters der Volksschule wird nicht in Frage gestellt. Jedoch sollen neben Integrationsklassen auch wieder heilpädagogisch geführte kleinere Klassen geführt werden, um situativ jene Modelle wählen zu können, welche, um ein Zitat des Podiumsgesprächs von 2015 noch einmal aufzunehmen, allen beteiligten Kindern und Jugendlichen auf deren Lebenswegen dienlich sind.
Hinsichtlich der dereinst stattfindenden Abstimmung in Basel-Stadt lege ich mich fest: Die Förderklassen-Initiative wird deutlich angenommen werden. Wetten?
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland (LVB) erschienen (September-Ausgabe 2022).
1 Roland Stark: Integrativer Zwischenruf aus Basel-Stadt – Romantik statt Praxiserfahrung, lvb inform 2016/17-02
2 Carl Bossard: Parole: Hausaufgaben abschaffen!, www.journal21.ch, 30. April 2018
3 Rudolf Wachter: Zur wissenschaftlichen Grundlage der Entscheidung des Bildungsrats und der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich betr. Frühfremdsprachen, 4. Januar 2004