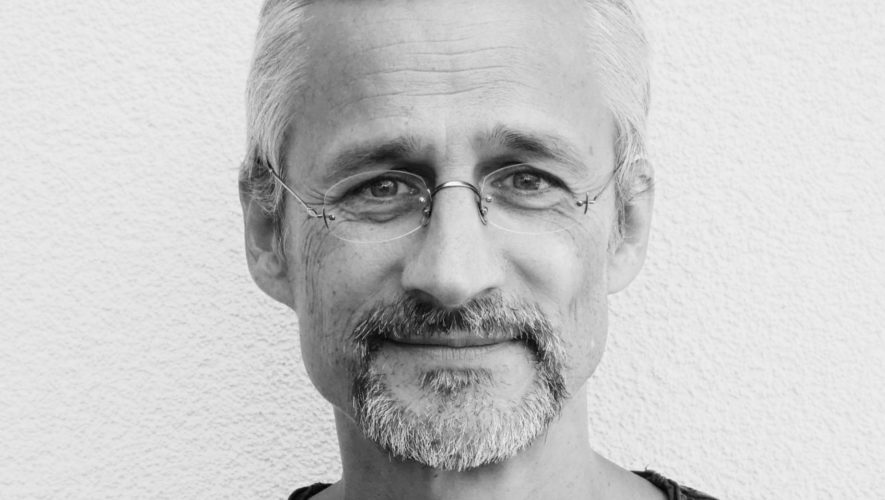Phase 1: Plan = Planen
Problembeschreibung, Ursachenanalyse, Zielvorgabe
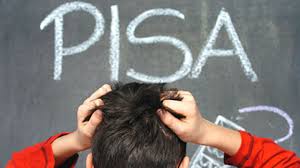
Passepartout ist eine Nachwehe des inszenierten PISA-Schocks. Auf der Kompetenz-Ideologie basierend, testete PISA, was nicht Bestandteil kantonaler Lehrpläne sein konnte, da jene damals nicht Kompetenz-ideologisch waren. Die Folge war eine verhängnisvolle Fehlinterpretation der PISA-Ergebnisse: Die Schweizer Schulbildung ist unzulänglich, sie muss verbessert werden. Bei der Fremdsprachenvermittlung bestand der Plan folglich darin, die fälschlicherweise behauptete Unzulänglichkeit durch einen Paradigmenwechsel, dem sog. Sprachbad, zu beheben: Verbringt man genug Zeit im Fremdsprachengebiet, lernt sich die Sprache auch ohne Wortschatzaufbau und Grammatik. Es braucht nur eine permanente Berieselung mit der zu lernenden Fremdsprache. Der Umkehrschluss: Werden Wortschatz und Grammatik ignoriert, lernt sich die Fremdsprache mittels Sprachbad von selbst. Der Irrtum: Mit 3 Lektionen pro Woche lässt sich kein Sprachbad realisieren. Folge: Passepartout bietet weder Wortschatz und Grammatik noch Sprachbad, weshalb die Lernenden nach Jahren des Fremdsprachenunterrichts kaum etwas auf die Reihe bekommen.
Passepartout bietet weder Wortschatz und Grammatik noch Sprachbad, weshalb die Lernenden nach Jahren des Fremdsprachenunterrichts kaum etwas auf die Reihe bekommen.
Phase 2: Do = Umsetzen
Festlegung der Massnahmen zur Erreichung der Zielvorgabe
Da der Plan auf einer Fehlinterpretation basiert, griffen die Passepartout-Ideologen als Massnahme zu einer List, indem sie den zuvor bewährten Fremdsprachenunterricht als rückständig diffamierten. Es wurde behauptet, die Lehrkräfte legten keinen Wert auf mündliche Kommunikation oder Handlungsorientierung, ihr Fokus liege einzig auf Grammatik und “Wörter büffeln”. Die Passepartout-Ideologen konstruierten also einen in Wirklichkeit inexistenten Missstand zur Rechtfertigung ihres angestrebten Paradigmenwechsels. Da es sich um einen von langer Hand geplanten Coup seitens der damaligen kantonalen Bildungsdirektoren handelt, waren die weiteren Massnahmen bereits zuvor festgelegt: die Kompetenz-ideologischen Lehrwerke, Mille Feuilles, Clin d’oeil und New World sowie die “Weiterbildung”, in welcher die Lehrkräfte überzeugt werden sollten. Hinzukam die schönfärberische Bezeichnung „Passepartout“ zur medialen Propagierung des Produkts.
Phase 3: Check = Überprüfen
Sammlung von Erfahrungen beim Umsetzen der Massnahmen, Reflexion der Ergebnisse

Eine Reflexion fand kaum statt und Erfahrungen wurden abgewehrt. So ignorierte man grösstenteils die vielen fast ausschliesslich negativen Bottom-up-Rückmeldungen aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft. Die für das Qualitätsmanagement typischen Audits – Anhörungen von Direktbeteiligten – fehlten gänzlich. Aber auch wissenschaftliche Befunde wurden verdrängt, teilweise gar diskreditiert. So verunglimpfte Christoph Eymann, damaliger Basler Erziehungsdirektor, die Studie zum Nutzen von Frühenglisch von Simone Pfenninger als „qualitativ ungenügend“ (BAZ, 8.1.18). Aber auch Susanne Zbindens Untersuchung, welche die Unterlegenheit der Passepartout-Französischlehrmittel gegenüber „Bonne Chance“ nachwies, sowie die Evaluation des Instituts für Mehrsprachigkeit in Fribourg (IfM) wurden ignoriert.
Man ignorierte grösstenteils die vielen fast ausschliesslich negativen Bottom-up-Rückmeldungen aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft.
Phase 4: Act = Handeln
Evaluation der in Phase 3 gesammelten Erfahrungen und Ableitung des künftigen Vorgehens
Dem zunehmenden Druck nachgebend, unternahmen die Verantwortlichen in dieser Phase einen zögerlichen Schritt, aber den falschen und zu spät. So wurden die Lehrmittel zwar ergänzt mit Wortschatzlisten, Grammatikübersichten und Übungsmaterial, doch wurden diese nicht in die Kursbücher integriert, da dies die “reine Lehre” verfälscht hätte. In der Folge werden vielerorts, wenn überhaupt, lediglich die Zusatzmaterialien verwendet, während die Kursbücher in die Schulschränke und von dort unbenutzt in die Tonne wandern. Die Frustration unter den Lernenden ist zu diesem Zeitpunkt bereits unverantwortlich gross.
Die Kursbücher wandern unbenützt in die Tonne.
Fazit: Lähmung der schulischen Fremdsprachenvermittlung
Passepartout als offenbar nicht zu hinterfragendes Diktat der damaligen Erziehungsdirektoren hat sich als Lähmung der schulischen Fremdsprachenvermittlung herausgestellt. Anstelle von Pilotprojekten erfolgte die flächendeckende Einführung. Eine kritische Hinterfragung seitens der Verantwortlichen fand nie statt. Die Akzeptanz gegenüber vorliegenden negativen Befunden war kaum je vorhanden, da nicht sein kann, was nicht sein darf. 120’000 Lernende wurden bisher als Versuchsobjekte missbraucht. Die Angst vor Gesichtsverlust seitens der heutigen Bildungsdirektionen wiegt schwerer als die Bildungschancen der Schülerschaft. Mit Passepartout steht ebenso die zugrundeliegende Kompetenz-Ideologie und somit der Lehrplan21 zur Debatte.