Die operative Macht von Schulleitungen in der Schweiz ist in ihrer Reichweite einzigartig: Sie entscheiden eigenständig über Budgetverteilungen, Personalrekrutierungen oder Kündigungen sowie pädagogische Konzepte im Rahmen der jeweiligen Schulentwicklung – oft ohne wirksame Kontrollinstanzen. Diese Konzentration von Befugnissen ohne ausreichende Checks zeigt sich besonders deutlich im Vergleich zu anderen Sektoren.
Defizite mit dokumentierten Folgen
Während öffentliche Spitäler durch Ethikkommissionen und kantonale Aufsichtsbehörden überwacht werden, fehlen im Bildungswesen vergleichbare Strukturen. Nur wenige Kantone verfügen über unabhängige Ombudsstellen für Beschwerden im Bereich der Schulen. Kollegiale Gremien wie Elternräte oder Lehrerkonferenzen haben meist nur beratende Funktion. Die Konsequenzen sind bedenklich: Unhinterfragter Einsatz von finanziellen Mitteln oder problematische Personalentscheidungen (rechtlich fragwürdige Verwarnungen von Lehrpersonen oder Kündigungen). In öffentlichen Verwaltungen oder der Polizei würden derartige Vorfälle mehrstufige Untersuchungen auslösen – im Bildungswesen bleiben sie häufig folgenlos.

Privatwirtschaft als Kontrastmodell
Internationale Privatschulen in der Schweiz demonstrieren systematischere Ansätze: Budgetentscheidungen benötigen die Freigabe von Vorständen, Personalentscheide unterliegen verbindlichen Personalführungsprozessen. Externe Audits und veröffentlichte Finanzberichte schaffen Transparenz, während klare Haftungsregeln Eigenverantwortung sicherstellen. Im öffentlichen Schulsystem hingegen tragen meist Gemeinden und Kantone die finanziellen Folgen von Fehlentscheiden – nicht die verantwortlichen Schulleitungen.
Reformbedarf: Lösungen liegen auf der Hand
Drei Ansätze könnten das Macht-Kontroll-Ungleichgewicht beheben:
- Einführung kantonaler Prüfstellen nach Vorbild der Rechnungshöfe, wie von der OECD empfohlen.
- Verbindliche Mitspracherechte für Lehrerkollegien, wie im Tessiner Modell praktiziert, wo kollegiale Gremien bei Personal- und Budgetfragen mitentscheiden. [1]
- Verpflichtende Ethikrichtlinien und Schulungen zur Rechtskonformität, wie sie im Gesundheitswesen längst Standard sind.
Tessiner Schulen beweisen, dass solche Mechanismen Folgekosten reduzieren und die Akzeptanz von Entscheidungen erhöhen. [2]
Fazit
Kantone müssen für ihr Bildungswesen nicht das Rad neu erfinden – sie können entweder von anderen Kantonen oder von anderen Sektoren lernen. Öffentliche Spitäler, Gemeindeverwaltungen und Privatschulen zeigen, wie transparente Prozesse, mehrstufige Genehmigungen und klare Haftung Machtmissbrauch verhindern. Schulleitungen brauchen Gestaltungsspielraum, aber keine Blankovollmachten. Es ist an der Zeit, Aufsichtslücken zu schliessen, bevor weitere öffentliche Mittel versickern oder rechtlich fragwürdige Personalentscheide gefällt werden, die wiederum mit beträchtlichen Folgekosten für die öffentliche Hand verbunden sind.
[1] https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/num/208#:~:text=b, Regolamento della legge della scuola (RLSc) 1992 des Kantons Tessin, Gesetz Nr. 208, Art. 17, 43, 65, 67
[2] https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/num/208#:~:text=b, Art. 17, 43, 65, 67
Die Starke Schule beider Basel (SSbB) begleitet seit dem Jahr 2011 die Bildungsreformen rund um Harmos und den Lehrplan 21 kritisch. Dort, wo sinnvoll, strebt der Mitte-links-Verein mittels Volksinitiativen und politischen Vorstössen in den beiden Basler Parlamenten Korrekturen in der Bildungspolitik an.





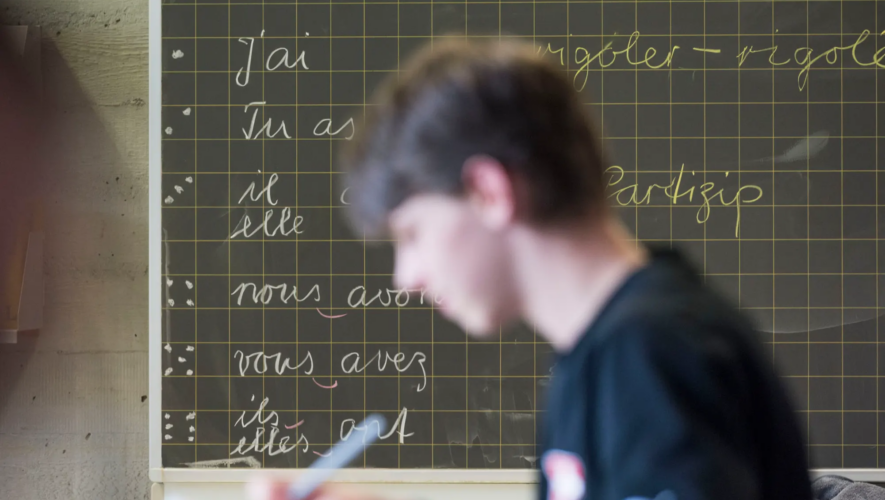

Die Schulpflege ist Chef! Personalentscheidungen z.B. werden nie nur durch die SL gefällt.
FG, Schulpräsident D.Rapold
Ich empfinde es als ehemalige Schulleiterin anders. Die überbetonte Partizipation des Lehrerkollegiums bedeutet, dass ich die Lehrpersonen jeweils mit meinen Arbeitsversuchen unterhalten soll. Jeder Schritt, den ich mache, wird zum Spektakel und die Lehrpersonen verbringen ihre Zeit mit unendlichem Meinungsaustausch, der sich dann mit Daumen hoch oder Daumen runter an der Teamsitzung zeigt. Ich bin gezwungenermassen das Windfähnchen ohne Emtscheidungskompetenz. In einem Fall habe ich einen beliebten, aber mit Kindern unangemessen sich Verhaltenden Senior, vom Schulgelände verbannt. Aufgrund des Amtsgeheimnisses durfte ich meine Gründe nicht mitteilen. Der folgende Shitstorm war so schwierig auszuhalten, dass ich aufgegeben habe. Meine Budgetkompetenzen waren so gering, dass ich nicht mal für ein Jubiläum einen Blumenstrauss kaufen konnte. Also ich habe die Zeit ganz anders empfunden als im Blogartikel. Einige meiner SL-Freunde wurden total durch die Medien gezogen, weil sie Lehrpersonen in der Probezeit entliessen und Ähnliches. Mit noch weniger Entscheidungskompetenz ist der Unterschied zur Sekretärin / Schulverwaltung nicht mehr klar.
Ein Paradies für Narzissten…
Ich habe das als Schulleitung nicht so empfunden. Durch die aktuell starke Betonung auf starke Lehrerteams, fand ich es schwierig, überhaupt etwas zu entscheiden, ohne einen Shitstorm zu ernten. Bestehende Ausgaben neu zu überlegen ist praktisch unmöglich, allein schon, es zu wagen, bedeutet Respektlosigkeit gegenüber dem Bestehenden, mangelnde Wertschätzung der Schulkultur, als hierarchisch empfundene Machtausübung etc. Das Team wollte zudem bei Bewerbungsgesprächen dabei sein, was aus Datenschutzgründen nicht geht, und war empört, dass ich alleine entscheide, wer nachher zu ihnen ins Team gehören würde. Mehrere meiner Kollegen wurden medial durch den Kakao gezogen, darunter einer, dem im Blick vorgeworfen wird, es würden Lehrpersonen in der Probezeit verschwinden! Dabei ist das ja genau sein Job.
Aus Gründen des Amtsgeheimnisses durfte ich nicht sagen, dass ein freiwilliger Helfer sich einem Kind gegenüber unangemessen verhalten hatte und das war mein Dolchstoss. Da berichten mehrere Schulleiter, dass so etwas einen unüberwindbaren Graben zwischen einem und dem Team bildet. Einem Lehrer, der die Kinder dadurch einschüchterte, dass er ausrastete und auf Tisch und Tafel einhämmerte, durfte ich nicht kündigen, weil die Anstellungsbehörde nein sagte. Ich hatte nicht einmal Budget, um zu einem Jubliäum einen Blumenstrauss zu kaufen und als meine Entscheidungskompetenz noch weiter eingeschränkt wurde, so dass ich nur noch ein Pro-Forma-Unterschriftsgeber und Pro-Forma-Entscheidungsverantworter war, habe ich den Beruf aufgegeben.
Ich bin aber ebenso wie im Artikel beschrieben für Kontrollinstanzen und vor allem auch für messbare Parameter im Schulleiter-Job. Sonst ist man einfach nur die Daily Soap für das Team und das ist dann kein würdiger Führungsjob mehr.
1. Wer als Lehrer oder Lehrerin taugt und ein paar Kürsli besucht, ist nicht auch ein guter Schulleiter/eine gute Schulleiterin. Oft regiert hier das Peter-Prinzip: Jemand steigt so lange auf, bis er oder sie den Posten seiner/ihrer Unfähigkeit erreicht. Dort bleibt er/sie sitzen (bis zum Burnout oder zur Kündigung). (Lawrence J. Peter, Raymond Hull, Das Peter-Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen, 1972).
2. Schulleiter(innen) sollten vom Kollegium auf eine Amtsdauer gewählt und nicht von der vorgesetzten Amtsstelle oder einem politischen Gremium bestimmt und dem Kollegium vor die Nase gesetzt werden. Schulen sind keine Firmen oder Geschäftsbetriebe.