Quantitativer und qualitativer Lehrpersonenmangel
Seit Jahren ächzen die Schulen unter dem Lehrpersonenmangel. «Quantitativer Lehrpersonenmangel» meint, dass man gar nicht alle Stellen an den Schulen besetzen kann. Ein aktuelles Beispiel: Ende Februar kommunizierte der Zürcher Lehrpersonenverband ZLV, auf das kommende Schuljahr hin seien an den Zürcher Volksschulen (erneut) 548 Stellen offen, davon 272 als Klassenlehrpersonen. Es ist nur schwer vorstellbar, dass es gelingen wird, die entsprechende Anzahl Lehrpersonen zu rekrutieren.

Doch selbst dort, wo sämtliche Stellen besetzt werden, ist in Wahrheit nicht überall «Lehrperson» drin, wo «Lehrperson» draufsteht – oder nur teilweise. Sprich: An manchen Schulen unterrichten Laien ohne pädagogische und didaktische Ausbildung. Oder Lehrpersonen erteilen Fächer respektive übernehmen schulische Funktionen, für die sie nicht ausgebildet sind. In letzterem Fall spricht man dann von «qualitativem Lehrpersonenmangel».
Gesuchte SHPs und die Rolle von Kantonen und Gemeinden
Neben Klassenlehrpersonen werden kantonsübergreifend insbesondere Schulische Heilpädagogen/-innen (SHPs) händeringend gesucht. Auch dies ist schon lange so, speziell befeuert durch die Integrative Schule, die eingeführt wurde, obwohl von vorneherein klar war, dass es nicht im Ansatz eine genügend grosse Anzahl von SHPs für das neue Modell geben würde. Doch wen kümmern schon profane Personalfragen, wenn die ideologische Stossrichtung stimmt?
Zwecks Linderung der SHP-Not reduzieren manche Primar- und Sekundarlehrpersonen ihre Unterrichtspensen, um berufsbegleitend ein Masterstudium in Schulischer Heilpädagogik zu absolvieren. Diverse andere Kantone, die sich der Bedeutung dieser zusätzlichen Ausbildungen offensichtlich bewusst sind, unterstützen solche Lehrpersonen finanziell. Dabei zeigen sie sich durchaus kreativ, etwa durch die Übernahme von Studiengebühren, die teilweise Bezahlung der erwähnten Pensenreduktionen oder ein Guthaben an bezahlten Stellvertretungslektionen, wenn Prüfungen oder das Verfassen der Masterarbeit anstehen.
Der Kanton Basel-Landschaft tut bis dato nichts davon und befindet sich dadurch im interkantonalen Vergleich im Hintertreffen. Damit ist der LVB gar nicht einverstanden und hat die Thematik in die entsprechenden Gremien getragen. Aus unserer Sicht sollten Kanton und Gemeinden eine Regelung schaffen, die zu einer einheitlichen und fairen Unterstützung von Lehrpersonen führt, welche berufsbegleitend das SHP-Masterstudium auf sich nehmen. Wie anderswo üblich, kann eine finanzielle Beteiligung der Trägerschaft dann auch an die Bestimmung geknüpft sein, die Arbeitnehmer/-innen für eine gewisse Zeit nach Abschluss des Zusatzstudiums an sich zu binden.
Ebene einzelne Schule
Auch Schulleiterinnen und Schulleiter, so möchte man meinen, müssten ein höchst vitales Interesse daran haben, wenn sich Lehrpersonen an ihrer Schule dazu entscheiden, berufsbegleitend den Master SHP zu meistern. Auf der Hand läge es folglich, den betroffenen Lehrpersonen im Kontext ihrer mehrfachen Belastung proaktiv entgegenzukommen, insbesondere mit Blick auf schulinterne Sitzungen aller Art – zumal diese von einer überwältigenden Mehrheit der LVB-Basis in der Mitgliederbefragung vom Herbst 2022 ohnehin als dominante Belastungsfaktoren beschrieben wurden. Viele Schulleitungen verhalten sich entsprechend – aber eben nicht alle.
Wer berufsbegleitend studierende Lehrpersonen, die mit grossem Aufwand den Mangel an SHPs verringern helfen wollen, schulseitig nicht unterstützen und entlasten mag, betreibt personelles Missmanagement.
Dem LVB sind Fälle bekannt, wo sich zuständige Schulleitungsmitglieder nicht oder nur sehr widerwillig dazu bereit zeigen, die berufsbegleitend studierenden Lehrpersonen schulseitig zu entlasten in Bezug auf Präsenzzeit, Teamarbeit oder Konvente. Pro rata temporis? Vernachlässigbar! Oder wenn es sich nun wirklich nicht gänzlich vermeiden lässt, dann nur unter der Bedingung, dass betroffene Lehrpersonen die Rolle als wiederkehrende Bittsteller/-innen übernehmen. Und das, man möge es sich auf der Zunge zergehen lassen, in Zeiten, wo zig andere Schulen sich die Finger lecken nach ausgebildeten SHPs.
Ein anderes Schulleitungsmitglied, dem eine LVB-Vertretung den Sachverhalt geschildert hatte, bezeichnete ein Verhalten, das von einer fehlenden oder nur zähneknirschenden Bereitschaft zur Entlastung der studierenden Lehrpersonen gekennzeichnet ist, lakonisch als «krasses Missmanagement».
Mögliche Motive und potenzielle Folgen
Es stellt sich die Frage, was in einem Schulleitungsmitglied vorgeht, wenn es sich gegenüber einer Lehrperson, die dazu bereit ist, einen grossen, mehrjährigen Zusatzaufwand zugunsten der Schule auf sich zu nehmen, auf diese Weise verhält. Die folgenden, wenig schmeichelhaften Motive drängen sich auf – und würden alle, sollten sie zutreffen, im Widerspruch zur Eignung für eine leitende Funktion an einer Schule stehen:
- Gleichgültigkeit gegenüber dem akuten SHP-Mangel und damit dem Anspruch betroffener Schülerinnen und Schüler auf professionelle Betreuung.
- Priorisierung diffuser Präsenzvorgaben an der Schule gegenüber der Sicherstellung qualifizierten Personals.
- Persönliche Animositäten gegenüber der Lehrperson.
- Selbstverständnis im Spektrum zwischen «L’école, c’est moi!» und «Mein Wille geschehe!».
Ein anderes Schulleitungsmitglied, dem eine LVB-Vertretung den Sachverhalt geschildert hatte, bezeichnete ein Verhalten, das von einer fehlenden oder nur zähneknirschenden Bereitschaft zur Entlastung der studierenden Lehrpersonen gekennzeichnet ist, lakonisch als «krasses Missmanagement». Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
Zu billig erscheint es überdies, wenn sich Schulleitungsmitglieder ohne ausgeprägten Entlastungswillen ausschliesslich hinter der untätigen Trägerschaft verstecken. Erst recht, wenn dieselben Schulleitungsmitglieder in anderen Bereichen, etwa hinsichtlich Berufsauftrag, sich mit Verweis auf die schulische Teilautonomie über eindeutige Vorgaben hinwegsetzen.
Den betroffenen Lehrperson wäre es jedenfalls nicht zu verübeln, würden sie sich nach Stellen umsehen, wo ihre überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft angemessen wertgeschätzt und honoriert wird. Aus Baselbieter Perspektive im dümmsten Fall in einem anderen Kanton.





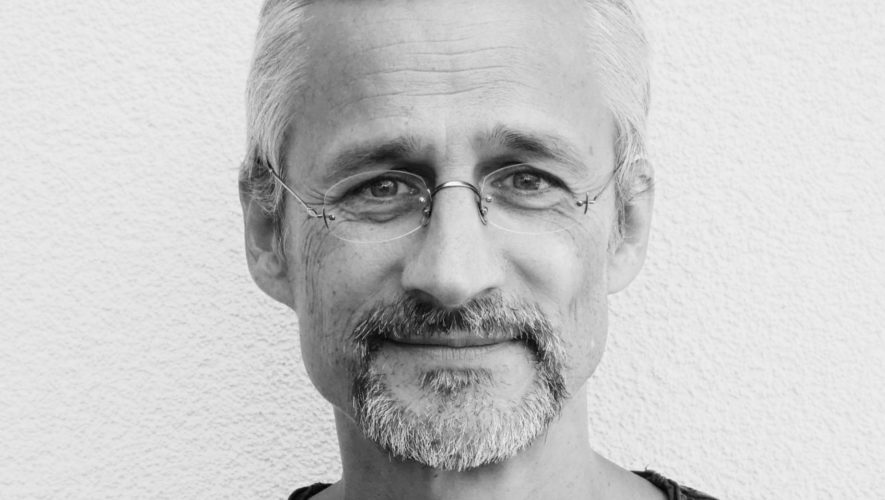
It’s BL…
Wer keine pädagogische oder didaktische Ausbildung hat, ist ein Laie?
Es ist ja nun nicht so, dass ich das hier und heute zum ersten Mal lese.
Aber es beginnt, mich langsam zu nerven.
Ja, auch ich nerve mich, wenn ich von einem Arzt behandelt werde, der keine medizinische Ausbildung hat!
@Gastkommentator, fachlich gelesener Laie: Ihrem Kommentar entnehme ich, dass Sie folgende drei Ausbildungs-Dumping-Inserate begrüssen würden: «Maschineningenieur in 5 Tagen», «Werde Polymechanikerin, ein Wochenende genügt!», «Jetzt: in der Wellnesswoche zum Hausarzt»
Ihre Argumentationstechnik hat Löcher. Sie legen mir Dinge in den Mund. Ich für meinen Teil habe ein Studium in Mathematik, Physik und Astronomie hinter mir, habe promoviert und habilitiert und in den letzten 15 Jahren über 20 Klassen auf das Abitur vorbereitet. Ohne didaktische oder pädagogische Ausbildung, aber mit, wie ich meine, einer Menge Empathie und Fachwissen. Ein Laie halt . . .