Für Donald (2008) stehen die Menschen “in vorderster Linie eines weit zurückreichenden Evolutionsprozesses” (S. 159), dessen Verlauf ihnen ermöglichte, sich von den natürlichen Bedingungen ihrer Existenz in einem Ausmass zu distanzieren, über das andere Lebewesen nicht verfügen. Angetrieben wurde diese Entwicklung zunächst nicht von der Sprache, sondern von der Fähigkeit der Menschen, ihre Aufmerksamkeit zu koordinieren und ihre Intentionen mental zu teilen. Dadurch waren sie in der Lage, “kognitive Verbände” zu bilden, in deren Rahmen sie Wirklichkeit mittels Zeichen und Symbolen repräsentieren konnten.
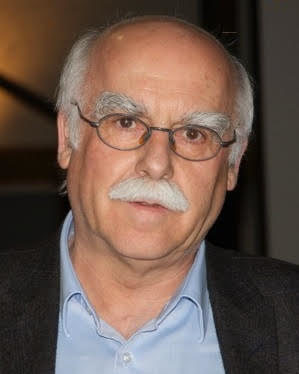
Donald (1991) nimmt an, dass der sprachgebundenen Kultur eine Kultur vorausgegangen ist, die zeichengebunden, aber noch nicht symbolisch war. Der Begriff des Repräsentationssystems dient dem Zweck, dieses vorsprachliche Zeichensystem in die Evolutionsgeschichte des Menschen einzufügen. Wir klären im Folgenden, was Donald unter einem Repräsentationssystem versteht, und stellen dann die drei Repräsentationssysteme vor, die der menschlichen Evolutionsgeschichte gemäss Donald zugrunde liegen.
Repräsentationssysteme
Wir haben bereits im 1. Teil erläutert, wie wir den Begriff der Repräsentation verwenden wollen. Repräsentationen sind an Intentionalität gebunden, wobei individuelle Intentionalität nicht ausreicht, um den Begriff im hier gemeinten Sinn zu definieren. Wir müssen uns gemeinsam auf etwas beziehen können, um uns mittels Zeichen oder Symbolen zu verständigen. Das schliesst nicht aus, dass ein Symbol auch eine persönliche Bedeutung haben kann und Konnotationen aufweist, die von seiner denotativen Bedeutung abweichen. Jedoch beruht die menschliche Kultur auf geteilten Bedeutungen, weshalb wir den Begriff der Repräsentation als vierstellige Relation eingeführt haben: Etwas (ein Zeichen oder Symbol) repräsentiert etwas (ein Ding oder einen Sachverhalt) für mich und dich.
Der Begriff des Repräsentationssystems knüpft an diese Begrifflichkeit an. Repräsentationssysteme sind gemäss Donald (1991) Medien zur Vergegenwärtigung von Wirklichkeit. Sie ermöglichen, Erfahrungen zu konservieren und Wissen zum Zweck der Reflexion bereitzuhalten. Als kollektive Formen der mentalen Handhabung von Wirklichkeit erlauben sie, Gedanken oder Erinnerungen in die Gegenwart zu rufen und mit anderen auszutauschen. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die kommunikative Verständigung über Wirklichkeit erfüllt.

Repräsentationssysteme sind mit spezifischen Formen von Kultur verbunden, so dass der Wechsel eines Repräsentationssystems mit einer Umgestaltung des menschlichen Bewusstseins einhergeht (vgl. Donald, 1991, S. 16). Aber nicht nur die Kultur, sondern auch die neuronale Architektur des Gehirns wird durch den Übergang zu einem neuen Repräsentationssystem beeinflusst. Es findet eine Art Invasion des Gehirns durch kulturelle Errungenschaften statt, in deren Folge die Hirnanatomie durch funktionale Reorganisation für neue Zwecke nutzbar gemacht wird (vgl. Donald, 1997, 2010).
Vier Entwicklungsstufen
Gemäss Donald haben unsere Vorfahren in den vergangenen zwei Millionen Jahren drei Übergänge durchlaufen, die jeweils mit einer fundamentalen Umgestaltung ihrer Repräsentationssysteme, ihrer kognitiven Kompetenzen, ihrer Kultur und ihres Bewusstseins einhergingen (vgl. Donald, 1991, 2004a, 2008, 2012). Den drei Übergängen entsprechen vier Entwicklungsstufen, denen sich folgende Ereignisse zuordnen lassen:
- Die Verzweigung der Entwicklungslinien der Homininen (moderner Mensch und seine Vorfahren) und Schimpansen (inkl. Bonobos) vor ca. 6 Millionen Jahren.
- Das Erscheinen der Gattung Homo vor ca. 2 Millionen Jahren.
- Das Erscheinen von Homo sapiens vor ca. 200’000 Jahren.
- Die “kognitive Revolution” bzw. der “grosse Sprung nach vorn” vor ca. 40’000 Jahren.
Als Ausgangspunkt nimmt Donald (1991) eine kognitive Konstellation an, die auf aktuelle Ereignisse und die Erinnerung von Episoden beschränkt war. Das Verhalten der Frühformen des Menschen war situationsbestimmt und reaktiv. “Aus den Augen, aus dem Sinn” war die Devise, die ihre Lebensweise bestimmte. In ihrem Bewusstsein dominierte die Gegenwart, deren Horizont weder räumlich noch zeitlich nennenswert überschritten werden konnte.
Die Möglichkeiten der Reflexion waren damit beschränkt. Lebewesen, die lediglich über ein episodisches Gedächtnis verfügen, sind nicht in der Lage, sich komplexe Sachverhalte zu vergegenwärtigen oder darüber nachzudenken (vgl. Donald, 1991, S. 159ff.). Es fehlt ihnen ein Medium zur anhaltenden Repräsentation von Wirklichkeit. Selbst höhere Tiere, wie heutige Schimpansen, leben in einer episodenartigen Wirklichkeit, die von aktuellen Ereignissen bestimmt wird, denen sie kognitiv nur beschränkt entfliehen können.
Mimetische Repräsentation
Als ersten Übergang postuliert Donald (1991) einen mimetischen Repräsentationsmodus, der auf körperlicher und motorischer Basis funktioniert. Gebärden, Mimik, Gestik, Blicke, Ausrufe, Pfiffe und weitere nonverbale Äusserungen sind Formen der aktiven Körpernutzung zum Zweck der Repräsentation von Ereignissen. Die Mimesis beruht auf der Umsetzung von wahrgenommenen Aspekten der Wirklichkeit in eigenes Verhalten. Insofern stellt sie eine analoge (nicht-symbolische) Form der Repräsentation dar, die auf Anschauung, Ähnlichkeit, Assoziation und Metaphorik beruht. Mit einer in der Semiotik geläufigen Unterscheidung haben wir es mit ikonischen Zeichen zu tun (vgl. Eco, 1977, S. 60ff.).
Tomasello (2009, 2020) spricht von “ikonischen Gesten” und “Pantomimen”. Verstehen kann man diese nur, wenn man in der Lage ist, intentionale Handlungen aus dem Kontext, in dem sie normalerweise vollzogen werden, herauszulösen. Nur so können sie eine kommunikative (geteilte) Bedeutung erlangen. Der neuronale Mechanismus, der dabei in Anspruch genommen wird, ist derselbe, der auch dem Beobachtungslernen zugrunde liegt, wie es von Albert Bandura (1976) beschrieben wird. Beobachtetes Verhalten wird so angeeignet, dass es in eigenes Verhalten umgesetzt werden kann.

Die Nutzung des Körpers zu darstellenden und kommunikativen Zwecken ist daran gebunden, dass die Bereiche, die miteinander in Beziehung gesetzt werden, gleichzeitig im Bewusstsein präsent sind. Ohne ein funktionierendes Arbeitsgedächtnis ist dies nicht möglich. Zudem ist ein Minimum an Kreativität gefordert, da den motorischen Äusserungen eine übertragene Bedeutung zugewiesen wird. Das zeigen Gebärdensprachen, die noch heute wesentlich darauf beruhen, dass die Hände, der Mund und die Gesichtsmuskulatur zur Bildung von ikonischen Zeichen genutzt werden. Auch wenn wir uns in einem fremden Land, dessen Sprache wir nicht beherrschen, verständigen wollen, setzen wir unseren Körper auf kreative Weise ein, indem wir gestikulierend auf unser Anliegen aufmerksam machen.
Zwei weitere Voraussetzungen
Die Mimesis ist an zwei weitere Voraussetzungen gebunden, die beide in Beziehung zu den Exekutivfunktionen stehen. Erstens ist ein erhebliches Mass an Körperbeherrschung erforderlich, ohne die die Motorik nicht für kommunikative Zwecke genutzt werden kann. Auch wenn wir an die Lautsprache denken, auf die wir noch näher eingehen werden, ist es ausgeschlossen, gesprochene Laute für kommunikative Zwecke zu nutzen, wenn deren Artikulation nicht vollständig kontrolliert werden kann. Nichtmenschliche Primaten sind unfähig, in diesem Ausmass über ihren Körper zu verfügen.
Tatsächlich vermögen Menschen ihren Körper auf mannigfaltige Weise einzusetzen, wie Zirkusartisten, Tänzerinnen, Musiker, Schauspieler oder Schlangenmenschen zeigen. Auch spielende Kinder geben davon reichlich Anschauungsmaterial. In einem gewissen Alter üben sie sich unermüdlich in sensomotorischen Fertigkeiten wie auf einem Bein hüpfen, über ein Seil springen, Purzelbäume schlagen, das Gleichgewicht halten, einen Ball an die Wand schlagen, Grimassen schneiden etc.
Zweitens erfordert die Mimesis den willentlichen Zugriff auf Gedächtnisinhalte. Die eben genannten Beispiele für kindliche Spiele zeigen, dass die Übung motorischer Fertigkeiten daran gebunden ist, dass eine vollzogene Handlung aktiv in Erinnerung gerufen werden kann, denn nur so lässt sich der motorische Ablauf verfeinern. Wie Donald (2006) deutlich macht, sind Tiere weder in der Lage, willentlich auf ihr Gedächtnis zuzugreifen, noch ihr Verhalten gezielt zu verbessern. “Nur Menschen reflektieren ihr eigenes Verhalten und modifizieren es entsprechend” (S. 16 – eigene Übersetzung).
Mimesis als Humanspezifikum
Donald (1991) verwendet den Begriff der Mimesis, weil verwandte Begriffe wie Nachahmung, Imitation oder Mimikry seiner Meinung nach das aktive und kreative Moment der körperlichen Repräsentation nicht deutlich genug zum Ausdruck bringen. Michael Tomasello (1993b) stimmt Donald im Urteil über die Bedeutung der körperlichen Darstellung von Wirklichkeit für die Evolution des Menschen zu, meint aber, dass mit den Begriffen der Nachahmung und Imitation das aktive und kreative Moment durchaus abgedeckt wäre, denn nur Menschen seien fähig, durch Nachahmung zu lernen.
Die Haltung Tomasellos lässt sich mit einem Gedanken von Helmuth Plessner stützen. Plessner (1948/2003) betont, dass Tiere aufgrund ihrer “zentrischen” Existenzform Verhaltensweisen anderer Lebewesen zwar mitvollziehen, aber nicht im echten Sinn nachahmen können. Echte Nachahmung setzt Distanz zum eigenen wie zum fremden Verhalten voraus; nur aufgrund dieser Distanz kann dem beobachteten Verhalten intentional eine Bedeutung zugeschrieben werden. Die «Fernstellung des Menschen zu sich» (S. 398), die den Tieren verwehrt ist, bildet gemäss Plessner die Basis für echte Nachahmung. Als Merksatz formuliert: «Nachäffen kann nur der Mensch, nicht der Affe» (S. 396).
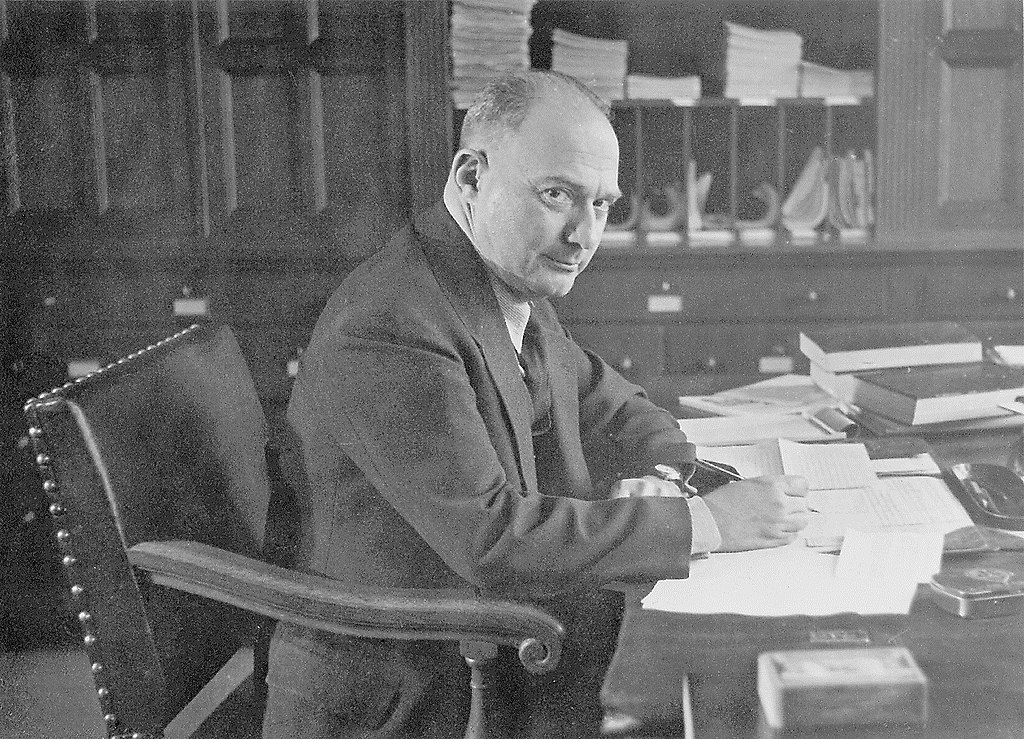
Mit dem Begriff der Mimesis will Donald aber nichts anderes zum Ausdruck bringen, denn der willentliche Gebrauch der Motorik zum Zweck der Darstellung und Kommunikation von Wirklichkeit stellt ein Humanspezifikum dar (vgl. Donald, 2007b, S. 216ff.). Wie auch Gunter Gebauer und Christoph Wulf (1998) betonen, wird mit Mimesis eine Fähigkeit bezeichnet, “die den Menschen vom Tier unterscheidet” (S. 435).
Spiegelneuronen
Die Existenz eines mimetischen Repräsentationssystems hat durch die Entdeckung der so genannten Spiegelneuronen im prämotorischen Cortex eine unerwartete Bestätigung gefunden. Spiegelneuronen werden aktiviert, wenn man sieht, wie jemand anderer eine Bewegung ausführt. Dabei werden dieselben Neuronen aktiv, wie wenn man die Bewegung selbst ausführen würde. Das motorische System wird also nicht erst aktiv, wenn das sensorische System seine Leistung erbracht hat, sondern ist bereits während des Wahrnehmungsprozesses aktiv. Wie der italienische Neurophysiologe Giacomo Rizzolatti, der Entdecker der Spiegelneuronen, in einem mit Corrado Sinigaglia (2008) verfassten Buch schreibt, gestatten die Spiegelneuronen unserem Gehirn, “die beobachteten Bewegungen mit unseren eigenen in Beziehung zu setzen und dadurch deren Bedeutung zu erkennen” (S. 14).

Der Begriff der Spiegelneuronen ist etwas unglücklich gewählt, da ein Spiegel eine Passivität vortäuscht, die es im Gehirn gerade nicht gibt. Zudem findet auf der neurophysiologischen Ebene keine Spiegelung statt, die in irgendeiner Weise der Reflektion von Lichtstrahlen gleichkäme. Mit dem Begriff der Resonanz, der von Rizzolatti ebenfalls verwendet wird, kommt besser zum Ausdruck, worum es geht. Auch der Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs (2013) zieht diesen Begriff vor und nennt das Gehirn insgesamt ein Resonanzorgan, “dessen rhythmische Oszillationen durch interne ebenso wie externe Synchronisierungen eine fortwährend erneuerte Kohärenz zwischen Organismus und Umwelt herstellen” (S. 181).
Indem Nervenzellen in den motorischen Arealen unseres Gehirns in Schwingung versetzt werden, wenn wir eine Bewegung wahrnehmen, wird die sensorische Information mit unserem motorischen Wissen verbunden, was uns ermöglicht zu verstehen, welche Bedeutung die wahrgenommene Bewegung hat. Mit “Wissen”, “Verstehen” und “Bedeutung” sind allerdings keine bewussten oder reflektierten Vorgänge gemeint, sondern rein neurale Abläufe. Diese bilden eine wesentliche Grundlage dessen, was wir Nachahmung nennen. Sowohl bei Affen wie bei Menschen “führt der Anblick von Akten, die von anderen ausgeführt werden, zur unmittelbaren Einbeziehung jener motorischen Areale, deren Aufgabe die Organisation und Durchführung dieser Akte ist” (Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, S. 131).
Imitationslernen
Eine Besonderheit der menschlichen Spiegelneuronen liegt darin, dass wir fähig sind, die Intentionen des Verhaltens anderer zu erkennen. Beim Lernen durch Nachahmung spielt dies eine wichtige Rolle, da eine beobachtete Verhaltensweise besser gelernt wird, wenn wir erkennen, mit welcher Absicht sie ausgeführt wird. Das Verstehen anderer als intentionale Wesen ist entscheidend für das kulturelle Lernen, wie es von Michael Tomasello, Ann Cale Kruger und Hilary Horn Ratner (1993) beschrieben wird. “Kinder, die verstehen, dass andere Personen intentionale Beziehungen zur Welt unterhalten, die ihren eigenen intentionalen Beziehungen ähnlich sind, können die Möglichkeiten nutzen, die andere Individuen sich ausgedacht haben, um ihre Ziele zu erreichen” (Tomasello, 2002, S. 96). Ab etwa neun Monaten sind Kinder dazu in der Lage; sie vermögen andere als intentional Handelnde zu erkennen und auf diese Weise aus der Beobachtung von deren Verhalten zu lernen.
Die Fähigkeit, anderen Menschen Gedanken, Absichten, Wünsche und weitere mentale Zustände zuzuschreiben, ermöglicht es, nicht nur von anderen Personen, sondern auch durch andere Personen zu lernen. Schimpansen sind zu dieser Art von Lernen nicht in der Lage.
Mit etwa drei bis vier Jahren erkennen sie zudem, dass Menschen über mentale Kapazitäten wie Wissen, Glauben oder Erwartungen verfügen, dank derer sie sich von den aktuellen Gegebenheiten der Wirklichkeit absetzen können. Sie vermögen Handlungen zu erklären, indem sie berücksichtigen, was Menschen denken oder wollen, auch und gerade, wenn ihnen bewusst ist, dass die handelnde Person von falschen Annahmen ausgeht. Sie sind zu dem fähig, was in der Entwicklungspsychologie Mentalisierung genannt wird, ein Ausdruck, der zumeist als Synonym für den Begriff der Theory of Mind gebraucht wird, dem wir im 1. Teil unseres Beitrags begegnet sind. Die Fähigkeit, anderen Menschen Gedanken, Absichten, Wünsche und weitere mentale Zustände zuzuschreiben, ermöglicht es, nicht nur von anderen Personen, sondern auch durch andere Personen zu lernen. Schimpansen sind zu dieser Art von Lernen nicht in der Lage (vgl. Call & Tomasello, 2008; Tomasello, 1996).
Flucht aus dem Nervensystem
Die Erfassung der Absichten und Einstellungen anderer ist eine wesentliche Voraussetzung für die Nutzung motorischer bzw. nonverbaler Äusserungen zum Zweck der Kommunikation. Anders lässt sich kaum erklären, wie eine gemeinsame Referenz durch Koordination der Aufmerksamkeit und Teilung der Intentionen hergestellt werden kann. Wie Donald (1998) schreibt, bildet die Mimesis die erste vollumfänglich intentionale Form der Repräsentation von Wirklichkeit in der Evolution des Menschen. Die Mimesis ermöglichte unseren Vorfahren “nicht weniger als eine Flucht aus der Isolation des Nervensystems der Wirbeltiere” (Donald, 2000, S. 34 – eigene Übersetzung).
Donald, der diese Metapher verschiedentlich verwendet, bringt damit zum Ausdruck, dass Gedanken und Erinnerungen solange im Gehirn eingeschlossen bleiben, wie es nicht möglich ist, sie anderen auf verständliche Weise mitzuteilen. Dank des ersten, noch rudimentären Repräsentationssystems, das die Mimesis darstellt, ist es den Menschen gelungen, dem Gefängnis ihrer Gehirne zu entfliehen und ihre Gedanken mit anderen zu teilen.
Eine erste Form von Kultur
Daraus ist eine archaische Form von Kultur entstanden. Die mimetische Kultur war “die erste Kulturform, in der mentale Repräsentationen geteilt wurden, wenn auch auf vage und ungenaue Weise” (Donald, 2005, S. 293 – eigene Übersetzung). “Vage” und “ungenau” deshalb, weil der Mimesis linguistische Merkmale wie eine Grammatik und ein Lexikon fehlen. Die mimetische Kultur ist ans Konkrete und Anschauliche gebunden; die Menschen sind noch kaum zu Abstraktionsleistungen fähig.
Bei aller “Flucht aus dem Nervensystem” (Donald) spielt das biologische Gedächtnis in einer mimetischen Kultur weiterhin eine wesentliche Rolle. Denn es sind noch keine Notationssysteme wie die Schrift oder Aufzeichnungsgeräte wie eine Bildkamera verfügbar, die für die externe Speicherung von Erfahrungen genutzt werden könnten. Eine partielle Abhilfe bieten Mnemotechniken, die wie die Mimesis auf einer sensomotorischen Basis funktionieren. Bei der so genannten Loci-Methode (auch “Gedächtnispalast” genannt) werden die zu erinnernden Inhalte in den fiktiven Räumen eines imaginären Hauses ‘abgelegt’, wo sie bei Gelegenheit wieder ‘aufgenommen’ werden können (vgl. Draaisma, 1999, S. 48ff.). Bei freien Vorträgen spielt diese Technik noch heute eine wesentliche Rolle.
Als kulturelles Medium bestimmt die Mimesis in der Tat noch heute unser Leben, wie im Theater, im Kino, in der Oper, im Sport etc. Auch handwerkliche und andere Fertigkeiten wie Tanz oder Radfahren werden zu einem grossen Teil über Prozesse der Beobachtung und Imitation des Beobachteten tradiert. Man denke an die bei uns fest verankerte Institution der Berufslehre. Obwohl die Sprache der kulturellen Entwicklung des Menschen einen enormen Schub verlieh, ist die Mimesis “nach wie vor die elementare Äusserungsform, die uns zu eng verbundenen, stammesartigen Gruppen zusammenschweisst” (Donald, 2008, S. 273f.). Gemäss Tomasello (2014) kommt die mimetische Form der Kommunikation immer dann ins Spiel, wenn wir gemeinsame Aktivitäten, die situativ verankert sind und situativ kontrolliert werden, unternehmen.
Kultur der Mündlichkeit
Der zweite Übergang im Schema von Donald (2008) führte unsere Vorfahren in die Kultur der Mündlichkeit, “die bis vor kurzem die universelle Form menschlicher Gesellschaften war” (S. 273). Die gesprochene Sprache ermöglicht eine weit effizientere Form der Repräsentation von Wirklichkeit als das nonverbale System der Mimesis. Wörter sind die ersten echten Symbole, die nicht mehr auf einer analogen (bildhaften), sondern auf einer arbiträren Basis funktionieren.
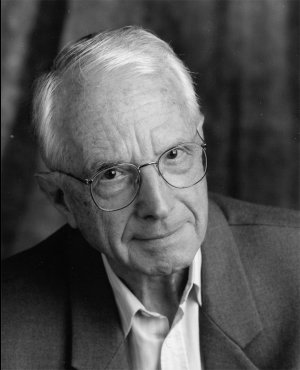
Die natürliche Form, in der sich Sprache artikuliert, sind Erzählungen, weshalb die gesprochene Sprache zu einer narrativen Darstellung der Wirklichkeit führt. Auch die Denkform einer oralen Kultur ist narrativ. Es ist daher nicht abwegig, wenn Donald (2004b) in Geschichten das Herz und die Seele der menschlichen Kultur sieht und den Menschen in seinem Kern einen Geschichtenerzähler nennt. Darin trifft er sich nicht nur mit dem britischen Psychologen Robin Dunbar (2008), der das Archetypische der menschlichen Kultur im Erzählen von Geschichten (eingeschlossen religiösen Geschichten) sieht, sondern auch mit dem Schweizer Kulturpsychologen Ernst Boesch (2005), der den Menschen unumwunden als Homo narrator bezeichnet.
Der Mensch als Mythenerzähler
Entsprechend seinem Verständnis des Menschen als Geschichtenerzähler, steht die orale Kultur für Donald nicht in erster Linie mit der Verfeinerung von Werkzeugen oder der Tradierung von handwerklichen Fertigkeiten in Verbindung, sondern mit der Entstehung von Mythen, weshalb er auch von einer mythischen Kultur spricht (vgl. Donald, 1991, S. 201ff.). Das mag erstaunen, ist aber nachvollziehbar, wenn wir bedenken, dass eine mimetische Kultur wenig Möglichkeiten bietet, um eine zusammenhängende Darstellung der Wirklichkeit zu geben, während genau dies dank der Sprache möglich wird. Erzählungen schaffen Kohärenz; sie geben einer Abfolge von Ereignissen einen inneren Zusammenhalt.
Mythen sind vorwiegend Ursprungserzählungen, die von der Herkunft des Menschen, der Götter, der Welt und des Kosmos handeln. Insofern bilden sie kulturelle Bindemittel, die einer Gemeinschaft helfen, ein Wir-Bewusstsein zu entwickeln. Es gibt keine Kultur, die nicht über Erzählungen verfügte, “die dazu beitragen, ihre Gruppe als kohärentes Gebilde über die Zeit hinweg zu definieren” (Tomasello, 2009, S. 302). Noch heute erbringen Mythen diese Leistung. Denken wir an Mythen, die Nationalstaaten zu ihrer geschichtlichen Legitimation nutzen (wie der Rütlischwur oder Wilhelm Tell im Falle der Schweiz), Mythen, mit denen sich Firmen eine corporate identity geben (wie im Falle der Gründungsgeschichte von Ford oder Renault), oder Mythen, die Religionsgemeinschaften mit dem Jenseits verbinden (wie die Schöpfungsgeschichte im Falle von Juden- und Christentum).

Während die maximale Grösse einer Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig kennen, gemäss der so genannten Dunbar-Zahl bei rd. 150 Individuen liegt (vgl. Dunbar, 2008, S. 410ff.; Gamble, Gowlett & Dunbar, 2016, S. 17ff.), ermöglichen Mythen, die Gruppengrösse massiv zu erweitern, indem die Ursprungserzählung eine Einheit stiftet, die auch fremde Menschen miteinschliesst (vgl. Harari, 2013, S. 38ff.). Plötzlich sind nicht mehr nur diejenigen Brüder und Schwestern, die von denselben Eltern abstammen, sondern auch diejenigen, die denselben Gott, Guru oder politischen Führer verehren oder derselben Partei angehören (vgl. Vowinckel, 1995). Der Rütlischwur als Nationalmythos der Schweiz beruht auf genau dieser Logik: “Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr”, wie uns Friedrich Schiller im Wilhelm Tell in den Mund legt (Zweiter Aufzug, Dritte Szene).
Orales Memorieren
Anders als die mimetische Repräsentationsform ermöglichen Erzählungen eine minimale Form von externer Speicherung menschlicher Erfahrungen. Erinnerungen, die durch permanente Reaktivierung in sprachlicher Form wachgehalten werden, lassen sich konservieren, wenn auch ohne grosse Präzision und ohne Garantie auf Vollständigkeit. Geht es um kulturell bedeutsames Wissen, sind es spezialisierte Individuen wie Schamanen, Priesterinnen, Barden oder professionelle Geschichtenerzähler, die als lebendige Speicher die Verantwortung für dessen Bewahrung tragen. Durch orale und gesangliche Rezitation halten sie in Erinnerung, was sonst schnell vergessen ginge.

Interessant ist, wie dabei dem Körper eine wichtige Rolle zukommt. Walter Ong (1987) weist in seiner klassischen Studie Oralität und Literalität darauf hin, dass das orale Gedächtnis eine bedeutende somatische Komponente aufweist. Handbewegungen, Gesten, Tanzen, Stampfen mit den Füssen, Hin- und Herbewegen des Oberkörpers etc., zumeist untermauert von rhythmischer Musik (Trommeln, Zupfen von Saiteninstrumenten), begleiten den Vortrag des Rezitators oder Barden. Gesprochen oder gesungen wir unter vollem Einsatz des Körpers. Das orale Wort existiert “niemals in einem rein verbalen Zusammenhang, wie dies beim geschriebenen Wort der Fall ist” (S. 71). Das gilt vermutlich auch für das Lernen, das in einer oralen Kultur kein stilles Memorieren ist, sondern ein lautes Wiederholen dessen, was die Lehrperson rezitierend vorträgt. Man denke an die Praxis des Auswendiglernens, wie sie an Koranschulen noch heute weltweit üblich ist.
Rhythmus
Wie der Altphilologe Eric Havelock (1991) herausstreicht, sind orale Kulturen auch rhythmische Kulturen. Der Rhythmus unterstützt das Lernen, indem er dem Lerngegenstand eine repetitive Struktur gibt. Orale Memorierhilfen wie Metren, Verse, Reime, Phrasen und Floskeln sowie die Schematisierung von Personen und Handlungen geben der Sprache eine getaktete Struktur, die Affinitäten zur Musik aufweist. Die Fähigkeit, wiederkehrende akustische Vorgänge in körperliche Bewegungen umzusetzen, ist ein mimetischer Vorgang, auch wenn dabei nicht der visuelle, sondern der auditive Sinn involviert ist (vgl. Donald, 1991, S. 186f.).

Menschen sind fähig, Rhythmen auch über körperliche Vibrationen aufzunehmen, wie die taubstumme Schlagzeugerin Evelyn Glennie eindrücklich zeigt. Rhythmen durchdringen unseren Körper; sie fahren uns geradezu wörtlich in die Glieder. Wie die Mimesis generell ist die Imitation von Rhythmen ein sinnesübergreifendes Phänomen. Wir vermögen mit allen Muskeln unseres Körpers, über die wir eine willentliche Kontrolle haben, Rhythmen zu erzeugen – mit den Fingerspitzen, den Händen, den Füssen, dem Kopf, den Lippen, den Zähnen, den Augen, dem Rumpf oder dem ganzen Körper. Die Kompetenz, den Körper synchron zu einem rhythmischen Muster zu bewegen, ist auch die Grundlage für die Fähigkeit des Menschen, allein oder gemeinsam mit anderen zu tanzen.
Drang zur Kooperation
Wie verschiedene Studien zeigen, handelt es sich auch beim Rhythmus und beim Tanz um grossenteils humanspezifische Phänomene. Zwar gibt es bei einigen Tierarten Ansätze spontanen rhythmischen Verhaltens, wie beispielsweise Hämmern auf Baumwurzeln bei Schimpansen oder Trommeln auf die eigene Brust bei Gorillas, und einige Tiere vermögen wahrgenommene Tonfolgen zu imitieren, wie beispielsweise Singvögel, Papageien, Grillen und Frösche. Die Fähigkeit, aus komplexen auditorischen Wahrnehmungen rhythmische Muster zu extrahieren und in eigenes Verhalten zu übersetzen, findet sich in der Tierwelt jedoch selten und nur ansatzweise (vgl. Fitch, 2012; Kotz, Ravignani & Fitch, 2018). Und was bei Tieren gänzlich fehlt, ist die synchrone Befolgung von Rhythmen, wie dies Menschen beim Paar- oder Gruppentanz tun. Schimpansen und Gorillas trommeln allein, und auch die “Gesangs-Duette” von Singvögeln oder Papageien erfolgen nicht simultan, sondern wechselweise.

Wer schon einmal kleine Kinder beim Musizieren beobachtet hat, weiss, dass die synchrone Einstellung auf einen Rhythmus erst nach längerem Üben gelingt. Sich beim Musizieren in den Verlauf eines Stücks einzufügen, indem man aufeinander hört, ist Kindern solange nicht möglich, wie sie nicht zu kollektiver Intentionalität fähig sind. Da Schimpansen dazu grundsätzlich nicht in der Lage sind, ist nicht zu erwarten, dass sie gemeinsam Musik machen können. Gleiches gilt für das Tanzen. Zu Solotänzen und einem formlosen Nebeneinandertanzen sind Kinder zwar schon früh in der Lage, aber erst mit der Fähigkeit zu geteilter Intentionalität vermögen sie auch wirklich gemeinsam zu tanzen. Wie der Kognitionspsychologe Tecumseh Fitch (2012) vermutet, könnte dem rhythmischen Verhalten des Menschen ein allgemeiner Drang zur Kooperation zugrunde liegen, d.h. eine Motivation, Erfahrungen, Aktivitäten und Emotionen mit anderen zu teilen, “die so typisch ist für unsere Spezies und so ungewöhnlich in der Natur” (S. 86 – eigene Übersetzung).
Symboltechniken
Vor etwa 40’000 Jahren erfolgte ein weiterer Schritt in der Evolution des Menschen. Jared Diamond (2003) spricht von einem “grossen Sprung nach vorn” (S. 46), Yuval Noah Harari (2013) von einer “kognitiven Revolution” (S. 9ff.). Charakteristisch für diesen dritten Übergang sind verbesserte Werkzeuge, die Herstellung von Schmuck und anderen Kunstgegenständen, Musikinstrumente, Felsmalereien, Grabbeigaben und – was sehr wahrscheinlich ist – Bestattungsrituale und Totenkulte.

Für Merlin Donald (1991) liegt die Essenz dieser dritten Etappe auf dem Weg zum modernen Menschen in einer Revolution der Symboltechniken. Das ausschlaggebende Moment bildet die Möglichkeit, Gedächtnisinhalte extern zu speichern. Donald spricht von einer Differenz der Hardware: “Waren die ersten beiden Übergänge von neuer biologischer Hardware abhängig, insbesondere von Veränderungen im Nervensystem, ist der dritte Übergang von einer äquivalenten Veränderung der technologischen Hardware abhängig, insbesondere von externen Speichergeräten” (S. 274 – eigene Übersetzung).
Voraussetzung war die Entwicklung einer Schriftsprache sowie vergleichbarer Notationssysteme, wie Piktogrammen, Diagrammen, Zahlen, Formeln, Tabellen, Karten, Münzen etc. (vgl. Donald, 1991, S. 279ff., 306ff.). Auch Bauwerke können als Symboltechniken verstanden werden. So deutet Donald die megalithische Anlage von Stonehenge als externalisiertes Gedächtnis, da vermutlich Sternkonstellationen in materialisierter Form repräsentiert wurden. Die Anlage stellt gemäss Donald genauso ein Speichermedium dar “wie die synoptischen Muster im Gehirn” (Donald & Andreassen, 2007, S. 80 – eigene Übersetzung).
Sehen statt Hören
Wesentlich für die verschiedenen Techniken der “Auslagerung von Erinnerungen” (Donald, 2008, S. 273) ist ihr visueller Charakter. Im Unterschied zur Lautsprache, die an den Hörsinn gebunden ist und den akustischen Raum nicht verlassen kann, wird eine Schriftsprache nicht gehört, sondern gesehen. Damit findet eine Ausrichtung des Bewusstseins auf das Auge statt. Anders als das Ohr lässt das Auge Abstand nehmen und die Wirklichkeit auf Distanz halten. Während wir als Hörende vom Gehörten gleichsam in Beschlag genommen werden, vermögen wir uns als Sehende der Aufdringlichkeit der Wirklichkeit zu erwehren. Dabei kommt uns zu Hilfe, dass Sprechen und Hören simultane Geschehnisse sind, während zwischen Schreiben und Lesen Zeit verstreicht.
In einer schriftlosen Kultur ist das Selbstbewusstsein der Menschen noch wenig gefestigt. Die Menschen sehen sich einer Welt gegenüber, von der sie sich angesprochen fühlen. Die Natur erscheint ihnen eher wie ein Du als wie ein Es. So spekulativ seine Analysen auch sein mögen, Julian Jaynes (1988) nimmt an, dass die Menschen der frühen Hochkulturen in einer Geistesverfassung lebten, die es ihnen verunmöglichte, aus sich selbst heraus zu handeln. Noch das christliche Menschenbild zeugt von dieser Konstellation, insofern es den Menschen als “Hörer des Wortes” (Rahner) bestimmt. “Der Glaube kommt aus dem Hören”, heisst es im Römerbrief (Röm 10, 17), “Wer Ohren hat, der höre” im Matthäusevangelium (Mt 13, 9) und “Selig sind, die nicht sehen und doch glauben” im Johannesevangelium (Joh 20,29). Da sich Gott offenbart, indem er den Menschen anspricht, ist der Mensch nach christlicher Auffassung nur dann wirklich Mensch, wenn er auf Gottes Wort hört und seinen Geboten gehorcht.
Wo nicht mehr Mund und Ohr, sondern Hand und Auge das Menschenbild bestimmen, avanciert das Ich zum Zentrum des Handelns. Nicht zufällig operieren aufklärerische Systeme mit visuellen Metaphern.
Mit der Akzentverschiebung vom Hören zum Sehen wird das menschliche Selbstbewusstsein gestärkt. Wo nicht mehr Mund und Ohr, sondern Hand und Auge das Menschenbild bestimmen, avanciert das Ich zum Zentrum des Handelns. Nicht zufällig operieren aufklärerische Systeme mit visuellen Metaphern. Schon Platons Höhlengleichnis schildert den Weg der Erkenntnis als befreienden Aufstieg aus dem Dunkeln ans Licht. Der Mensch wandelt sich vom Hörenden zum Sehenden, der nicht mehr glauben, sondern wissen soll, indem er die Wahrheit im «natürlichen Licht» (Descartes) seiner Vernunft erschaut. Die niederen Sinne geraten in den Sog der Unvernunft und verfallen dem Hörensagen.
Dekontextualisierung des Bewusstseins
Die befreiende Kraft des Sehens erstreckt sich auch auf die Sprache. Während wir uns der Suggestivkraft gesprochener Worte nur schwer entziehen können, vermögen uns geschriebene Worte nicht im gleichen Ausmass gefangen zu nehmen. Es spricht daher einiges dafür, dass die Menschen erst in dem Moment ein Bewusstsein der Sprache erlangten, als sie des Schreibens und Lesens mächtig wurden (vgl. Olson, 1994, S. 258ff.).
Während wir die Sprache beim Reden gleichsam überhören, da sprachliche Ungenauigkeiten oder Unklarheiten durch parasprachliche und nonverbale Informationen sowie Hinweise aus der aussersprachlichen Situation laufend korrigiert werden, gilt dies im Falle des Schreibens und Lesens nicht. Ein Text muss sich selber genügen, d.h. alles enthalten, was es braucht, um ihn zu verstehen. Mag sein, dass es im Einzelnen einer hermeneutischen Auslegung bedarf, um seinen Sinn zu eruieren, die Informationen, die dazu benötigt werden, müssen aber ihrerseits im Text enthalten sein oder diesem entnommen werden können. Wer schreibt oder liest, wird regelrecht gezwungen, über Sprache nachzudenken.

Trotzdem vermag eine Schriftsprache per se noch keinen kulturellen Wandel zu erzeugen. Noch in der frühen Neuzeit wurden Schriftstücke nicht als Medien zur externen Speicherung von Erinnerungen wahrgenommen. Bücher wurden zwar als Gedächtnisstütze genutzt, waren aber noch lange in die direkte mündliche Kommunikation eingebunden. Weit über das 16. Jahrhundert hinaus dominierte in Europa eine Kultur der Mündlichkeit (vgl. Wenzel, 1995). Erst die Verbreitung von Schriftdokumenten dank der Erfindung der Druckerpresse durch Johannes Gutenberg führte allmählich zur Alphabetisierung der Gesellschaft (vgl. Füssel, 1999). In deren Folge konnte das Potential ausgeschöpft werden, das in der Schrift und anderen Symboltechniken liegt: ihre Nutzung als extrazerebrale Gedächtnisspeicher. In Analogie zum Begriff des Engramms als physiologischer Gedächtnisspur im Gehirn spricht Donald (1991, 2010) von Exogrammen als medialen Speichermedien ausserhalb des Gehirns.
Objektivierung der Gedanken
Damit konnte die Schriftsprache zum Katalysator der Wissenschaft werden. Zwar ist nicht anzunehmen, dass sich das wissenschaftliche Denken allein der Schriftsprache verdankt. Jedoch ist schwer vorstellbar, wie die Menschen den Schritt zu einem wissenschaftlichen Weltbild ohne die Leistungen der Schrift und anderer Symboltechniken hätten vollziehen können. Zu diesen Leistungen gehören die dekontextualisierte Beschreibung von Wirklichkeit, der Anspruch auf die Vollständigkeit der Darstellung repräsentierter Sachverhalte, die Reflexion auf die Form der Repräsentation von Wirklichkeit und die Objektivierung der Gedanken im Medium der Sprache.
Tatsächlich wurden sich die Menschen durch Reflexion der Sprache auch der Eigenart ihrer Gedanken bewusst. Wer in der Lage ist, sich Gedanken ‘vor Augen zu führen’, indem er sie ‘zu Papier bringt’, vermag sein Denken zu objektivieren. Er kann seine Ideen und Überlegungen auf Folgerichtigkeit und Konsistenz überprüfen und allfällige Widersprüche im Argumentationsgang ausräumen. Während sich in einer oralen Kultur logische Schnitzer kaum aufdecken lassen, fällt dies in einer literalen Kultur leichter. Schriftlich können wir unsere Gedanken auch einfacher mit anderen teilen und der Kritik aussetzen, indem wir sie im wörtlichen Sinn aufschreiben.
Logik
Allerdings ermöglicht nicht jede Art von Schrift diese Leistung. Wenn wir dem Sprachwissenschaftler Christian Stetter (1997) folgen, dann ist das formale Denken ein Produkt der Alphabetschrift. Es scheint kein Zufall zu sein, dass die Logik als System des korrekten deduktiven Schliessens in der Schriftkultur der griechischen Antike entstanden ist, insbesondere bei Aristoteles, während sich im Kulturkreis der chinesischen Schrift weder eine Grammatik noch eine formale Logik entwickelt haben. Als Notationsform für Sprachlaute (Phoneme) und nicht für Ideen (wie im Falle von Ideogrammen, Piktogrammen und Hieroglyphen) löst das Alphabet die Sprache aus den kontextuellen Bedingungen ihrer Nutzung heraus und macht sie zu einer Wirklichkeit eigener Art. Das Bildhafte, das der mimetischen Repräsentationsform zugrunde liegt, ist aus der phonetischen Schrift gänzlich getilgt.
Damit sich ein logischer Formalismus entwickeln konnte, genügte die Alphabetschrift gleichwohl noch nicht. Wie verschiedene Studien zeigen, ist die Entstehung der deduktiven Logik wesentlich durch die Praxis der dialogischen Auseinandersetzung im Rahmen der attischen Demokratie befördert worden (vgl. Kapp, 1965; Vernant, 1982). Wenn in einer Debatte unter Gleichen eine Entscheidung herbeigeführt werden muss, dann bildet die logisch abgesicherte Korrektheit eines Gedankenganges ein potentes Mittel, um einen Gegner zur Änderung seiner Meinung zu bewegen (vgl. Dutilh Novaes, 2015). Insofern war die griechische Polis Geburtshelferin der deduktiven Logik. Auch wenn dies im ersten Moment verwundern mag, kann es angesichts der fundamentalen Sozialität des Menschen nicht wirklich erstaunen, dass selbst die Logik eine soziale Grundlage aufweist. Zum Instrument des korrekten individuellen Denkens wurde die Logik erst durch die Verinnerlichung der sozialen Praxis des Argumentierens.
Im Rahmen der Ausarbeitung logischer Regeln hat auch die Negation, die in Form der Verneinung durchaus schon der mündlichen Sprache verfügbar ist, ihren Status als formales Denkwerkzeug erhalten. Tiere können nicht nein sagen; selbst Schimpansen “fehlt der Sinn fürs Negative” (Plessner, 1928/2003, S. 340 – im Original hervorgehoben). Sie können zwar zwischen zwei sich ausschliessenden (konträren) Gegensätzen wählen (z.B. anwesend vs. abwesend; gefährlich vs. ungefährlich; geniessbar vs. ungeniessbar), aber nicht Tatsachen oder Sachverhalte negieren oder in ihr kontradiktorisches Gegenteil verkehren (vgl. Bohn, Call & Völter, 2020).
Das Bild einer Pfeife ist in der Tat keine Pfeife, die man rauchen kann, was sich aber nicht bildlich, sondern nur sprachlich ausdrücken lässt.
Solange sie lediglich über die Fähigkeit zur mimetischen Repräsentation verfügten, waren auch unsere Vorfahren zur logischen Negation noch nicht fähig. Das folgt daraus, dass sich bildhafte Repräsentationen mit anschaulichen Mitteln nicht verneinen lassen. Man denke an das Bild “La trahison des images” (Der Verrat der Bilder) von René Magritte, auf dem eine Pfeife dargestellt ist, wobei uns Magritte durch einen Schriftzug zu verstehen gibt: “Ceci n’est pas une pipe!” Das Bild einer Pfeife ist in der Tat keine Pfeife, die man rauchen kann, was sich aber nicht bildlich, sondern nur sprachlich ausdrücken lässt.
Theoretische Kultur
Das Denken, das bei der mimetischen und der narrativen Repräsentationsform in die Darstellung der Wirklichkeit eingebunden ist, vermag sich dank der Regeln der formalen Logik von der Wirklichkeit abzulösen. Das historische Ereignis bildete die Trennung zwischen Denken und Anschauung zur Zeit der griechischen Vorsokratiker (Thales, Parmenides, Zenon, Heraklit u.a.). “Die Anschauung verliert überall an Autorität, der Mensch entfernt sich in zunehmendem Masse von der Natur, die ihn umgibt” (Feyerabend, 2009, S. 253f.). Mithilfe der Logik konnten erstmals Theorien formuliert werden, die dem Menschen einen Zugriff auf die Wirklichkeit erlaubten, der rein rational begründet ist. Donald (1991) belegt die dritte Stufe der Evolutionsgeschichte des Menschen daher mit dem Begriff der theoretischen Kultur, nicht weil Theorien in einer Schriftkultur von Anfang an bestimmend gewesen wären, sondern weil sie deren Wesenskern ausmachen.
Mithilfe der Logik konnten erstmals Theorien formuliert werden, die dem Menschen einen Zugriff auf die Wirklichkeit erlaubten, der rein rational begründet ist.
Auch wenn die Griechen die Möglichkeit zur Bildung wissenschaftlicher Theorien erkannten, hat der Übergang zur theoretischen Kultur erst in den vergangenen rd. 200 Jahren an Fahrt aufgenommen, und abgeschlossen ist er noch lange nicht. Sobald sich ein wissenschaftliches Bewusstsein einmal etabliert hat, scheint dessen Überlegenheit allerdings kaum noch in Frage gestellt zu werden. Was im Zentrum der oralen Kultur steht, wird nun der Kritik unterzogen: der Mythos. Das mythische Denken wird als subjektiv und anthropomorph diskreditiert, kann aber aufgrund seiner Inkompatibilität mit dem theoretischen Denken genauso wenig überwunden werden wie das mimetische Denken.
Der Mensch als Hybridwesen
Die drei Übergänge in der Entwicklungsgeschichte des Menschen haben zu Verschiebungen im menschlichen Bewusstsein geführt, aber nicht so, dass die Denkformen der früheren Stufen ausser Kraft gesetzt worden wären. Ein Grundprinzip der Evolution lautet, dass Anpassungen, die sich bewährt haben, erhalten bleiben. Was einmal funktioniert, wird nicht ohne Grund aufgegeben.
Anders als die Stufen der kognitiven Entwicklung von Piaget (1974), die einer integrativen Logik folgen, insofern die jeweils höhere Stufe die tiefere in sich aufnimmt, handelt es sich bei Donalds Stufen der Anthropogenese um eine Abfolge, die einer Kaskade gleichkommt. Wie bei einem künstlich angelegten Wasserfall das Wasser über mehrere Stufen nach unten fliesst, ist die Evolutionsgeschichte des Menschen in mehreren Schritten erfolgt, ohne dass die überwundenen Stufen verlorengegangen wären. Für unser kognitives System sind die episodischen, mimetischen und narrativen Muster der Repräsentation noch genauso relevant wie die jüngste Errungenschaft des theoretischen Denkens.
Da jede Entwicklungsstufe auch heute noch in ihre kulturelle Nische eingepasst ist, enthält eine moderne Kultur “Spuren aus jeder früheren Phase der kognitiven Evolution” (Donald, 2008, S. 273). Für unser Verständnis des Menschen heisst dies, dass das Bewusstsein des modernen Menschen eine mosaikartige Struktur aus Elementen der verschiedenen Phasen der Menschheitsgeschichte bildet. Menschen sind kognitive Hybride, wie Donald (2004c) formuliert, gleichermassen angepasst an ihre natürliche wie an ihre kulturelle Umwelt.
Ausblick
Der entscheidende Schritt in der Evolution des Menschen liegt in der Nutzung von Zeichen und Symbolen zur intentionalen und geteilten Repräsentation von Wirklichkeit. Ermöglicht wurde dieser Schritt durch die Exekutivfunktionen, deren anatomische Basis ein stark erweiterter präfrontaler Cortex beim Menschen bildet. Den Anlass zur Ausschöpfung des Potentials der Exekutivfunktionen gaben die veränderten Lebensbedingungen unserer Vorfahren, insbesondere die wachsende Komplexität ihrer Sozialbeziehungen.
Indem es ihnen gelang, aus dem Gefängnis ihres Nervensystems auszubrechen, errangen unsere Vorfahren den grössten evolutionären Vorteil des Menschen, nämlich “den Beschränkungen der Evolution zu entfliehen”.
Die grosse Wasserscheide in der Evolution des Menschen bildet daher “nicht die Entstehung der Sprache, sondern die vorausgehende Bildung kognitiver Verbände”(Donald, 2008, S. 266). Wie Merlin Donald in Übereinstimmung mit Michael Tomasello und anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern feststellt, sind wir als Menschen “bis in die Struktur unseres Bewusstseins hinein” (S. 309) soziale Wesen. Ohne die Symbiose, die Gehirn und Kultur in der Evolutionsgeschichte des Menschen eingegangen sind, liessen sich die kognitiven Leistungen, zu denen heutige Menschen fähig sind, nicht erklären. Indem es ihnen gelang, aus dem Gefängnis ihres Nervensystems auszubrechen, errangen unsere Vorfahren den grössten evolutionären Vorteil des Menschen, nämlich “den Beschränkungen der Evolution zu entfliehen” (Gopnik, 2010, S 16).
Im abschliessenden 4. Teil meines Beitrags werde ich mich mit der Frage beschäftigen, welche Konsequenzen sich aus dem Nachweis der symbiotischen Verbindung von Gehirn und Kultur für das pädagogische Menschenbild und die pädagogische Praxis ergeben.




