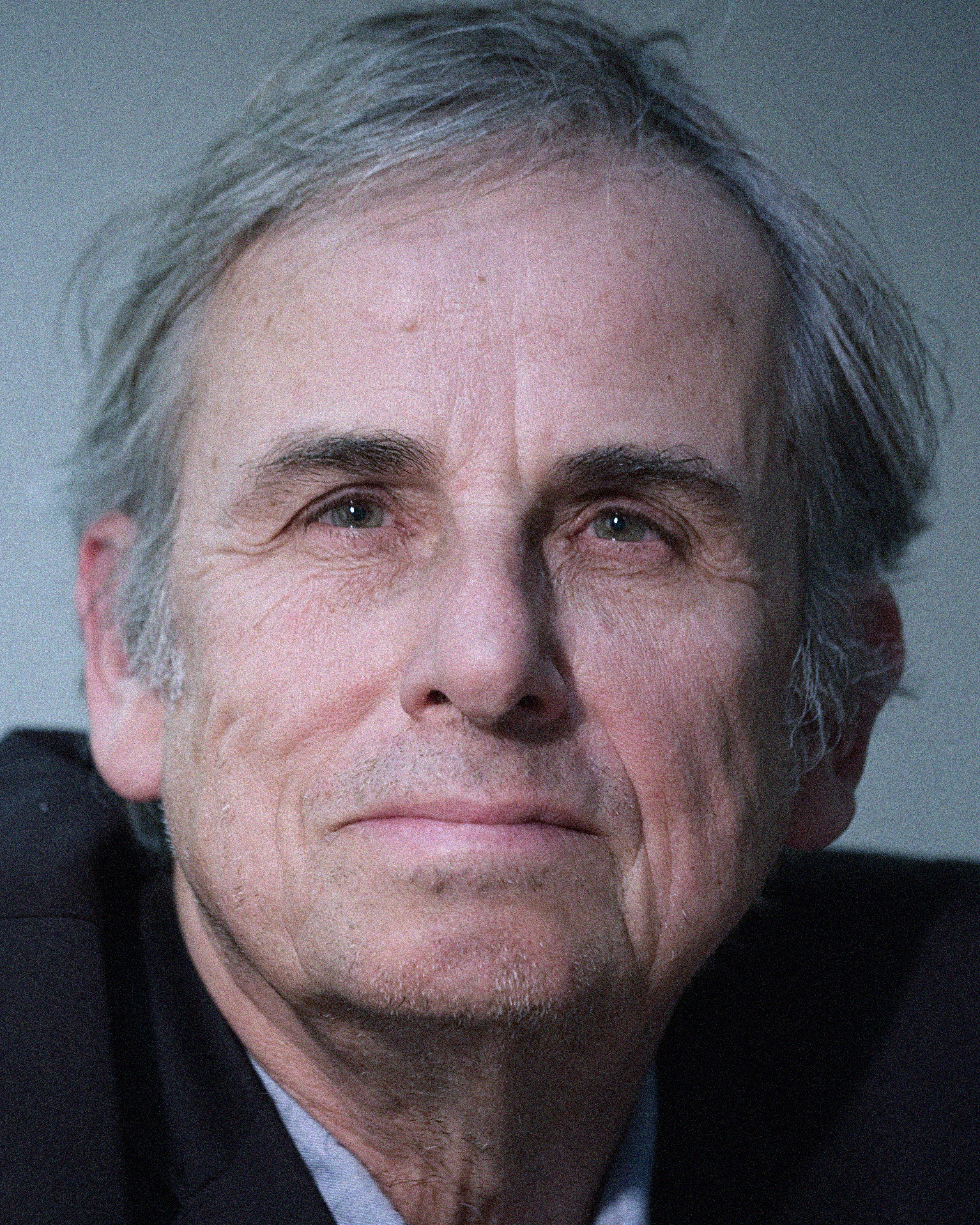Im Jahre 1977 wurde ich als Primarlehrer patentiert und begann unmittelbar mit dem Unterrichten. Ich gehörte zu einer linken Lehrergeneration, welche die Schule, ja mehr noch, die Gesellschaft durch den Unterricht verändern wollte.
Die verschiedenen Kollegien, in die meine linken Freunde und ich eintraten, empfingen uns bei weitem nicht mit offenen Armen. Das lag unter anderem an der Tatsache, dass sich der Pillenknick erstmals bemerkbar machte, was zu Klassenschliessungen führte. Um eine grössere Arbeitslosigkeit der frisch ausgebildeten Lehrkräfte zu vermeiden, verfügte die Regierung ein Verbot der Überstunden für die alteingesessenen Lehrkräfte, von denen einige bis an die 38 Lektionen unterrichteten.
Die Schule war reformbedürftig
Schon allein aus dieser Tatsache lässt sich ermessen, wie es damals um die Unterrichtsqualität bestellt war. Die Schule, in die wir damals eintraten, hatte zweifellos einen grossen Reformbedarf, sowohl inhaltlich wie auch strukturell. Die Lehrkräfte waren praktisch unkündbar, die Unterrichtsqualität spielte keine Rolle, der Unterricht wurde in den seltensten Fällen pünktlich begonnen. Die Vorsteher waren Verwalter, die Lehrkräfte Einzelkämpfer. In den einzelnen Kollegien gab es zwar flache Hierarchien, aber undefinierte Machtstrukturen, was bedeutete, dass sich die lautesten, ältesten und impertinentesten jeweils durchsetzten.
Strukturell war die Schule sehr selektiv. 60% der Schüler besuchten im Kanton Bern in der Oberstufe das Realniveau (das damals noch Primarschule hiess). Die Sekundarschüler wurden von besser ausgebildeten Lehrkräften mit höheren Löhnen unterrichtet.

Bild: Heini Stucki
Frontalunterricht, ellenlanges Abschreiben oder Langeweile prägten nicht selten den Unterricht. Strukturell war die Schule sehr selektiv. 60% der Schüler besuchten im Kanton Bern in der Oberstufe das Realniveau (das damals noch Primarschule hiess). Die Sekundarschüler wurden von besser ausgebildeten Lehrkräften mit höheren Löhnen unterrichtet.
Wir traten an, um dies alles zu verändern.
Wir traten an, um dies alles zu verändern. Gruppenunterricht, Projektunterricht (neudeutsch: kooperatives Lernen), französische Chansons, Schülerzeitungen, unkonventionelle Theaterstücke, partizipierende Elternabende prägten unser praktisches Handeln. Vor allem aber waren wir offen für Neues. Wir probierten vieles aus, wobei auch einiges schief ging. Und – das muss man ehrlicherweise festhalten – wir hatten des Öfteren auch jenen missionarischen Diktus drauf, der heute bei den Promotoren der aktuellen Bildungsreformen festzustellen ist.
Geprägt durch die «Rote Fabrik in Biel» – das Staatliche Lehrerseminar
Das Lehrerseminar in Biel galt bei vielen Bildungspolitikern als eine Art «Rote Fabrik». Dort lehrte uns eine junge Generation von Aeblianern (Hans Aebli, Grundformen des Lehrens. Stuttgart: Klett 1961) moderne Ansätze der Pädagogik und des Problemlösens. Einer der wichtigsten Begleiter war der Bieler Methodiklehrer und spätere SP-Parteipräsident Hans Müller, der damals die «autogestion» vertrat und in gewisser Weise die Idee der teilautonomen Schule vorwegnahm.

Natürlich waren wir auch politisch aktiv. Wir traten nicht den altehrwürdigen Lehrerverbänden bei, die zu jener Zeit noch an die 98% der Lehrkräfte zu ihren Mitgliedern zählten, sondern schlossen uns den neu gegründeten VPOD-Lehrergruppen an und betrachteten uns als Teil der Arbeiterbewegung.

Initiativen und Proteste
Mit Initiativen zur Abschaffung der Selektion, mit Vorstössen zur notenfreie Schule oder der Reduktion der Kleinklassen und vieles mehr sorgten wir für den nötigen politischen Druck. Unterstützt wurden wir von den linken Parteien. In den SP-Sektionen gab es zahlreiche Bildungskommissionen, Ausdruck dessen, welchen Wert der Bildung damals innerhalb der linken Bewegung eingeräumt wurde. Wie hoch die Bedeutung der Bildung heute in der Linken ist, kann man in Zürich sehen. Dort wurde der freisinnige Stadtrat Filippo Leutenegger erst kürzlich mit der Stimmenmehrheit der linken Parteien in die Bildungsdirektion «strafversetzt».
Und auch wenn wir vielen Irrtümern aufgesessen waren, wenn sich manches als utopisch und wenig praktikabel erwiesen hatte, wenn es zwischendurch auch gar viel Chaos gab, wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir mit anderen fortschrittlichen Kräften der Gesellschaft die Schule positiv veränderten. Der Unterricht in der Volksschule wurde freier, kreativer und lebendiger. Die Schule wurde durchlässiger, der Unterricht besser. Es gelang in einem relativ kurzen Zeitraum ein erstaunlicher kultureller Wandel.
Meine Sympathien für Ernst Buschor

1995 begann der Zürcher Bildungsdirektor Ernst Buschor den Bildungssektor nach betrieblichen Grundsätzen umzupflügen. Die sogenannte wirkungsgeführte Verwaltung (New Public Management) verfolgte die Trennung von strategischer und operativer Führung, wobei die einzelnen Verwaltungseinheiten eine Leistungs- und Kostenvorgabe erhielten. Mit diesen Leitlinien schuf Buschor die teilautonomen Schulen – eine einschneidende Änderung, gegen die sich vor allem ältere Lehrer zur Wehr setzten.
Gegen das Einzelkämpfertum
Obwohl der «Reformturbo», wie Ernst Buschor oft genannt wurde, 2002 mit der Ablehnung seines Volksschulgesetzes gebremst wurde, war sein Einfluss immens. Das lag auch daran, dass viele von uns linken Lehrkräften diesen Reformen eine gewisse Sympathie abgewinnen konnten. Zwar war die Schule, wie Herr Buschor sie antraf, längst nicht in Lethargie versunken, wie er es der Öffentlichkeit weismachen wollte. Aber wir sahen die immer noch bestehenden Mängel unseres Schulsystems und all die Widerstände, die wir auch bei kleinsten Veränderungswünschen überwinden mussten oder sogar an ihnen scheiterten.
Die Gründung der pädagogischen Hochschulen
Bis dahin hatte jeder Lehrer im Grunde seine eigene Schule geführt. Diesem Einzelkämpfertum sagte Buschor den Kampf an, was durchaus in unserem Sinne war. In den teilautonomen Schulen sollten die Lehrer gemeinsam pädagogische Schwerpunkte setzen, Leitbilder und Jahresprogramme erarbeiten, und wenn sie Probleme mit ihren Klassen hatten, diese im Team besprechen. Buschor kritisierte das behördliche Weisungsgehabe und verlangte die Abtretung von möglichst viel Autonomie an die einzelnen Einheiten des Bildungswesens. Neben der Universitätsreform zählt die Einrichtung einer pädagogischen Hochschule zu Buschors grössten Leistungen. Die zuvor verstreuten Seminarien wurden an einem Ort zusammengefasst; die Straffung der Weiterbildungsangebote ermöglichte es den Lehrern, von einer Schulstufe auf eine andere zu wechseln. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Buschor die Aufwertung des Lehrerberufs anstrebte, was die Vertreter dieses Standes aber nicht wahrhaben wollten, wir hingegen als positiv erachteten.
Langfristig jedoch hatten seine Ideen eine grosse Wirkung, vor allem – und das war uns nicht bewusst – weil vieles bereits im globalen Trend lag.
Die Ideen für seine Reformen holte sich der Bildungsdirektor öfters im Ausland. Nach einem kalifornischen Vorbild startete Buschor das Schulprojekt 21. Vorgesehen waren – notabene schon damals – der Einsatz von Computern im Unterricht, altersdurchmischte Lerngruppen sowie die sogenannte Immersion beim Fremdsprachenunterricht: Mathematik zum Beispiel wird auf Englisch unterrichtet. Zum Verhängnis wurde diesem Mann die fehlende Praxisnähe und das Tempo, mit dem er vieles auf einmal durchsetzen wollte. Langfristig jedoch hatten seine Ideen eine grosse Wirkung, vor allem – und das war uns nicht bewusst – weil vieles bereits im globalen Trend lag.
Bis heute ein Zankapfel: 1996 führte der Kanton Bern die geleiteten Schulen ein.
1996 wurden im Kanton Bern die geleiteten Schulen eingeführt. Die Schulkommissionen traten mit der Zeit einen grossen Teil ihrer Kompetenzen an die Schulleitung ab oder sie wurden sogar ganz abgeschafft und durch die örtliche Schuldirektion ersetzt. Wir empfanden dies als eine dringend notwendige Professionalisierung.
Das Zusammenwirken linker Reformpolitik und liberaler Modernisierung führte zu einer besseren Schule

Das Zusammenwirken linker Reformpolitik und liberaler Modernisierung hatte dazu geführt, dass unsere Schule zu Beginn der HarmoS-Debatte und der Einführung des Lehrplans 21 in einer recht guten Verfassung war, was sich z. B. auch in der Bewältigung der Migrationswelle der späten 90-er-Jahr manifestierte. Niemand von uns wollte wieder zurück in die Schule der sechziger Jahre.
PISA sahen wir unkritisch
Die PISA-Tests sahen auch wir als einen Schritt in eine datenbasierte Forschung, welche gezielt die Schwächen und Stärken unseres Bildungssystems erkunden halfen. Und die Tatsache, dass das teuerste Schulsystem der Welt es fertigbringt, dass ein Fünftel der Schüler nicht einmal die tiefsten Standards beim Lesen erreicht, also praktisch als Illetristen aus der Schulpflicht entlassen wurden, konnte man ja nicht einfach wegdiskutieren.
Ich erinnere mich noch gut an ein Podium, auf welchem ich 2004 mit dem linken Gymnasiallehrer und (wie ich) Vorstandsmitglied der VPOD-Lehrergruppe, Guy Lévy, die Klingen kreuzte. Ich plädierte damals für die geleiteten Schulen, für Feedbackkultur, für Standards und für die teilautonome Schule. Mein Gegenpart Lévy kritisierte meine Haltung als «Neoliberalismus» und mich als Steigbügelhalter einer ökonomistischen Bildungspolitik. Pikant: Heute wehre ich mich gegen die Auswüchse eines auf Output getrimmten ökonomistischen Bildungssystems, während mein damaliger Kontrahent Guy Lévy, als Chefbeamter der bernischen Erziehungsdirektion sämtliche von ihm kritisierten Reformen umsetzt. Was ist also hier passiert?
Wir waren uninformiert und naiv

Die Kritik, eine Art Steigbügelhalter einer ökonomistischen Bildung zu sein, muss ich heute teilweise akzeptieren. Die linken Lehrkräfte, welche ihren Beruf liebten und ihm treu blieben, hatten bei weitem nicht den wissenschaftlichen Background, über den die frühen Kritiker der nun einsetzenden Bildungsreformen verfügten. Wir wussten nichts von den Bildungsvorgaben der OECD, kannten die Agenda der PISA-Promotoren nicht. Wir waren uninformiert und ziemlich naiv. Vor allem aber waren wir intensiv mit unserem Unterricht beschäftigt und sahen die kommenden Signale des bevorstehenden Umbaus höchstens in Form immer umfassender werdenden bürokratischen Bevormundung.
Wir nutzten die pädagogischen Freiheiten: Werkstatt-Unterricht, Individualisierung, selbstgesteuertes Lernen gehörten zu unseren Methoden.
In den 90-er Jahren genossen wir ziemlich viele Freiheiten, die wir auch nutzten, um neue Unterrichtsmethoden auszuprobieren. Werkstattunterricht, konstruktivistische und individualisierende Lernmethoden, standen bei uns hoch im Kurs. Anfangs der 90-er Jahre erhielt ich sogar Besuch des jungen Pädagogikprofessors Kurt Reusser, der mit einer Delegation aus Zürich anreiste, um unseren Unterricht zu begutachten. Er war begeistert.
Uns störte zunehmend, dass praxisfremde Promotoren dieser neuen Lehrmethoden, dieselbigen stets überhöhten und nach dem gleichen Muster vorantrieben: „new train“ versus „old train“, „zeitgemäss“ versus „traditionell“.

Ironischerweise verliefen unsere Wege danach in entgegengesetzter Richtung. Während Professor Reusser seine Ideen eines individualisierenden und schülerzentrierten Unterrichts in seinen universitären Räumen weiterentwickelte und mit dutzenden von Fachartikeln untermauerte, erkannten wir als Praktiker die Grenzen dieser neuen Lernmethoden. In Brennpunktschulen mit einem hohen Prozentsatz unterprivilegierter Kinder funktionieren sie eben nur bedingt und schon gar nicht, wenn man sie quasi apodiktisch als alleiniges Lernverfahren installieren will. Wir gingen nach dem Prinzip «try and error» vor.
Uns störte zunehmend, dass praxisfremde Promotoren dieser neuen Lehrmethoden, dieselbigen stets überhöhten und nach dem gleichen Muster vorantrieben: „new train“ versus „old train“, „zeitgemäss“ versus „traditionell“.
Für uns galt das Prinzip: Die Schule ist gut, wenn sie gebildete Schüler entlässt. Und sie ist nicht gut, wenn sie das nicht tut.
Für uns galt das Prinzip: Die Schule ist gut, wenn sie gebildete Schüler entlässt. Und sie ist nicht gut, wenn sie das nicht tut. Der Weg dorthin war für uns keine ideologische Frage, sondern ein Mittel zum Zweck. Unter der Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie Alter, kognitivem Entwicklungsstand, Klassendynamik oder der Komplexität des Unterrichtsstoffes, nahmen wir uns das Recht heraus, selber darüber zu entscheiden, mit welchem didaktischen Konzept wir die Lernziele am besten erreichen.
Deswegen waren wir gezwungen, gewisse Lehrmethoden zu überdenken, in Klassen mit einem hohen Migrantenanteil manchmal sogar ganz zurückzufahren, weil das Chaos zu gross wurde. Wir waren aber immer interessiert an den Ergebnissen unserer Arbeit. So führten wir schon in den frühen 80-er Jahren Schülerbefragungen über unseren Unterricht durch, was mir einmal sogar einen Rüffel des Schulleiters einbrachte. Unsere Outputfaktoren waren ausserdem die Anzahl Lehrabschlüsse, die Leistungsrückmeldungen aus den Gymnasien, die Lehrabbruchquote oder die Rückmeldungen der Eltern.
Der PISA-Schock 2002: Ein inszeniertes Drama

Obwohl wir grundsätzlich – wie oben angemerkt – gegenüber dem PISA-Test offen waren, begannen wir uns nun ob der wilden Rezeption die Augen zu reiben. Rundherum „hysterisierten“ Journalisten, Politiker und Funktionäre den doch eher simplen Test als «das Armageddon der öffentlichen Bildung». Die PISA-Resultate schienen die Schweiz einer narzistischen Kränkung auszusetzen. Wir nahmen zwar die schlechten Leseleistungen eines Teils unserer Schüler zur Kenntnis, weil sie einen schon lange vorhandenen Verdacht nun auch wissenschaftlich bestätigten. Wir stellten aber auch die Frage, ob das, was die Wirtschaftsorganisation OECD (sie ist die Auftraggeberin dieser Testreihe) da so alles gemessen hat, überhaupt dasjenige ist, von dem wir wollen, dass unsere Schüler das in der Schule lernen: Zum Beispiel Ankreuztests zu bestehen, anstatt möglichst kluge Aufsätze zu schreiben. Die Presse hyperventilierte und sprach von einem Bildungsschock. Die mediale Panik war angerichtet. Absurde Länderrankings ohne tiefgehende Analysen folgten, ein beispielloses Schulbashing setzte nun ein.
Nach der Lektüre des Weissbuches änderte ich meine Haltung
Die EDK reagierte 2004 umgehend mit einem Weissbuch, in welchem sie vorschlug, das Schulsystem auf die PISA-Test-Formate umzustellen. Von da an entwickelte sich vieles zwangsläufig: Wer eine Vergleichbarkeit will, braucht Standards. Wer Standards hat, muss diese überprüfen und benötigt Tests, und wer diese Tests will, der braucht zu erwerbende Kompetenzen, «deren genaue Vermessung in ausgewiesenen Kompetenzstufen die zweifelhaften oft fehlerhaften Benotungen der Schüler durch die Lehrer ablösen und auf eine genaue empirisch zu erfassende Basis stellen sollten» (Originalzitat Reusser «Kompetenzorientierte Zeugnisse»). Deshalb sollte auch ein neu zu formulierender Lehrplan sich an Kompetenzen und nicht mehr an Inhalten orientieren.

Diese im Weissbuch formulierten Absichten wurden – weitgehend unbemerkt – Teil der Harmos-Vereinbarungen, die 2008 zur Abstimmung gelangten. Und erstmals begannen wir – die linken Lehrkräfte an der Basis – uns mit dem theoretischen Hintergrund dieser Reformbestrebungen zu beschäftigen, unter anderem auch aufgescheucht durch ein Interview mit dem Berner Pädagogikprofessor Walter Herzog im „Bund“. Dieser meinte dort: «Weil die SVP Harmos ablehnt, glaubt die Linke, es handle sich um ein fortschrittliches Projekt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine ausserordentlich problematische wenn nicht sogar reaktionäre Vorlage. » (Bund 20.2008).
Zusammen mit einer Handvoll linker Lehrkräfte, vor allem Bieler Gymnasiallehrer, widersetzte ich mich erstmals offen einer Bildungsvorlage. Diese Positionierung wurde von vielen linken Weggefährten mit Unverständnis zur Kenntnis genommen.
Heute, im Jahre 2018 stehen die Zeichen auf Umau. Kompetenzrorientierung, Vermessungswahn, Top-Down-Reformen, Ökonomisierung des Bildungswesens und eine regelrechte «Neomanie» (Professor Roland Reichenbach) haben die Volksschule im Griff.
Die im Weissbuch 2004 formulierten Ziele wurden in der Harmos-Abstimmung in 13 Kantonen gutgeheissen. Acht lehnten die Vorlage ab. Es ist allerdings unbestritten, dass ein Grossteil der Stimmenden keine Ahnung von gerade diesem brisanten Teil des Gesamtpakets hatte. Für die meisten war immer noch der Harmonisierungsgedanke das ausschlaggebende Motiv.
Heute, im Jahre 2018 stehen die Zeichen auf Umau. Kompetenzrorientierung, Vermessungswahn, Top-Down-Reformen, Ökonomisierung des Bildungswesens und eine regelrechte «Neomanie» (Professor Roland Reichenbach) haben die Volksschule im Griff.
Als am 28. Juni 2013 der Lehrplan 21 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war die Verblüffung greifbar, umfasste es doch auf 550 Seiten 463 Kompetenzen unterteilt in 4754 Konpetenzstufen.
Die Lehrplanverantwortlichen wirkten euphorisch: So sprach die damalige Erziehungsdirektorin des Kantons Zürich, Regine Aepli, von einem eindrücklichen Pionierwerk und der grössten « Erneuerung seit der Einführung der Schulpflicht» (TA 14.12.13). Der neue Lehrplan 21 – und das beförderte natürlich die gute Laune der Verantwortlichen – ging wie geplant – weit über die ursprünglich formulierten Zielsetzungen der Harmonisierung hinaus.
Im Prinzip geht es darum, den Unterricht von der zu erreichenden Performanz her zu denken und zu gestalten. Prof. Kurt Reusser
Und so kreuzten sich die Wege des Praktikers und des Professors wieder. Kurt Reusser inzwischen Leiter des wissenschaftlichen Beirates des Lehrplanprojekts lieferte die bildungspolitische Begründung für diese offensive Interpretation des Lehrplanauftrags: «Im Prinzip geht es darum, den Unterricht von der zu erreichenden Performanz her zu denken und zu gestalten (vgl. Lersch, 2007, 2010). Lehrpersonen stehen vor der Aufgabe, Stoffe und Inhalte so auszuwählen und als Lerngelegenheiten zu gestalten, dass erwünschte lehrplanbezogene Kompetenzen daran erworben oder gefestigt werden können.» (Kompetenzorientierte Zeugnisse –Recherche im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Oktober 2013) Und den verdutzten Lehrkräften im Lande, die immer noch von einem Harmonisierungsprojekt ausgingen,prognostizierte er: «Dazu gehören Eingangs-, und Diagnosetests, Checklisten (Indikatoren) zu den jeweiligen Kompetenzrasterfeldern, die Arbeit mit Portfolios, Lerngespräche, Selbstbeurteilungen, Administrationstools etc. Evident ist, dass die Erstellung von Kompetenzrastern und die Arbeit mit ihnen mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden sind. »
Er selber tingelte mit einer Vortragsreihe mit dem Titel: «Steuerung durch den Lehrplan 2» durch die Universitäten und PHs der Schweiz.
Nun stellte sich plötzlich das Demokratieproblem
Von da an gab es kein Halten mehr. Kompetenzraster, neue Beurteilungsformen, Bewertung überfachlicher Kompetenzen, 7-seitige Beobachtungsbögen im Kindergarten, flächendeckende Teste in der Nordwestschweiz, „Change Management“-Papiere im Thurgau, Umbau des Hauswirtschaftsunterrichts, neue Fremdsprachendidaktik, Classwalk-Through-Kontrollen der Schulleitungen, neue Inklusionskonzepte…
All dies sollte nun möglichst rasch und möglichst “topdown” installiert werden. Hearings ersetzten gründliche Vernehmlassungen, kritische Lehrkräfte wurden unter Druck gesetzt. Und die von mir damals befürworteten neuen Leitungsstrukturen kamen jetzt voll zum Tragen und wendeten sich gegen die Kritiker.
Damit stellte sich – wie schon bei «Bologna» – ein grundsätzliches Demokratieproblem.
Wem gehörte die Volksschule?

In den Augen von Professor Walter Herzog und vieler meiner Kolleginnen und Kollegen wurde nun das „Öffentlichkeitsprinzip“ in Frage gestellt. „Man will aus der Öffentlichen Schule eine Staatsschule machen“, kritisierte Herzog. Die Lehrkräfte würden zu Vollzugsbeamten degradiert, die Bevölkerung habe zu all dem nichts mehr zu sagen.
Daraufhin besannen sich viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auf ihre verfassungsmässigen Rechte. Sie ergriffen Volksinitiativen, welche eine Abstimmung über den Lehrplan 21 forderten. Dabei kam es allerdings zu schwierigen Allianzen. In vielen Kantonen waren es SVP-nahe oder sogar klerikale Kreise, welche mit einem grossen Effort solche Volksbegehren trugen.
Der endgültige Bruch mit den «etablierten» Linken
Unsere Unterstützung für einen Teil der Lehrplaninitiativen machte mich in den Augen meiner ehemaligen Weggefährten endgültig zum „Renegaten“.
Guilt by association
„Guilt by association“ heißt im Englischen die Verunglimpfung über das Herstellen von Nähe. Dagegen gibt es keine Schiedsstelle, die man anrufen kann.

Nun, bei aller Aufregung muss man nüchtern festhalten, dass es in der Geschichte der politischen Auseinandersetzungen immer wieder zu sogenannten unheiligen Allianzen gekommen ist. Die säkularen Franzosen sprechen hier mit etwas weniger Furor von «alliance contre nature». Ich erwähne das, weil in Frankreich ein ähnlicher Kampf um die Bildung tobt, allerdings auf einem ganz anderen intellektuellen Niveau. Die sogenannten „pédagogistes“ sind Anhänger der Kompetenzorientierung. Viele von ihnen sind von der Reformpädagogik geprägt und auch eher links ausgerichtet. Ihnen gegenüber stehen die „anti-pédagogistes“ die sich für einen klassischen Unterricht einsetzen. Sie nennen sich „républicains“ und unterteilen sich in zwei Lager: Einerseits stark links ausgerichtete Persönlichkeiten wie Frau Badinter, anderseits „les nouveaux philosophes“ wie Fienkelkraut, die sehr rechtslastig sind. Es gibt übrigens noch eine weitere Gruppe, zu der ich mich hingezogen fühle: Die «didacticiens», die einen Mittelweg suchen. In Frankreich käme es niemandem in den Sinn, Frau Badinter aufgrund dieser Tatsache als eine Rechte zu bezeichnen.
Linke Interessenpolitik
Viele meiner ehemaligen linken Weggefährten waren inzwischen dem Beispiel von Guy Lévy gefolgt und besetzten nun einen Posten in der Bildungsbürokratie. Parallel zu diesem Umbau der Volksschule wurde auch ein massiver Ausbau des schulischen Überbaus vorangetrieben. Lehrkräfte wanderten in Scharen in die neuen Berufsfelder wie Individuelle Förderung (IF), Deutsch für Fremdsprachige (DAZ), oder Schulsozialarbeit, sie wirkten an einem Weiterbildungsinstitut, wurden Dozenten an der PH, füllten die üppig gedeihenden Beratungs- und Evaluationsstellen oder arbeiteten in den nun immer zahlreicheren Arbeitsgruppen und Lehrmittelkommissionen und Funktionärsstellen der Verbände.

Professor Rudolf Künzli brachte dies in einem Referat in Baden (12. Oktober 2011) auf den Punkt: «Eine Allianz aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft hat sich gebildet. Ihr geht es um Steuerung und Auftragssicherheit.»
Es zeigte sich, dass diese Allianz nicht gewillt war, sich die Butter vom Brot zu nehmen und Seite an Seite mit den Promotoren der Bildungsreformen die Initiativen bekämpfte.
Die sozialdemokratische Partei verlangt in ihrem Parteiprogramm 2007 flächendeckende Teste mit Zertifikaten. Urs Moser, der Zulieferer dieser Teste hat sein Institut für Bildungsevaluation 2013 offiziell als Aktiengesellschaft eintragen lassen. Karin Fisli, SP-Präsidentin der Sektion Meikirch (Kanton Bern) schrieb im Facebook am 13.2.18: „Lehrerinnen und Lehrer, welche den Lehrplan 21 verhindern wollen, sollten echt nicht mehr im Schulzimmer stehen.“ Sie wurde kürzlich in den bernischen Grossrat gewählt.
Mein sozialdemokratischer Schulleiter forderte von mir plötzlich, meinen projektorientierten Unterricht einzuschränken und auswärtige Schulanlässe mindestens einen Monat vorher zur Bewilligung vorzulegen.

Der sozialdemokratische Schuldirektor von Biel, Pierre-Yves Moeschler, liess mir von meinem sozialdemokratischen Schulleiter eine Kommunikationsvereinbarung vorlegen, in der es unter anderem hiess: „Verzichtet künftig auf verzerrende Darstellungen des Schulalltags!“ (Meine Antwort war die Kündigung).
Das Projekt Change Management im Kanton Thurgau wurde vom Sozialdemokraten Markus Mendelin im Auftrag der kantonalen Erziehungsdirektion entworfen.
Unser bewährtes Berufswahl-Unterrichtskonzept wurde vom lokalen Schulinspektorat zurückgewiesen. Begründung: „Die Kompetenzziele des WAH (Wirtschaft, Arbeit und Haushalt) müssen in dem Konzept vollständig enthalten sein.“ Der links-grüne Gemeinderat der Stadt Biel richtete im Mittelstandsquartier Beaumont sogenannte zweisprachige Klassen ein (Filière Bilingue) und verschärft die problematische Zusammensetzung der Schülerschaft in den Aussenquartieren (Klassen mit 100% Migrationsanteil).
Es sind nicht wir, die vermeintlich Konservativen, welche uns die Schule der 60-er Jahre zurückwünschen. Es sind die wirtschaftsfreundlichen Lobbygruppen, Stiftungen, Think-Tanks oder internationalen Organisationen, in ihrem Geist von der Handschrift einer neoliberalen Ideologie geprägt, die unsere Bildungsideale als überholt betrachten.
Bedroht sind die Errungenschaften der 70-er, 80-er und 90-er Jahre
Hier werden die Errungenschaften der linken Reformpolitik der 70-er, 80-er-und 90-er Jahre zurückgedreht. Es sind nicht wir, die vermeintlich Konservativen, welche uns die Schule der 60-er Jahre zurückwünschen. Es sind die wirtschaftsfreundlichen Lobbygruppen, Stiftungen, Think-Tanks oder internationalen Organisationen, in ihrem Geist von der Handschrift einer neoliberalen Ideologie geprägt, die unsere Bildungsideale als überholt betrachten. Angesagt ist der Wettbewerb auf dem Markt der knappen Lebenschancen. «Wenn aber Angebot und Nachfrage über den Wert von Wissen, Können und Haltung entscheiden, sind die Bildungsbemühungen nicht mehr auf einen überzeitlichen, inneren Maßstab menschlicher Vervollkommnung auszurichten, sondern an den fluktuierenden, kontingenten Markterfordernissen, die ausbleibende Anpassungs- oder Selbstinnovationsleistungen gnadenlos abstrafen» (Jochen Krautz / Matthias Burchardt, Time for Change S. 6, Juli 2018)
Als ich 1978 im Arbeiterquartier Mett als junger linker Lehrer angestellt werden sollte, schossen die Bürgerlichen aus allen Rohren gegen meine Wahl. Gewählt wurde ich schliesslich mit dem Stichentscheid des Präsidenten, dem Schreinermeister Liechti, SP-Stadtrat.
32 Jahre später musste ich miterleben, wie die von mir mitbegründete Gewerkschaftszeitung «das VPOD-Lehrermagazin» mich mit einem vierjährigen Schreibverbot belegte, der VPOD sämtliche neoliberalen Reformen vehement mitverteidigt, mir von einem Sozialdemokraten ein Maulkorb verpasst werden sollte.
Heute unterrichte ich in einem kleinen Oberstufenzentrum in der Nachbargemeinde Orpund. Der Schulleiter lässt mir alle Freiheiten, wie damals in den 90er Jahren, die Kolleginnen und Kollegen springen ein, wenn ich wegen eines Podiums mal von Unterricht fernbleibe. Der bürgerliche Schulkommissionspräsident begrüsste mich mit den Worten: «Wir sind stolz, Sie hier zu haben, wir wollen keine Kopfnicker.»
Bedroht ist das Erbe unseres Kampfes in den 70-er, 80-er und 90-er-Jahren, bedroht ist die Chancengleichheit, bedroht sind die Kinder der unterprivilegierten Schichten, welche nun einer Ideologie des völligen selbstgesteuerten und zweckorientierten Lernens geopfert werden.
«Viele Linke merken gar nicht mehr, wie sehr sie zum Öl dieser schönen neuen Welt geworden sind.»
Mein Freund und Mitstreiter Bruno Schaad, Sekundarlehrer aus Grenchen, formulierte es in einem Artikel folgendermassen: «Wir hatten früher Freude an einem Gedicht von Günter Eich. Dort heisst es unter anderem „Schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind! Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt“ Viele Linke merken gar nicht mehr, wie sehr sie zum Öl dieser schönen neuen Welt geworden sind.»
Alain Pichard