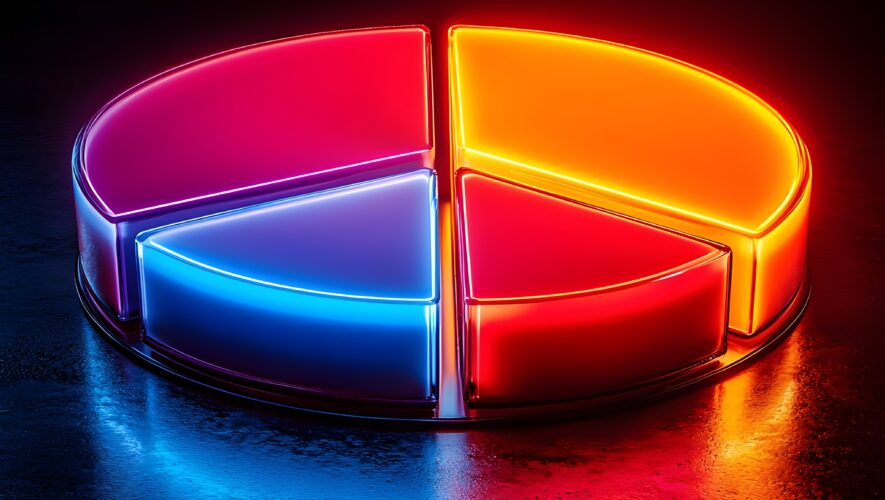Stolze 1043 LVB-Aktivmitglieder haben an der Befragung zur schulischen Selektion teilgenommen, die von Roger von Wartburg ausgewertet wurde. Lediglich 6.6 % aller Teilnehmenden teilen die Vision einer Volksschule ganz ohne Selektion, die derzeit vielerorts diskutiert wird. Im direkt betroffenen Zyklus III (Sekundarstufe I) unterstützen sogar nur 3.7 % diese Idee. Das bestehende System mit homogenen Klassen in den Leistungszügen A, E und P bleibt das meistgewählte Wunschmodell, wobei die LVB-Mitglieder durchaus Verbesserungspotenzial im Zuweisungsprozess orten. Auch ein Modell mit Stammklassen in Leistungszügen (A, E, P), aber gemischten Niveaugruppen in einzelnen Fächern geniesst Sympathien, brächte gemäss Einschätzung der Teilnehmenden jedoch neue grosse Herausforderungen mit sich.
Die 15 wichtigsten Aussagen auf einen Blick:
- Eine Sekundarstufe I ohne schulische Selektion wird überdeutlich abgelehnt.
- Eine grosse Mehrheit befürwortet den Grundsatz der Bildung von Leistungszügen auf der Sekundarstufe I.
- Es empfinden mehr Teilnehmende den jetzigen Zeitpunkt der Selektion als zu spät denn als richtig oder zu früh. Das einstige Modell «5/4» wird geschätzt und teilweise vermisst.
- Die Bildung von Leistungszügen ermöglicht eine bessere Passung des Unterrichts auf die Bedürfnisse der Lernenden.
- Die Bildung von Leistungszügen ermöglicht schulische Erfolgserlebnisse bei unterschiedlichen Leistungspotenzialen.
- Die Durchlässigkeit zwischen den Leistungszügen ist gewährleistet.
- Die Mehrheit der Zuweisungsentscheide ist passend, aber nicht in allen Fällen.
- Verbesserungspotenzial im Zuweisungsprozess gibt es hinsichtlich unterschiedlicher Zuweisungspraxis, des Drucks von Erziehungsberechtigten und unklarer Kriterien.
- Aktuell werden zu viele Schülerinnen und Schüler in die Leistungszüge E und P eingeteilt; der Leistungszug A muss gestärkt werden.
- Deutliche Mehrheiten glauben, eine Abschaffung von Leistungszügen ginge zulasten der stärkeren Schülerinnen und Schüler und würde eine Nivellierung nach unten zur Folge haben. Auch schwächere Schülerinnen und Schüler würden nicht davon profitieren.
- Das duale Bildungssystem ist ein Glücksfall und eröffnet nicht zuletzt jenen, die später «den Knopf aufmachen», zahlreiche Chancen und Möglichkeiten.
- Die wichtigsten Übertrittskriterien sind die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die Einschätzung der Klassenlehrperson, das Arbeits- und Lernverhalten sowie die Noten.
- Flächendeckende «klassische» Übertrittsprüfungen sind umstritten; geeichte normierte Testverfahren könnten eine Option sein, um den Übertrittsprozess zu optimieren.
- Das bestehende System mit homogenen Klassen in den Leistungszügen A, E und P bleibt das meistgewählte Wunschmodell.
- Auch ein Modell mit Stammklassen gemäss allgemeinem Leistungsniveau (A, E, P), aber gemischten Niveaugruppen in einzelnen Fächern geniesst Sympathien, wird jedoch mit grossen organisatorischen und sozialen Herausforderungen assoziiert.
→ Hier geht es zur vollständigen Auswertung, die in der Juniausgabe 2025 des «lvb inform» – der Verbandszeitschrift des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland LVB – erschienen ist.