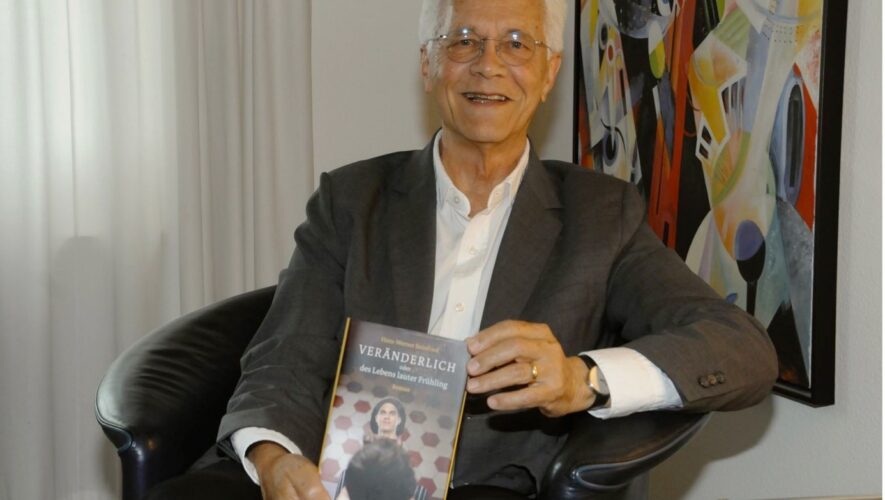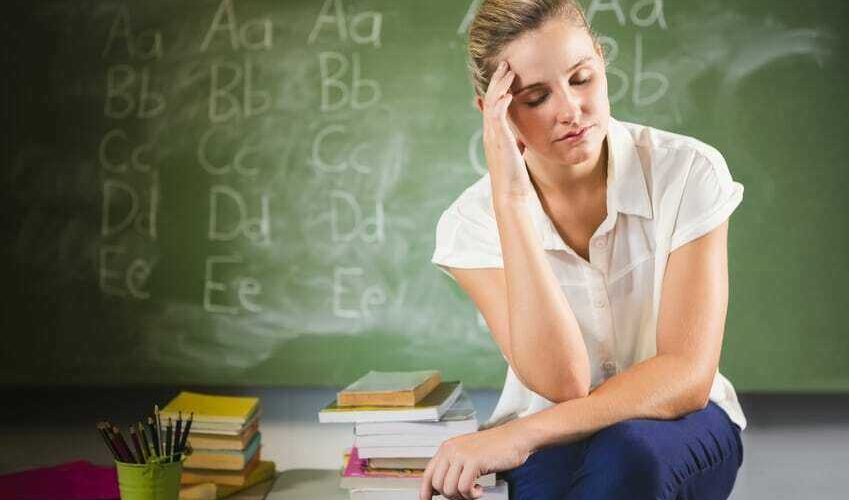«Verlust. Ein Grundproblem der Moderne» – So betitelt der Soziologe Andreas Reckwitz seine Analyse der Gegenwart und ihrer widersprüchlichen Dynamiken.[1] Die Studie beschreibt die Verlusterfahrungen moderner westlicher Gesellschaften. Im Grossen und im Kleinen, im gesellschaftlichen Makrokosmos wie in der Mikrowelt des persönlichen Lebensalltags. So hat heute beispielsweise nicht mehr «jedes Kind das Recht, nicht verwöhnt zu werden», wie es ein kantonaler Bildungsdirektor vor einiger Zeit ausgedrückt hat. Er bezeichnete es als «Verlust». Verluste gab es schon immer; sie sind grundsätzlich nichts Neues und gehören zum menschlichen Dasein. Doch sie mehren sich, weil die Erwartungen gewachsen sind.

Wenn Grundhaltungen beliebig werden
Mit vielen und oft widersprüchlichen Erwartungen sind auch Jugendliche konfrontiert. Von den Eltern und von der Schule her, von Peergroups und vom Beruf her. Das Erwachsenwerden in Zeiten kultureller Modernisierungen wird anspruchsvoller. Wertordnungen lösen sich auf oder vervielfältigen sich; konsequente Grundhaltungen weichen nicht selten einem Modus der Beliebigkeit.
Das bedeutet für heutige Jugendliche einen deutlich anderen Sozialisationskontext als für die Jugendgeneration der 1970er- und der 1980er-Jahre. Sie war noch in verbindlichere Pflichtwerte und normenregulierte Strukturen, vielleicht sogar Traditionen eingebunden und konnte dagegen aufbegehren und sich davon ablösen. Die damalige junge Generation reagierte mit ihren Lebensstilen auf eine kulturelle Überstrukturierung.[2]
Aufwachsen in einer unterstrukturierten Welt
Die Bindekraft von Herkunftsmilieus und Institutionen wie Schule und Vereinen hat heute deutlich nachgelassen. Die junge Generation wächst nicht selten in einer entstrukturierten, teilweise gar unterstrukturierten Welt auf, einer Gesellschaft, in der immer mehr möglich, immer weniger vorgegeben und mit Blick auf Zukunft vieles unklar ist. Die erhöhte Unübersichtlichkeit moderner Lebenswelten!
Das hat Konsequenzen. Der Psychologe und Gerichtsgutachter Hans-Werner Reinfried kennt und beschreibt sie aus seiner reichen Berufserfahrung heraus. Er wählt dazu die Form des Romans.[3] Entstanden ist eine eindrückliche Lebensgeschichte. Sie beleuchtet vielfach Unbekanntes oder von aussen Unerkanntes. Ein aktueller, gesellschaftlich-sozialer Augenöffner! Der Zusatztitel vom «lauten Frühling» erinnert wohl gezielt an Frank Wedekinds Kindertragödie «Frühlings Erwachen». Auch Reinfried nimmt die Nöte und Schlüsselschwierigkeiten junger Menschen auf – wie Wedekind in seinem gesellschaftskritischen Drama um 1900.
Wohlbehütete Jugend
Robin Hauser, so heisst Reinfrieds fiktive Figur, wächst als Einzelkind in einer Zürcher Vorortsgemeinde auf – in wohlbehüteter Atmosphäre und als «Schmuse-Baby» auch Bindefaktor zwischen Mann und Frau. Der Vater arbeitet, die Mutter wirkt zu Hause. Materiell fehlt es Robin an nichts. Ganz im Gegenteil! Er wird verwöhnt, lebt sozial isoliert, ohne den notwendigen Halt und den gleichzeitigen wohlwollenden Widerstand. Grenzen erfährt er keine, auch in der Schule nicht. Robin hat nur sich selbst; dabei bräuchte er die andern. Kindheit und Primarschule durchlebt er darum «im diffusen Dämmerzustand».
So erstaunt es nicht, dass er seine erste Lehrstelle nach nur einem Jahr abbricht und auch die zweite Berufslehre als Autolackierer nach kurzer Zeit aufgibt. Doch zu Hause findet er kein Daheim. Die Enge im Elternhaus wird ihm zur Qual. «Die ewige Fragerei, ob es ihm gut gehe, ob ihm etwas fehle, ob er genug gegessen habe oder warm angezogen sei, warum er nicht häufiger von seinen Erlebnissen berichte […], hatte er satt.» Er zieht weg.
Strassenbauer oder Plattenleger?
Halt sucht Robin in der Gleichaltrigen-Szene. Er will dazugehören; so erfährt er, wie seine Kumpel mit ihrem Alltag zurechtkommen. Er selber hat keine Ahnung, was ihm wichtig ist. Imaginäre Ideale, irreale Phantasien, Grössenwünsche dominieren – mit entsprechenden Selbstwert- und Schamkonflikten. Dazu kommen erste Liebesbeziehungen. Sie scheitern. So sucht er wieder die Nähe seiner Eltern. Doch Robins Nöte werden nicht angesprochen; alles bleibt offen, alles mäandriert im Vagen. Das Zuhause bietet weder Halt noch Struktur. Robins Scheitern wird der Gesellschaft zugeschrieben.
Endlich holt er sich Hilfe; er sucht einen Berufsberater auf. Allerdings hat er keine Vorstellung von seiner Zukunft und noch viel weniger, «was er lernen oder arbeiten möchte». Vielleicht als Kapitän auf einem Zürichsee-Schiff? – der prächtigen Uniform wegen! Der Berufsberater bespricht mit ihm zwei Optionen: Strassenbauer oder Plattenleger. Strassenbauer sei äusserst streng, warnen ihn seine Kollegen. Bei einem Plattenleger kann er eine einwöchige Probezeit absolvieren.

Der Lehrmeister als väterliche Autorität
Im Plattenleger Reichle trifft Robin auf einen verständnisvollen Lehrmeister und Ansprechpartner. Konsequent und einfühlsam zugleich, standhaft und nachsichtig in einem: eine väterliche Autorität, die stützt und führt, ohne aber autoritär zu sein. Robin spürt, wie er gebraucht wird: das belebende Gefühl, nützlich zu sein und dabei Sinn zu erfahren, Verantwortungssinn und das Bewusstsein, dass es auf ihn ankommt! Sein Arbeitsalltag ist strukturiert. Das kompensiert Robins bisherige Diffusionserfahrungen. Er findet so zu einer gekonnten «Selbstpräsentation». Sein sicheres Auftreten hilft ihm auch in der Schule.
Die Berufslehre und ein verständnisvoller Lehrmeister holen Robin aus der isolierten Eigenwelt in eine sinnvolle Tätigkeit. Das ermöglicht ihm einen Einstieg ins Erwachsenenleben. Einige seiner Cliquen-Freunde haben weniger Glück.
Halt und freundlicher Widerstand
Reinfrieds Roman skizziert fiktive Figuren mit realem Leben. Aus seinem Werk sprechen grosse Berufserfahrung, feinfühliges Menschenverständnis und der unaufdringliche Wille, benachteiligten Jugendlichen zu helfen. Junge Menschen – und davon ist Reinfried zutiefst überzeugt – brauchen ein vernünftiges und vitales Visavis, sie brauchen den anderen. In ihm kommen sie zu sich selbst. Es ist ein Gegenüber, das sie anregt und belebt und erzieherisch auch führt.
Sich selber in verantworteter Freiheit führen, das müssen junge Menschen erst lernen. Das kommt nicht von selbst. Autonom werden sie durch Emanzipation – über Halt und freundlichen Widerstand. Der Mensch wächst am Widerstand. Das zeigt der Roman auf eindrückliche Weise – im Gelingen wie im Scheitern. In diesem Sinne offeriert Reinfrieds Schrift wichtige Impulse für Familie, Schule, Lehre – als angemessene pädagogische Antwort auf zeittypische Verlusterfahrungen. Sie ist ein Lösungsansatz für aktuelle Probleme heutiger Jugendlicher.
[1] Andreas Reckwitz (2024), Verlust. Ein Grundproblem der Moderne. Berlin: Suhrkamp Verlag.
[2] Thomas Ziehe (o.J.), «Was bewegt die Jugendlichen?», Msc. unpubl., S. 4.
[3] Hans-Werner Reinfried (2024), Veränderlich – oder des Lebens lauter Frühling. Roman. St. Gallenkappel und Heidelberg: Edition Königstuhl.