Es ist paradox: Trotz all unserer technischen Möglichkeiten wird unser Blick auf die Welt immer verschwommener. Gerade die jüngste Vergangenheit hat uns vor Augen geführt, wie wenig wir wirklich wissen über die Ereignisse in der Welt. Wir leben in einer Zeit der Täuschungen und medialen Irreführungen. Das Internet ist entsprechend voll von Anleitungen und Trainingsprogrammen, wie Schüler Fake News in den Medien erkennen können. Doch lassen wir uns nicht täuschen: Nicht einmal geübte Profis können heutzutage feststellen, ob ein Beitrag echt oder gefälscht ist. Bezogen auf die Schule heisst dies, dass es nicht möglich sein wird, jemandem nachzuweisen, eine Arbeit mit Hilfe von KI geschrieben zu haben. Gute Zeiten für faule Schüler und Studenten?

Der Computer hat uns schon sehr viele, auch lästige, Arbeiten abgenommen. Es ist absehbar, dass in Zukunft noch mehr Arbeiten von maschineller Intelligenz übernommen werden. Dies befreit uns von mühsamen Routine-Aufgaben und erlaubt es, uns besser auf die Dinge zu konzentrieren, die uns wichtig sind. Es scheint also nur logisch, wenn grundlegende Kenntnisse abdelegiert werden an die Maschinen. Denn diese sind ja besonders gut darin, das mühsam zu erwerbende fachliche Grundwissen zu speichern und auf Tastendruck auszuspucken. Für die Schule würde dies bedeuten: Grundrechenoperationen ade, Rechtschreibung ade, Schreiben nur noch als künstlerisch-kreativer Akt mit den entsprechenden Freiheiten, Länderkenntnisse ade, Geschichtswissen ade usw.
Grundlagenwissen ist zentral
Doch machen wir uns nichts vor: Um das Beste aus der KI herauszuholen und um am produktivsten mit ihr zu arbeiten, braucht es nach wie vor Menschen mit Grundlagenwissen und Sachverstand. Am meisten von der Computerintelligenz profitiert derjenige, der in der Lage ist, gute Fragen zu stellen. Das geht aber nur mit entsprechendem Vorwissen. Gerade die Volksschule sollte nicht dem Irrglauben verfallen, Basiswissen noch mehr als bisher dem Computer zu überlassen. Grundlegende Kulturtechniken wie Rechnen, Lesen und Schreiben werden auch in Zukunft gültig und wichtig bleiben. Besonders die Schreibkenntnisse sind bedroht, in Zukunft zu verkümmern. Dabei bedeutet Schreiben nichts anderes als Gedanken zu formulieren, zu ordnen, Zusammenhänge zu erkennen, letztlich also zu denken. Wenn ich einen grossen Teil des Schreibens freiwillig aus der Hand gebe, verkümmert mein Denken und damit auch meine menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Large Language Models, mit denen die KI gefüttert und trainiert werden, haben ein riesiges Lagerhaus von Wissen für jedermann zugänglich gemacht. Dieses wird auch zunehmend genutzt.
Es gibt unter den Lehrkräften viele Gegner der künstlichen Intelligenz, welche sie am liebsten verbieten würden. Ausserdem befürchten Gewerkschaften den Verlust von Arbeitsplätzen. Und Regierungen sehen sich angesichts der gestreuten Desinformationen vermehrt machtlos. Trotz dieser Abwehrreaktionen wissen wir, dass die KI nicht verschwinden wird – dieser Zug ist abgefahren. Bereits jetzt sind die Folgen der digitalen Intelligenz unwiderruflich. Large Language Models, mit denen die KI gefüttert und trainiert werden, haben ein riesiges Lagerhaus von Wissen für jedermann zugänglich gemacht. Dieses wird auch zunehmend genutzt.
Am wenigsten Berührungspunkte gibt es in Berufen, in denen Bewegung und physische Anstrengung wichtig sind, wie z.B. Berufssportler, Tänzer, Dachdecker oder Motorradmechaniker.
Umwälzungen in der Berufswelt
Praktisch alle Berufe werden von KI betroffen sein, allerdings in unterschiedlichem Mass. Die grösste Überschneidung gibt es in gutbezahlten Branchen, wo Kreativität und ein Hochschulabschluss wichtig sind. Am wenigsten Berührungspunkte gibt es in Berufen, in denen Bewegung und physische Anstrengung wichtig sind, wie z.B. Berufssportler, Tänzer, Dachdecker oder Motorradmechaniker. Aber auch bei grossen Überschneidungen, wo die KI viele Aufgaben übernehmen kann, bedeutet dies nicht, dass der Beruf wegrationalisiert wird. Jeder Beruf besteht aus einem Bündel von verschiedenen Aufgaben. Nicht alle dieser Aufgaben sind gefährdet, eines Tages durch Computer ersetzt zu werden.

Wir wissen nicht, wohin uns die Reise mit den denkenden Maschinen führen wird. Das sorgt für Unsicherheit und berechtigte Ängste. Bezogen auf die Schule kann es nicht sein, dass KI die Arbeit des Schülers übernimmt. Wir sind gefordert, neue Aufgaben und Arten der Beurteilung zu finden. Ebenfalls notwendig ist es, eine möglichst ideale Form der Aufgabentrennung zwischen Mensch und Maschine zu finden. Es gibt (noch) Dinge, bei denen wir dem Computer überlegen sind. Und dann gibt es Dinge, die wir bewusst nicht dem Computer überlassen wollen, wie z.B. wichtige persönliche Entscheidungen oder das Erziehen unserer Kinder. Es geht also darum, Bereiche festzulegen, die wir durch die Maschine erledigen und solche, die wir unbedingt selbst tun wollen. In der Praxis läuft es auf ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine hinaus, wobei derjenige die besten Ergebnisse erreicht, der dank seines Basiswissens die Macht des Computers am wirkungsvollsten ausspielen kann.


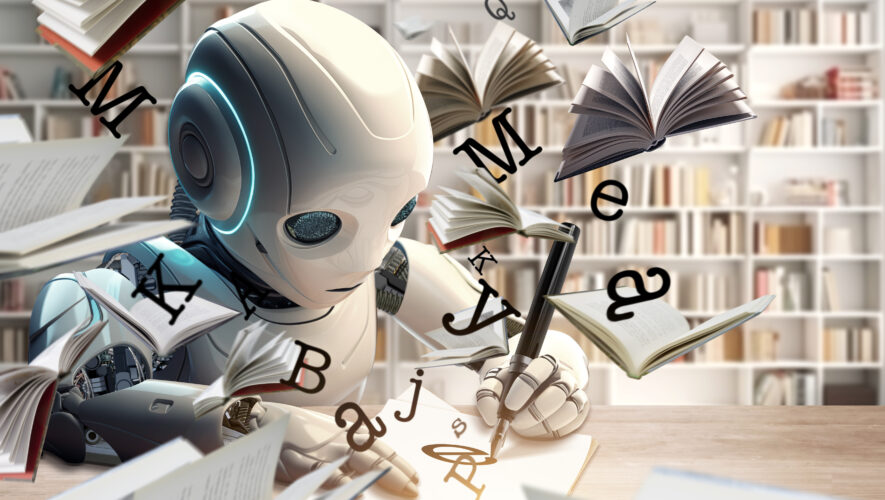


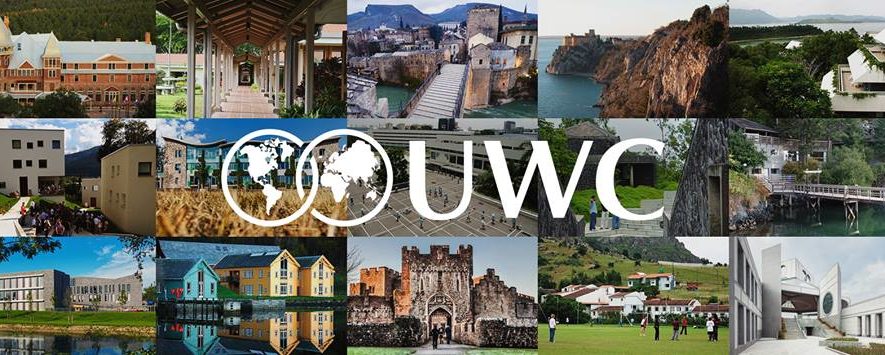
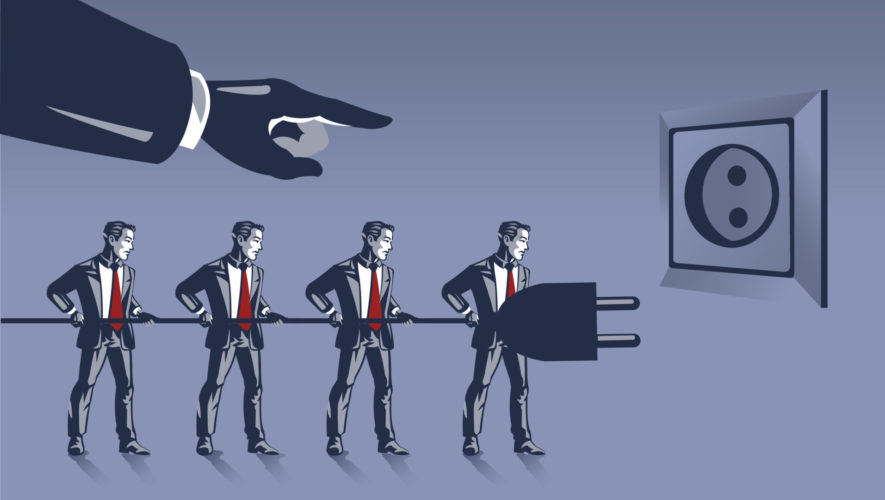
Etwas zu können, das wir mit Anstrengung erworben haben, macht uns glücklich. Ein Vierjähriger freut sich, wenn er nach einigen abenteuerlichen Versuchen gelernt hat, sicher mit dem Velo zu fahren. Nach mühsamen wackeligen Gleitversuchen endlich schwungvoll übers Eis gleiten zu können, hat uns einst ein tolles Freiheitsgefühl verschafft. Beide physischen Kulturtechniken sind nicht einfach angeboren wie das Fliegen bei einem Jungvogel. Es sind Bewegungsarten, die am besten unter Anleitung gelernt werden.
Die Schule muss dafür sorgen, dass mit Arbeit verbundene Erfolgserlebnisse jedes Kind erfahren lassen, dass es stärker wird. Sein Können, seine Einsichten in Zusammenhänge und allmählich auch seine Urteilskraft wachsen nach gelungenen Lernprozessen. Schulisches Training ist vergleichbar mit einer sportlichen Bergtour. Wer den Gipfel nach einer mehrstündigen Ausdauerleistung erreicht, darf zufriedener sein als nach einer bequemen Seilbahnfahrt zum Bergrestaurant. Wir lieben es zwar, Abkürzungen im Leben zu nehmen, um Ziele schneller erreichen zu können. Doch dieses Abkürzen ist in der elementaren Pädagogik selten zielführend. Auch der Einsatz von KI in der Schule macht dabei keine Ausnahme.
Der zentrale Auftrag der Volksschule bleibt die sorgfältige Vermittlung von Grundkenntnissen. Dies gilt ganz besonders für den Bereich der Allgemeinbildung. Wer sich bereits gründlich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, wird zusätzliche KI-Informationen viel besser einordnen können. Wir alle benötigen ein Basiswissen, an welches unser Gehirn neues Wissen andocken kann. Wo jedoch wesentliche Vorkenntnisse fehlen, kann kaum damit gerechnet werden, dass KI-Informationen auf fruchtbaren Boden fallen. So kann eine durch KI unterstützte Gruppenarbeit über eine Herzklappenoperation Schüler überfordern, wenn ihnen die Grundfunktionen des menschlichen Herzens nicht bereits bekannt sind.
KI soll mit diesen kritischen Gedanken keinesfalls verteufelt werden. Am richtigen Ort zur richtigen Zeit eingesetzt, hat sie auch in der Volksschule das Potenzial, Lernprozesse zu fördern und manche Arbeit zu erleichtern. Urs Kalberer hat dies zu Recht unterstrichen. Es gibt attraktive Möglichkeiten, mit KI neue Wege zu beschreiten und andere didaktische Akzente zu setzen. Bei aller Begeisterung über die Chancen von KI gilt es jedoch, die zentralen pädagogischen Gesetzlichkeiten nicht aus den Augen zu verlieren.