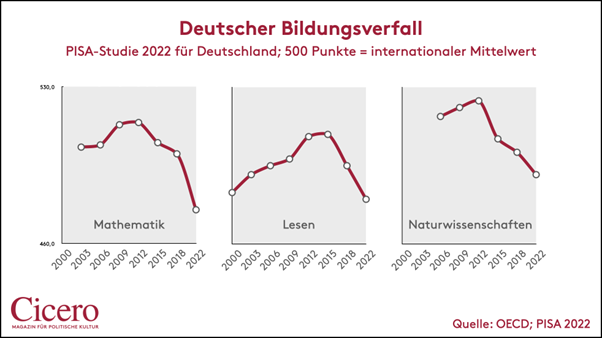In den Verordnungen über die berufliche Grundbildung1 ist festgehalten, dass die einzelnen Berufe den wirtschaftlichen, technologischen, ökologischen und didaktischen Entwicklungen anzupassen sind. Aufgrund der rasanten, technologischen Entwicklung in einzelnen Berufsfeldern müssen die Akteure mit möglichst niederschwelligen Ideen dafür sorgen, dass der Anschluss an die Marktbedürfnisse nicht verpasst wird.
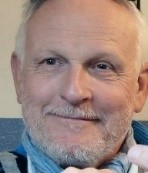
Am Beispiel der Zweiradberufe2 resp. des Berufes “Fahrradmechaniker/in” lässt sich erkennen, wie aus dem früheren Velo ein hochtechnisiertes Gerät entstanden ist. Geändert haben die Materialien, die Antriebs- und Schaltsysteme mit Elektrik und Elektronik, Bremsen, Komponenten usw. – Und immer wieder tauchen Neuheiten auf, welche die Kundennachfrage ansteigen lassen. Innerhalb der drei Jahre dauernden Ausbildungszeit sind diese technologischen Innovationen nicht expliziter Lerngegenstand in den Stoffplänen.
An den Berufsfachschulen lässt sich dieser Tatsache mit folgenden Massnahmen entgegenwirken:
- Pro Berufs- oder Fachgruppe wird ein Berufsfachschullehrer als Technologiebeobachter bestimmt.
- Er beobachtet den Markt im Zweiradgewerbe und antizipiert insbesondere die dortige Technologie-Entwicklung. Gleichzeitig sammelt er Hinweise und Beiträge seiner Berufskollegen. Ihnen obliegt ebenfalls die Aufgabe, die technologische Zukunft im unterrichtenden Beruf zu orten.
- Er bündelt die neusten Technologie-Entwicklungen zu Stoffthemen zusammen und bereitet Unterrichtssequenzen sowie das entsprechende Setting vor.
- Er konzipiert daraus kompakte (Kurz-)Freikurse für die aktuellen Lernenden der Fahrradmechanik.
- Er organisiert – allenfalls gemeinsam mit übergeordneten Stellen – diesen Freikursunterricht.
- Er plant die fachlichen Weiterbildungen zu den neuen Lernsequenzen und schult seine Berufskollegen.
Der Zyklus dieser Routine umfasst ein Schuljahr. Im jeweils ersten Semester erfolgen die Schritte (2) bis (4). Im ersten Quartal des zweiten Semesters folgen die Schritte (5) und (6). Dann folgt die Umsetzung im Unterricht.
Das Konzept “Technologiebeobachter” hat den Vorteil, dass sich nicht jede Berufsschullehrperson um das gleiche Thema kümmern muss. Gleichzeitig wird mit dem Technologiebeobachter eine Funktion geschaffen, die mit den Zweiradhersteller-Firmen und den Ausbildungsverbundpartnern vernetzt ist.