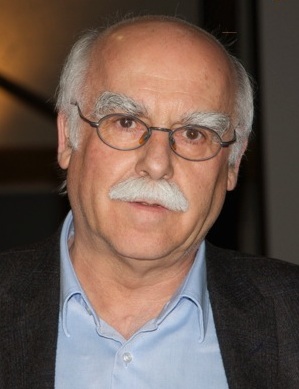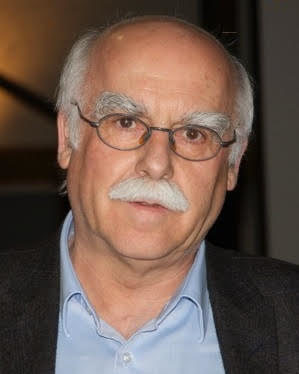In meiner Kritik der Neuropädagogik, die im Condorcet-Blog unter dem Titel Lehrende und lernende Gehirne erschienen ist (s. [Condorcet-Blog 30.6.2023, 2.7.2023 und 8.7.2023]), habe ich als ungelöstes Problem einer neurowissenschaftlichen Fundierung der Pädagogik die Überbrückung des Grabens zwischen der sinnfreien Wirklichkeit des Gehirns und der sinnhaften Wirklichkeit von Erziehung und Unterricht hervorgehoben. Bloss davon überzeugt zu sein, dass geistige und psychische Phänomene durch Vorgänge im Gehirn realisiert werden, genügt nicht, um zwischen den physischen Mechanismen, die von einer naturwissenschaftlichen Analyse des Gehirns aufgedeckt werden, und dem bedeutungshaltigen Geschehen in einer Schulklasse Beziehungen herzustellen oder aus Ergebnissen der Hirnforschung Folgerungen für Erziehung und Unterricht abzuleiten. Wir müssen erklären können, wie das eine aus dem anderen hervorgeht.
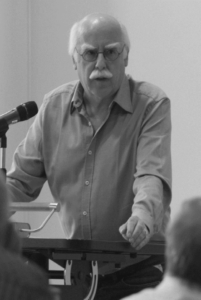
In der Philosophie des Geistes wird häufig zwischen einfachen und schweren Problemen der wissenschaftlichen Erklärung von Bewusstseinsphänomenen unterschieden (vgl. Anderson, 2022). Die einfachen Probleme betreffen Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs- und Gedächtnisprozesse sowie elementare kognitive Leistungen, von denen angenommen wird, dass sie eine neuronale Grundlage haben. Die schweren Probleme betreffen die Frage, wie sich naturwissenschaftlich erklären lässt, dass unser Bewusstsein eine subjektive Seite aufweist, insofern wir Wahrnehmungen oder Empfindungen auf eine bestimmte Weise erleben. Es ist eine Sache, für ein Angstgefühl oder eine euphorische Gestimmtheit eine neurologische Grundlage zu finden, aber eine ganz andere, das mit der Angst oder Stimmung verbundene subjektive Erleben neurowissenschaftlich zu erklären.
Noch schwieriger wird es allerdings, wenn wir erklären wollen, wie in einer materiellen Welt Sinn und Bedeutung vorkommen können, und zwar nicht als blosses Gefühl von Sinnhaftigkeit, sondern als objektiver Sinn, den wir miteinander teilen, wie zum Beispiel im Falle von politischen Überzeugungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sprachlicher Bedeutung. Wie kommt es, dass wir das Gleiche meinen, wenn wir ein gleiches Sprachzeichen verwenden? Durch die Aufsummierung individueller Gehirnzustände lässt sich jedenfalls nicht erklären, dass Menschen in einer Welt leben, über deren Merkmale sie in wesentlicher Hinsicht übereinstimmen.
Ich bilde mir nicht ein, dieses wirklich schwierige Problem lösen zu können, glaube jedoch, dass wir eine Argumentation aufbauen können, die uns einer Lösung näherbringt. Dazu werde ich im 1. Teil meines vierteiligen Beitrags ausführen, weshalb die Mittel der Neurowissenschaften nicht ausreichen, um psychische und geistige Phänomene zu erklären. Im 2. Teil werde ich skizzieren, wie eine Lösung des Problems zumindest denkbar sein könnte. Dazu werde ich einerseits auf entwicklungspsychologische und hirnphysiologische Arbeiten zurückgreifen und andererseits auf neuere Forschung zu Themen wie Theory of Mind, Exekutivfunktionen und Intentionalität eingehen. Im Zentrum des 3. Teils werden die Arbeiten des kanadischen Neuropsychologen Merlin Donald zur Evolutionsgeschichte des Menschen stehen, die meiner Meinung nach eine plausible Erklärungsskizze zur Entstehung der spezifisch menschlichen kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten geben. Im 4. Teil werde ich aus meinen Ausführungen zur «Symbiose von Gehirn und Kultur» – eine Formulierung, die ich von Donald (2008) übernehme – einige Konsequenzen ziehen, die gewisse Denkgewohnheiten, wie sie vor allem in der Didaktik verbreitet sind, radikal infrage stellen.
Wenig Neues unter den Gehirnen
Wollten wir dem Neurophysiologen und Hirnforscher Wolf Singer (2002) folgen, dann hätten unsere Gehirne das Problem der Überbrückung des Grabens zwischen materieller und sozialer Wirklichkeit längst schon aus eigenem Antrieb gelöst. Die Grenze zur mentalen Wirklichkeit sollen sie nämlich überschritten haben, als sie «damit begannen, ihre Umwelt abzubilden» (S. 40) und «Begriffe und Symbole für Erfahrungen zu erfinden» (ebd.). Die Gehirne selbst «fügten der vorgefundenen materiellen Welt eine weitere Ebene hinzu, die aus immateriellen Konstrukten, Beschreibungen und Zitaten besteht» (ebd.). Aber weshalb hätten sie dergleichen tun sollen? Und wie sollten sie dies zustande gebracht haben?

Wie unplausibel Singers Annahme ist, zeigt die Tatsache, dass sich das Gehirn des Menschen von den Gehirnen anderer Säugetiere nicht wesentlich unterscheidet. Wenn wir uns an den Hirnforscher Gerhard Roth (1997) halten, dann entspricht das menschliche Gehirn sowohl in seinem Grundaufbau wie in den Einzelheiten nicht nur dem Gehirn anderer Säugetiere, sondern auch anderer Wirbeltiere. «Am menschlichen Gehirn kann im Vergleich zu den ihm stammesgeschichtlich nahestehenden Tieren nichts grundlegend Neues und Anderes festgestellt werden» (S. 76). Mit Ausnahme seiner Grösse ist unser Gehirn von den Gehirnen unserer biologisch nächsten Verwandten kaum zu unterscheiden.
Das menschliche Gehirn ist etwa dreimal so gross wie dasjenige eines Affen derselben Körpergrösse, wobei schon Affen gegenüber anderen Säugetieren über relativ grosse Gehirne verfügen. Das heisst auch, dass das Gehirn des Menschen stammesgeschichtlich schneller an Volumen zugenommen hat als sein übriger Körper. Vor allem der präfrontale Cortex ist beim Menschen volumenmässig stärker ausgebildet als bei anderen Primaten. Das ist für das Verständnis der so genannten Exekutivfunktionen des Gehirns von besonderer Bedeutung. Wir werden im 2. Teil dieses Beitrags näher darauf eingehen.
Aufgrund der Ähnlichkeit des menschlichen Gehirns mit den Gehirnen anderer höherer Lebewesen lassen sich die besonderen Leistungen, zu denen Menschen im kognitiven Bereich fähig sind, durch die Hirnforschung allein nicht erklären. Dem entspricht, dass sich das menschliche Gehirn in den letzten rd. 50’000 Jahren anatomisch kaum verändert hat. Wie kann es sein, dass dasselbe Gehirn, das selbst vor 15’000 Jahren noch nichts von Landwirtschaft, Viehhaltung und phonetischer Schrift wusste, innert kürzester Zeit, nämlich in den letzten rd. 200 Jahren, zu Leistungen wie der Erfindung der Eisenbahn, der Glühbirne, des Penicillins, der Raumfahrt, des Computers und des Internets fähig war?
Im Unterschied zur biologischen Evolution, die nur langsam voranschreitet, da organismische Veränderungen auf genetischer Basis weitergegeben werden müssen, verfügt die kulturelle Evolution über eine beschleunigte Form der Tradierung, da Neuerungen durch individuelles Lehren und Lernen vermittelt werden können.
Die Kultur als Wasserscheide
Die naheliegende Antwort lautet, dass es dem Menschen dank Verknüpfung seines Gehirns mit kulturellen Innovationen möglich war, diese Leistungen zu erbringen. Im Unterschied zur biologischen Evolution, die nur langsam voranschreitet, da organismische Veränderungen auf genetischer Basis weitergegeben werden müssen, verfügt die kulturelle Evolution über eine beschleunigte Form der Tradierung, da Neuerungen durch individuelles Lehren und Lernen vermittelt werden können. Einmal in Gang gesetzt, konnte die kulturelle Entwicklung an Fahrt aufnehmen, ohne dass dazu Veränderungen des Gehirns oder des Genoms notwendig waren.

Je nach Strenge der Definition, finden sich Spuren menschlicher Kultur bereits vor rd. 2.5 Millionen Jahren, beginnend mit der Gattung Homo habilis, oder aber erst seit rd. 200’000 Jahren mit dem Erscheinen des anatomisch modernen Menschen, Homo sapiens (vgl. Diamond, 2003, S. 49ff.; Haidle, 2008, S. 155; Tomasello, 2014, S. 84). Der rapide Wandel der menschlichen Lebensform setzte aber erst mit dem von Jared Diamond (2003) so genannten «grossen Sprung nach vorn» ein. Ereignet hat er sich vor ca. 40’000 Jahren, als die letzte Eiszeit allmählich ihrem Ende zuging. Zeichen der beschleunigten Veränderung sind nicht nur verfeinerte Werkzeuge, Schmuck, Höhlenmalereien, Figurinen, Knochenschnitzereien, Musikinstrumente und Grabbeigaben, sondern auch die zunehmende kulturelle Divergenz der menschlichen Gemeinschaften. Auch unsere negativen Seiten, eingeschlossen Gewaltbereitschaft, kriegerische Auseinandersetzungen und Genozid, gehören zu unserem kulturellen Erbe und können nicht aus unserer animalischen Natur abgeleitet werden (vgl. Diamond, 2003, S. 346ff.).
Es spricht viel dafür, dass Homo sapiens über Sprache verfügte, jedoch würde es zu kurz greifen, Kultur auf Sprache zu reduzieren. Eine minimale Definition von Kultur sieht in dieser ein kollektives System von Zeichen und Symbolen, mit denen Wirklichkeit repräsentiert und Wissen tradiert wird. Anders als seinen genetisch nächsten Verwandten, den Schimpansen und Bonobos, ist es dem Menschen gelungen, im Laufe seiner Evolutionsgeschichte den Schritt zur symbolischen Repräsentation von Wirklichkeit zu machen. Symbole ermöglichen es, den Strom des Bewusstseins vorübergehend zu unterbrechen, im Verhalten Zäsuren zu setzen und sich Sachverhalte vor Augen zu führen, die aktuell nicht gegeben sind. Wörtlich genommen meint Repräsentation Vergegenwärtigung. Da der Begriff der Repräsentation für unsere folgenden Überlegungen von zentraler Bedeutung ist, wollen wir ihn etwas genauer untersuchen.
Zum Begriff der Repräsentation
Wie Hans Jörg Sandkühler (2009) ausführt, sind Repräsentationen «das Ergebnis intentionaler Akte, d.h. einer gerichteten Wahrnehmung, Beobachtung, Erfahrung und Erkenntnis» (S. 60). Intentionalität im Sinne der bewussten Fokussierung eines Sachverhalts ist Voraussetzung für Repräsentation. Repräsentationen in Form von Bildern, Zeichen und Symbolen stehen für etwas Abwesendes, das durch die Repräsentation in die Gegenwart bzw. in unser aktuelles Bewusstsein gerufen wird. Insofern können Repräsentationen in Form von Erinnerungen, Gedanken oder Vorstellungen individuellen Charakter haben. Der Begriff der mentalen Repräsentation wird zumeist in diesem Sinn verstanden.
Das Moment der Intentionalität wird allerdings oft unterschlagen. So definieren der Neuropsychologe Dénes Szücs und die Neuropsychologin Usha Goswami (2007) mentale Repräsentation als Codierung von Information in Form von elektrochemischer Aktivität im Gehirn. Die Begriffe Codierung, Information und Repräsentation werden also nicht in einem zeichen- oder symboltheoretischen Sinn verwendet, sondern als rein physische Vorgänge (Feuern von Neuronen) in einem Netzwerk von Nervenzellen. Dieser Begrifflichkeit wollen wir uns nicht anschliessen.
Wenn Repräsentationen geteilt werden und eine gemeinsame Bedeutung haben sollen, dann genügt eine neurowissenschaftliche Sichtweise nicht, um den Begriff zu definieren. Es genügt aber auch nicht, wenn wir unter Intentionalität lediglich individuelle Intentionalität verstehen. Wenn ich mich allein auf eine Sache beziehe, kommt keine geteilte Bedeutung zustande. Wir müssen uns gemeinsam darauf beziehen, wenn wir uns mittels Zeichen oder Symbolen über einen Sachverhalt verständigen wollen. Während individuelle Intentionalität eine dreistellige Relation bildet – etwas bedeutet etwas für mich –, beruht geteilte Intentionalität auf einer vierstelligen Relation – etwas bedeutet etwas für uns, d.h. im Minimum für mich und dich.
Dem entspricht die Definition, die der britische Neurowissenschaftler Inman Harvey (2008) dem Begriff der Repräsentation gibt: «Ein Zeichen P wird von einer Person Q dazu verwendet, um gegenüber einer Person S auf ein Objekt R zu verweisen» (S. 228 – eigene Übersetzung). Wobei er ergänzt, dass die Personen Q und S Angehörige einer Gemeinschaft sind, die sich auf diese Art des Zeichengebrauchs geeinigt hat.
Zu wissen, was ein Zeichen bedeutet, heisst zu wissen, wie man das Zeichen gebraucht. Den Gebrauch lernt man im Austausch mit anderen, die bereits wissen, wie das Zeichen verwendet wird.
Harvey bestätigt damit, dass es ohne geteilte Intentionalität keine Zeichen oder Symbole geben kann. Nichts kann an sich ein Zeichen oder Symbol sein. Keine Repräsentation bezieht sich von sich aus auf einen Gegenstand, den sie repräsentiert. Zu wissen, was ein Zeichen bedeutet, heisst zu wissen, wie man das Zeichen gebraucht. Den Gebrauch lernt man im Austausch mit anderen, die bereits wissen, wie das Zeichen verwendet wird. Einmal gelernt, evoziert das Zeichen eine Vorstellung in unserem Bewusstsein. Das Wort ‹Hund› weckt die Vorstellung oder den Begriff eines Hundes, auch wenn aktuell kein Hund anwesend ist. Die Vorstellung selber ist aber nicht ihrerseits eine Repräsentation. Insofern gibt es keine inneren Repräsentationen im Sinne von neuronalen Repräsentationen im Gehirn, es sei denn, wir verwenden den Begriff in einem metaphorischen Sinn.
Insofern haben Maxwell Bennett und Peter Hacker (2010) recht, wenn sie den Begriff der Repräsentation als «Unkraut im Garten der Neurowissenschaften» (S. 188) bezeichnen, ein Unkraut, das mitsamt seinen Wurzeln ausgerottet werden sollte. Da dies jedoch kaum geschehen wird, müssen wir darauf achten, dieser Begriffsverwendung nicht zum Opfer zu fallen.
Repräsentation in den Neurowissenschaften
In den Neurowissenschaften ist allerdings oft von Repräsentation in genau diesem reduzierten Sinn einer lediglich drei- oder sogar nur zweistelligen Relation die Rede. Wie Szücs und Goswami (2007) spricht auch Singer (2002) von Repräsentation, wenn sensorische Signale aus der Umwelt oder aus dem eigenen Körper neuronal codiert werden. Ausdrücklich ist von einer «Repräsentation des Draussen» (S. 70) im Gehirn und einer «Repräsentation von Wahrnehmungsobjekten im Gehirn» (S. 95) die Rede. Damit wird unterstellt, dass zwischen dem wahrgenommenen Gegenstand und der Aktivierung von Nervenzellen im Gehirn eine (kausale) Entsprechung besteht. Diese kann aber nur physikalisch realisiert sein, womit ihr genau das abgeht, was mit dem Repräsentationsbegriff eingefangen werden soll, nämlich Sinn und Bedeutung.
Insofern haben Maxwell Bennett und Peter Hacker (2010) recht, wenn sie den Begriff der Repräsentation als «Unkraut im Garten der Neurowissenschaften» (S. 188) bezeichnen, ein Unkraut, das mitsamt seinen Wurzeln ausgerottet werden sollte. Da dies jedoch kaum geschehen wird, müssen wir darauf achten, dieser Begriffsverwendung nicht zum Opfer zu fallen. Weder können Sinnesorgane dem Gehirn bedeutungshaltige Informationen übermitteln, noch ist das Gehirn von sich aus in der Lage, Sinnesinformationen Bedeutung zuzuweisen. Die saloppe Rede von einem Wissen, das «ins Gehirn gelangt», die sich wiederum bei Wolf Singer häufig findet, unterschlägt das Problem, dass eine neurowissenschaftliche Beschreibung von Hirnprozessen den Horizont geteilter Bedeutungen nicht erreichen kann.
Da Gehirne auf einer rein syntaktischen Basis funktionieren, müsste die Semantik wie bei einem Computer in das Programm eingeschrieben werden, wobei als ‹Programmierer› die Evolutionsgeschichte in Frage käme.
Da Gehirne auf einer rein syntaktischen Basis funktionieren, müsste die Semantik wie bei einem Computer in das Programm eingeschrieben werden, wobei als ‹Programmierer› die Evolutionsgeschichte in Frage käme. Zwar werden solche Ansichten tatsächlich vertreten, wie zum Beispiel in der so genannten Biosemantik (vgl. Millikan, 1989), jedoch ist es mehr als fraglich, ob die menschliche Fähigkeit zum kreativen Gebrauch von sprachlichen und nicht-sprachlichen Bedeutungen in einem Computerprogramm erschöpfend abgebildet werden kann.
Gemäss dem Philosophen Hilary Putnam (1991), der früher selber eine Computeranalogie des menschlichen Geistes vertreten hat, ist die Verknüpfung zwischen Repräsentationen und ihren Bezugsgegenständen «kontingent und kann sich je nach den Veränderungen in der Kultur oder in der Welt wandeln» (S. 56). Was im Gehirn eines Menschen vor sich geht, wird daher nie ausreichen, um die Bedeutung eines Zeichens oder Symbols festzulegen. Wir müssen die Regeln und Konventionen kennen, durch die eine Gemeinschaft von Menschen deren Gebrauch festgelegt hat. Das geht nur, wenn wir das Gehirn verlassen und anerkennen, dass Repräsentationen nicht zwei- oder dreistellige, sondern vierstellige Relationen bilden.

Der Mensch, das symbolgebrauchende Tier
Tiere sind zu Repräsentationen in diesem Sinn nicht fähig. Weder vermögen sie sich mittels Zeichen gemeinsam auf Wirklichkeit zu beziehen, noch sind sie in der Lage, Erinnerungen aktiv in die Gegenwart zu rufen. Das gelegentlich angeführte Beispiel des Bienentanzes kann kaum als Beweis des Gegenteils dienen. Obwohl es verschiedentlich gelungen ist, Schimpansen in Gefangenschaft den Gebrauch von Zeichen beizubringen, sind auch sie nicht in der Lage, grammatikalische Regeln zu lernen und mehr als ein rudimentäres Lexikon aufzubauen. Freilebende Schimpansen bilden spontan keine Zeichen zur Repräsentation von Wirklichkeit. Allein vom Menschen kann man zu Recht sagen, er sei ein animal symbolicum, ein Ausdruck, den Ernst Cassirer (1990) in seinem Essay on Man eingeführt hat.
Aber wie ist es dem Menschen gelungen, zu einem symbolgebrauchenden Lebewesen zu werden? Oder, anders gefragt: Was musste geschehen, damit Gehirne, die per definitionem auf einer sinnfreien Basis funktionieren, Anschluss an kulturelle Errungenschaften gefunden haben, die per definitionem sinnhaft sind? Oder, nochmals anders gefragt: Wie konnte die Kultur Einfluss auf das menschliche Gehirn gewinnen, so dass dieses zu einem «symbolisierenden Organ» (Donald) wurde?
Der Neuropsychologe Merlin Donald (2008), auf den wir im 3. Teil ausführlicher zu sprechen kommen werden, spricht von einer «Symbiose von Gehirn und Kultur» (S. 219) und bestätigt damit, dass es für das Verständnis der kognitiven Leistungen des Menschen unzulänglich ist, sich auf die Erforschung seines Gehirns zu beschränken. Das Problem der Überbrückung von materiellem Gehirn und immaterieller Kultur kann nur gelöst werden, wenn wir in Rechnung stellen, dass kein Gehirn kontextfrei existiert. Ein Gehirn ist in einen Körper eingebunden, der zu einem Lebewesen gehört, das sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und Beziehungen zu anderen Lebewesen pflegt.
Die Neurowissenschaften täten gut daran, sich an der Evolutionsbiologie zu orientieren, die den Organismus und seine Umwelt als Einheit denkt. Wie für den Anthropologen Gregory Bateson (1985, S. 529ff.) die Analyseeinheit der Evolutionstheorie nicht das isolierte Lebewesen, sondern das Lebewesen-in-seiner-Umwelt ist, betonen die Biologen Richard Levins und Richard Lewontin (1985, S. 99), dass es nicht nur keinen Organismus ohne Umwelt, sondern auch keine Umwelt ohne Organismus gibt. Dabei wird der Begriff der Umwelt biologisch verstanden, d.h. nicht als physikalische Umgebung, sondern als ökologische Nische, die gleichermassen als Teil des Lebewesens zu verstehen ist wie dessen Gehirn. Auch die Neurowissenschaften sollten nicht isolierte Hirne erforschen, sondern Hirne in verkörperten Lebewesen, die ihrer natürlichen und sozialen Umwelt angepasst sind.
Kritik der neurowissenschaftlichen Forschungspraxis
Donald (2008) kritisiert die Forschungspraxis der Neurowissenschaften, die aufgrund restringierter Laborbedingungen nur einen engen Ausschnitt an psychischen und geistigen Phänomenen untersuchen können. Vor allem der zeitliche Rahmen neurowissenschaftlicher Studien

ist so gewählt, dass alltägliche Vorgänge ihrer Aufmerksamkeit entgehen. Bewusstseinsphänomene, die sich auf einer mittleren Zeitebene abspielen (Minuten oder Stunden), werden vom Raster der sich im Zehntel- und Hundertstelsekundenbereich bewegenden neuropsychologischen Studien nicht erfasst. Diese mittlere Zeitebene ist für unser alltägliches Verhalten aber von zentraler Bedeutung. Denken wir an ein Gespräch, das wir führen, oder an eine Tätigkeit, die wir ausüben. In unserem Alltag bewegen wir uns vorwiegend in diesem mittleren Zeithorizont.
Einen Schritt weiter geht Donald (2007a) in seiner Kritik, wenn er über eine dritte Form neuronaler Speicherung spekuliert. Da das menschliche Arbeitsgedächtnis nur relativ kurz nutzbar ist und in das Langzeitgedächtnis Informationen nur selektiv aufgenommen werden, bedarf es für mittelfristige Tätigkeiten wie das genannte Gespräch oder die Austragung eines sportlichen Wettkampfs einer Speicherungsmöglichkeit, die zwischen diesen beiden Gedächtnisformen liegt. Man kann sich dies gut am Beispiel von kontradiktorischen Gesprächen wie der «Rundschau» im Schweizer Fernsehen vor Augen führen. Teilnehmende an solchen Gesprächen machen sich oft Notizen, um der Gefahr zu begegnen, dass ihnen ein Gedanke, auf den sie während eines gegnerischen Votums gekommen sind, entfallen könnte. Sie erweitern ihr biologisches Gedächtnis, indem sie ein technisches Hilfsmittel nutzen.
Obwohl heute kaum noch jemand einen solchen ontologischen Dualismus vertritt, sind die Neurowissenschaften, wie Maxwell Bennett und Peter Hacker (2010) in ihrer gründlichen Analyse nachweisen, «noch immer nicht aus Descartes’ Schatten herausgetreten» (S. 145). An die Stelle des isolierten immateriellen cartesischen Geistes setzen sie das genauso isolierte materielle Gehirn.

Die Hirnforschung im Schatten Descartes’
Die Neurowissenschaften werden oft dafür kritisiert, dass sie bei allen Lippenbekenntnissen des Gegenteils, über Descartes nicht hinausgekommen sind. Bekanntlich hatte René Descartes, einer der einflussreichsten Philosophen der europäischen Neuzeit, im Zuge des radikalen Zweifels an der Wahrheit seines Wissens eine strikte Trennung von geistigen und materiellen Phänomenen postuliert. Alles Subjektive und Mentale (eingeschlossen die eigenen Empfindungen, Wahrnehmungen und Gefühle) soll einer immateriellen Substanz (res cogitans) zugehören, die vom Rest der Welt (eingeschlossen der eigene Körper), der als materielle Substanz (res extensa) begriffen wird, absolut verschieden ist.
Obwohl heute kaum noch jemand einen solchen ontologischen Dualismus vertritt, sind die Neurowissenschaften, wie Maxwell Bennett und Peter Hacker (2010) in ihrer gründlichen Analyse nachweisen, «noch immer nicht aus Descartes’ Schatten herausgetreten» (S. 145). An die Stelle des isolierten immateriellen cartesischen Geistes setzen sie das genauso isolierte materielle Gehirn. Der Dualismus von Körper und Geist ist zwar ersetzt worden durch einen Dualismus von Körper und Gehirn, das Gehirn erbringt aber praktisch die gleichen Leistungen, die Descartes zuvor dem unstofflichen Geist zugeschrieben hat. «Es fällt auf», schreiben Bennett und Hacker, «dass die Neurowissenschaften dem Gehirn nahezu dasselbe Eigenschaftsspektrum zuschreiben, das Cartesianer dem Geist zuschrieben» (ebd.).
Erste- und Dritte-Person-Perspektive
Ein deutliches Symptom des unbewältigten Cartesianismus der Neurowissenschaften ist die Unterscheidung zweier Perspektiven zur Beschreibung von Wirklichkeit. Die beiden Perspektiven werden der grammatikalisch ersten und der grammatikalisch dritten Person zugeordnet. Die Erste-Person-Perspektive wird mit der Innenperspektive, in der uns Psychisches erlebnismässig gegeben ist, gleichgesetzt, wie zum Beispiel im Falle einer Farbempfindung, dem Geschmack von Schokolade oder der Erinnerung an einen Traum. Die Dritte-Person-Perspektive wird der für eine Naturwissenschaft charakteristischen Aussenperspektive zugeordnet, die sich im Falle der Neurowissenschaften als ‹Blick ins Gehirn› mittels bildgebender und anderer Verfahren realisiert.
Phänomene der materiellen Wirklichkeit lassen sich in der Dritte-Person-Perspektive objektiv erforschen, indem die Ergebnisse eines Experiments mit anderen Forschenden geteilt werden. Wie kompliziert auch immer die Anfertigung eines Gehirnscans sein mag, als Ergebnis eines Messprozesses ist der Scan öffentlich zugänglich, wiederholbar und kritisierbar. Demgegenüber erschliesst die Erste-Person-Perspektive eine Wirklichkeit, die nach Ansicht vieler Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler allein dem erlebenden Subjekt verfügbar ist. Es handelt sich um Phänomene, die – wie Wolf Singer (2002) formuliert – «nur unserer Selbsterfahrung zugänglich […] sind» (S. 176). Nur ich allein habe Zugang zu den Schmerzen, die ich gerade in meinem linken Fuss verspüre, eine andere Person kann davon nichts wissen.
Gepflegt wird damit nicht nur der cartesische Mythos des sozial isolierten Geistes, sondern auch die Fiktion einer psychischen Innenwelt, die öffentlich unzugänglich ist, da nur ich selbst wissen kann, was in mir vorgeht. Die Dualität von grammatikalisch erster und grammatikalisch dritter Person wird der Unterscheidung von materieller und geistiger Wirklichkeit überstülpt. Das Problem, wie sich von der sinnfreien Wirklichkeit des Gehirns eine Brücke zur sinnhaften Wirklichkeit unserer Lebenswelt schlagen lässt, wird in die Dualität der beiden Beschreibungsperspektiven projiziert. Sinn und Bedeutung werden der mentalen ‹Innenwelt› zugeordnet und von der materiellen ‹Aussenwelt› weggeschlossen.
Wie Wolf Singer (2003) explizit schreibt, sind sinnhafte Gegenstände «nur aus der Erste-Person-Perspektive erfassbar» (S. 11). Damit wird das Problem der Überbrückung von sinnfreier und sinnhafter Wirklichkeit unlösbar. Denn wenn Sinn nur subjektiv realisiert werden kann, bleibt unerfindlich, wie eine gemeinsame (objektive) Wirklichkeit sinnhaft sein kann. Der unbewältigte Cartesianismus der Neurowissenschaften verhindert eine plausible Erklärung mentaler Phänomene.
Erste und zweite Person
Wollen wir der Sackgasse des Cartesianismus entkommen, müssen Sinn und Bedeutung als intersubjektive Phänomene begriffen werden. Relevant ist nicht der grammatikalische Gegensatz von erster und dritter Person, da wir auf diese Weise nie zu gemeinsamen Bedeutungen gelangen können, sondern die Unterscheidung von erster und zweiter Person. Wir können in die Position der dritten Person nur wechseln, wenn wir zuvor im Austausch mit einer zweiten Person ein gemeinsames Verständnis von Wirklichkeit erarbeitet haben. Ohne gemeinsames Verständnis wüssten wir gar nicht, worauf wir uns als Drittperson beziehen.
Als erste und zweite Person sind wir Teilnehmende an einem Gespräch, das auf einem permanenten Rollentausch zwischen sprechender und hörender Person beruht. Einmal rede ich und du hörst mir zu, dann redest du und ich höre dir zu. Auf diese Weise finden wir Zugang zu einer gemeinsamen Wirklichkeit, deren Sinn und Bedeutung wir uns im kommunikativen Austausch erarbeiten. Aus der Koordination unserer beiden Perspektiven geht eine geteilte Perspektive hervor, der sich das grammatikalische Wir zuordnen lässt. Aus den Perspektiven von erster und dritter Person lässt sich dagegen keine Wir-Perspektive gewinnen.
Dies wird von Martin Seel (2005) bestätigt, der ein ausschliesslich beobachtendes Verhalten grundsätzlich für unmöglich hält. «Niemand […] kann reiner Beobachter sein» (S. 145). Ohne Rückbindung an ein gemeinsames Verständnis von Wirklichkeit fänden wir keinen Zugang zur Welt. Für Seel ist daher jede Einstellung, und sei sie noch so distanziert und objektiv, «eine Einstellung der Teilnahme» (ebd.). Was wir als Aussenstehende wahrnehmen, muss sich von anderen beglaubigen oder bezweifeln lassen. Mit diesen anderen stehen wir aber nicht in einer Dritte-Person-, sondern in einer Zweite-Person-Beziehung.
Das gilt gerade auch für die Hirnforschung. Wie Michael Pauen (2012) ausführt, brauchen wir die Perspektive der zweiten Person, um aus der Dritte-Person-Perspektive Aussagen über mentale Zustände zu machen. Denn anders könnten wir gar nicht wissen, worauf wir uns mit unseren Aussagen beziehen. «Wenn wir beispielsweise bei einer Versuchsperson die neuronalen Korrelate von Schmerz identifizieren wollen, müssen wir zuerst sicherstellen, dass sich die Versuchsperson tatsächlich in einem Schmerzustand befindet» (S. 45 – eigene Übersetzung). Das können wir nur, wenn wir mit der Person kommunizieren. Wenn nicht mit leblosen anatomischen Präparaten oder narkotisierten Tieren geforscht wird, sondern mit Menschen im Wachzustand, genügt die Dritte-Person-Perspektive nicht, um zu verlässlichen Resultaten zu kommen.
Die Schmerzen in meinem linken Fuss sind keineswegs mir allein zugänglich, sondern werden durch mein Schmerzverhalten angezeigt und meine Schmerzensäusserungen ausgedrückt. Meine Schmerzen empfinden vermag zwar nur ich allein, jedoch können meine Schmerzensäusserungen von anderen wahrgenommen werden.
Verschränkung von Empfindung und Wahrnehmung
Eine Beobachterperspektive, die nicht mit einer Teilnehmerperspektive vermittelt ist, kommt einer Illusion gleich. Das gilt auch im Verhältnis zu uns selbst. Der gemeinsame Blick auf die Wirklichkeit, der aus dem kommunikativen Austausch von erster und zweiter Person hervorgeht, erschliesst nicht nur die physische Aussenwelt, sondern auch die psychische Innenwelt. Psychisches mag zwar phänomenal innen sein, zugänglich ist es aber auch von aussen. Dadurch nämlich, dass sich erste und zweite Person körperlich (gestisch) und lautlich (sprachlich) artikulieren und dem Gegenüber anzeigen, was in ihnen vorgeht, zum Beispiel durch Ausdruck ihrer Gefühle oder durch Äusserung ihrer Gedanken. Psychisches ist nicht in hermetisch abgedichteten Räumen weggeschlossen, in denen wir gleichsam in Einzelhaft sässen. Vielmehr zeigt sich Psychisches in unseren körperlichen Regungen und in unserem Verhalten und kann anhand von Kriterien identifiziert werden.
Die Schmerzen in meinem linken Fuss sind keineswegs mir allein zugänglich, sondern werden durch mein Schmerzverhalten angezeigt und meine Schmerzensäusserungen ausgedrückt. Meine Schmerzen empfinden vermag zwar nur ich allein, jedoch können meine Schmerzensäusserungen von anderen wahrgenommen werden. Für die Sprache, in der wir über Psychisches reden, ist diese doppelte Verankerung im subjektiven Erleben und im objektiven Verhalten charakteristisch. Wir schreiben anderen Menschen psychische oder geistige Zustände nicht aufgrund einer theoretischen Analyse ihres Verhaltens zu und ziehen auch keine Analogieschlüsse über Fremdpsychisches, sondern nutzen unser psychologisches Alltagswissen, das uns anhand von Kriterien erkennen lässt, in welcher Verfassung sich eine andere Person befindet.
Die Person als psychophysische Einheit
Wie für die Sprache, in der wir über Psychisches reden, Inneres und Äusseres ineinander verschränkt sind, ist für den Begriff der Person kennzeichnend, dass Körperliches und Geistiges zusammengehören. In einer scharfsinnigen Analyse weist der britische Philosoph Peter Frederick Strawson (1972) nach, dass wir wahrnehmbare Objekte in zwei Kategorien einteilen, nämlich in materielle Gegenstände und Personen. In beiden Fällen handelt es sich um sprachlich primitive Begriffe, die nicht weiter zerlegt werden können. Für den Begriff der Person heisst dies, dass wir es mit einer unteilbaren Einheit von Körper und Geist zu tun haben.
Wir sagen von einer Person nicht nur, dass sie 83 Kilogramm wiegt und 1.92 Meter gross ist, sondern auch, dass sie beabsichtigt, nach London zu reisen oder sich nicht mehr an den Namen ihrer ehemaligen Nachbarin erinnern kann. Wir sagen dies von ein und derselben Person und nicht das eine von ihrem Körper und das andere von ihrem Geist. Die cartesische Zweiteilung der Welt in Körper und Geist stellt eine Abstraktion dar, die auf der ontologisch grundlegenden Ebene, die Strawson im Blick hat, nicht vorgenommen werden kann. Bewusstseinstatsachen wie Absichten, Gedanken oder Gefühle können nur zugeschrieben werden, wenn sie einem Wesen zugeschrieben werden, das über einen Körper verfügt.
Als Menschen sind wir soziale Wesen, die nicht im Alleingang zu Sinn und Bedeutung finden, sondern nur im kommunikativen Austausch mit anderen Menschen.
Naturwissenschaftliche Forschung am Menschen
Das wird von Neurowissenschaftlern wie Wolf Singer und Gerhard Roth schlichtweg verkannt, obwohl sie ihre Experimente nicht durchführen könnten, wenn sie davon ausgehen müssten, dass die Berichte ihrer Versuchspersonen über ihre Wahrnehmungen oder Empfindungen rein subjektiv wären. Was könnte aus der Aussenperspektive der dritten Person erforscht werden, wenn die Innenperspektive der ersten Person nicht mitteilbar wäre? Wonach wollten Roth und Singer im Gehirn suchen, wenn ihnen nicht vorweg bekannt wäre, was es bedeutet, sich in einem bestimmten kognitiven oder emotionalen Zustand zu befinden? Roth und Singer klammern die Existenz der zweiten Person aus und reduzieren das Problem einer naturalistischen Erklärung von Sinn und Bedeutung auf das Verhältnis von erster und dritter Person, womit es – wie wir bereits festgestellt haben – unlösbar wird.
Anders als in naturwissenschaftlichen Disziplinen, die sich ausschliesslich mit Gegenständen der dinglichen Wirklichkeit befassen, ist naturwissenschaftliche Forschung am Menschen ohne Verständigung zwischen forschender und erforschter Person nicht möglich. Wie Howard Gardner (1985) schon Mitte der 1980er Jahre feststellte, ist es «nicht möglich, als desinteressierter Beobachter, der lediglich Fakten aufzeichnet, in das Nervensystem einzudringen» (S. 287 – eigene Übersetzung). Was Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken sind, können wir als Beobachter in der Dritte-Person-Perspektive nur wissen, wenn wir zuvor als Teilnehmende an einem Dialog zwischen erster und zweiter Person gelernt haben, wie man über Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken kommuniziert. Nur auf diese Weise kommen wir zu einer Wir-Perspektive, die es erlaubt, neuropsychologische Forschung zu betreiben.
Descartes’ Cogito-Argument wird damit vom Kopf auf die Füsse gestellt. Nicht eine mir allein zugängliche subjektive Innenwelt ist das Erste, wovon wir ausgehen müssen, sondern eine intersubjektive Wirklichkeit, die wir miteinander teilen. Psychisches und Geistiges erschliessen sich uns nicht, indem wir nach einem Ort Ausschau halten, zu dem jede und jeder für sich einen privilegierten Zugang hat, sondern indem wir uns Zeichen und Symbole aneignen, die psychischen und mentalen Phänomenen Bedeutung verleihen. Als Menschen sind wir soziale Wesen, die nicht im Alleingang zu Sinn und Bedeutung finden, sondern nur im kommunikativen Austausch mit anderen Menschen.
Ausblick
Damit haben wir das Terrain bereinigt und die Hindernisse, die einem Brückenschlag zwischen der sinnfreien Welt des Gehirns und der sinnhaften Welt unseres Alltags im Wege stehen, aus dem Weg geräumt. Im 2. Teil des Beitrags wird es darum gehen, die vorbereitenden Überlegungen so zu erweitern, dass verständlich werden kann, wie Gehirn und Kultur in der Evolutionsgeschichte des Menschen jene Symbiose eingehen konnten, die wir im Titel des Beitrags als charakteristisch für den Menschen postulieren.