Brückenschlag zwischen den Sprachspielen
Die Empfehlungen, mit denen sich Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler an die pädagogische Praxis wenden, zeigen allerdings auch, wie schwer sich die Erste-Person-Perspektive mit der Dritten-Person-Perspektive verbinden lässt. Wenn zum Beispiel Wolf Singer (2002a) von den Mechanismen spricht, «über welche Wissen ins Gehirn gelangt» (S. 43) und «dort verankert wird» (S. 87), oder wenn er fragt, wie «Wissen in den Kopf kommt» (Singer, 2004, S. 54), dann ist schlicht unklar, wovon überhaupt die Rede ist. Denn im Kopf und im Gehirn gibt es, wie wir bereits vermerkt haben, keine Gedanken und kein Wissen, weshalb auch keine Gedanken und kein Wissen ins Gehirn gelangen und dort verankert werden können. Wissen kann wahr oder falsch sein, im Gehirn gibt es aber weder Wahrheit noch Falschheit, sondern lediglich anatomische Strukturen, Hirnareale, Neuronen und Synapsen. «Alles Wissen, über das ein Gehirn verfügt», schreibt Singer (2004) selber, «residiert in seiner funktionellen Architektur, in der spezifischen Verschaltung der vielen Milliarden Nervenzellen» (S. 54). Wie also muss man es anstellen, Wissen in die neuronalen Netzwerke von Gehirnen zu bringen?
Wissen kann wahr oder falsch sein, im Gehirn gibt es aber weder Wahrheit noch Falschheit, sondern lediglich anatomische Strukturen, Hirnareale, Neuronen und Synapsen.

Die Frage richtet sich auch an den Neurowissenschaftler Dénes Szücs und die Neurowissenschaftlerin Usha Goswami (2007), die die Aufgabe der Neuropädagogik darin sehen, die Grundlagen zu schaffen, damit im Unterricht durch die gezielte Auslösung von Erfahrungen auf die Gehirne der Schülerinnen und Schüler eingewirkt werden kann. Dabei unterstellen sie, dass Informationen neurologisch in Form von elektrochemischen Aktivitätsmustern codiert werden, die sich durch direkte Beeinflussung verändern lassen. Der Unterricht verliert den Charakter eines symbol- bzw. zeichenvermittelten Kommunikationsprozesses, denn pädagogisch relevant ist – wenn wir Szücs und Goswami (2007) folgen – nicht mehr die soziale Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern, sondern der direkte Zugriff auf deren Gehirne.
Das ist immerhin konsequent gedacht, denn die Dritte-Person-Perspektive, in der die Naturwissenschaften an ihren Gegenstand herangehen, ist prinzipiell sinnfrei. Auch wenn dies im Falle der Biologie nicht ganz zutrifft, da Lebensphänomene in gewisser Hinsicht durchaus Sinn machen (z.B. in Bezug auf die Fortpflanzung oder die Selbsterhaltung eines Lebewesens), so handelt es sich dabei um standardisierten Sinn, während Sinnhaftes im Falle des Menschen mehr umfasst und auch persönlichen Sinn meint. Dieser Sinn ist naturwissenschaftlich nicht einholbar. Gerhard Roth (2009) bringt es daher auf den Punkt, wenn er darauf hinweist, dass für die Hirnforschung «ein Brückenschlag zwischen bedeutungsfreien und bedeutungshaften, erklärenden und verstehenden Prozessen unverzichtbar (ist)» (S. 227). Ein solcher Brückenschlag zwischen den Sprachspielen der ersten und der der dritten Person verbietet es aber, die Begriffe «Wissen» und «Gehirn» ohne Kommentar in einem Atemzug zu nennen.
Sprachverwirrung
Niemandem ist es bisher gelungen, die geforderte Brücke zwischen den Sprachspielen der naturwissenschaftlichen Hirnforschung und der alltäglichen Lebenswelt zu schlagen. Es gibt bislang auch keine «Metasprache», wie sie von Wolf Singer (2002a, S. 174) gefordert wird, mittels derer die Sprachspiele ineinander übersetzt werden könnten. Darin liegt der Grund für die grassierende Sprachverwirrung in der neuropädagogischen und neurodidaktischen Literatur. Statt überbrückt, werden die Sprachspiele kurzgeschlossen.

Ein besonders deutliches Beispiel gibt der selbst erklärte Neurodidaktiker Ulrich Herrmann (2004), bei dem man lesen kann: «das Gehirn organisiert und generiert Informationen und ihre regelhaften Verknüpfungen; es bewertet neue Informationen nach Neuigkeit und Bedeutung und entscheidet von sich aus über Erinnern und Vergessen» (S. 472 – Hervorhebungen im Original). Dem Gehirn werden Leistungen attestiert, die wir eigentlich Personen zuschreiben. Leicht finden sich auch Beispiele, wonach nicht das Kind neugierig ist, sondern sein Gehirn, nicht das Kind wahrnimmt, sondern sein Gehirn, nicht das Kind versteht, sondern sein Gehirn, nicht das Kind lernt, sondern sein Gehirn, nicht das Kind etwas weiss, sondern sein Gehirn etc. Das kann so weit gehen, dass die Referenz zwischen Kind und Gehirn innerhalb eines Textes, ja innerhalb ein und desselben Satzes hin und her springt.
Ein schlagendes Beispiel für die Sprachverwirrung gewisser pädagogisierender Hirnforscherinnen und Hirnforscher gibt eine Passage aus einem Text von Gerhard Roth. Roth (2004b) erläutert, weshalb Bedeutungen nicht übertragen werden können, sondern konstruiert werden müssen – ein Grundpostulat des Konstruktivismus, das nicht weiter kontrovers ist. Aber wer ist das Subjekt der Konstruktion von Bedeutung? Roth larviert zwischen dem Gehirn und der Person, wie das folgende Zitat zeigt: «Der Chef steht mit hochrotem Kopf vor dem

Mitarbeiter und schreit ‹raus!›. Da braucht das Gehirn des Mitarbeiters nicht viel zu konstruieren, was das Gegenüber meint. Bei langen gelehrten Vorträgen von Kollegen hingegen fragt man sich häufig: ‹Was meint er? Worauf will er hinaus? Was ist überhaupt das Problem?›, weil im Zuhörer das nötige Vorwissen und der Bedeutungskontext nicht klar sind, die im Gehirn des Kollegen herrschten, als er seine Sätze formulierte» (S. 498). Wer also ist das Subjekt der Konstruktion von Bedeutung: der Mitarbeiter oder sein Gehirn, der Referent oder sein Gehirn, die Person oder ihr Gehirn?
Kann man das Gehirn – um ein anderes Beispiel zu nehmen – eine «Lernmaschine» (Spitzer, 2002, S. XVI) und eine «statistische Regelextraktionsmaschine» (S. 322) nennen und ihm zugleich den Status eines Akteurs zuschreiben? Wenn man das Gehirn schon mit einer Maschine vergleichen will, dann ist es – nicht anders wie ein Computer – eine rein syntaktische Maschine. Da Neuronen, wie Spitzer selber schreibt, subsymbolisch arbeiten (S. 54), finden sich im Gehirn weder Bedeutungen noch eine Semantik. Der Blick ins Gehirn fördert nicht nur keine Gedanken und kein Wissen zutage, sondern auch keine Zeichen oder Symbole, die sich entziffern oder entschlüsseln liessen.
Was im Gehirn übertragen wird, sind Signale im Sinne der Nachrichtentechnik, d.h. elektrische Impulse ohne semantische Dimension.
Was im Gehirn übertragen wird, sind Signale im Sinne der Nachrichtentechnik, d.h. elektrische Impulse ohne semantische Dimension. Deshalb ist auch der viel gebrauchte Informationsbegriff ungeeignet, um Klarheit zu schaffen. Denn Information im nachrichtentechnischen bzw. kybernetischen Sinn weist ebenfalls keine semantische Dimension auf. Auch wenn öfter von einem «neuronalen Code» die Rede ist, haben wir es – genauso wenig wie im Falle des «genetischen Codes» (vgl. Kay, 2005) – mit der Verschlüsselung von Bedeutungen zu tun, sondern mit neuralen Aktivitätsmustern.
Da wir Personen und nicht Gehirnen den Subjektstatus zuschreiben, dient der ständige Wechsel zwischen Gehirn und Person letztlich nur einem Zweck: der Verschleierung der Tatsache, dass es nicht gelingt, das Brückenproblem (wie wir es nennen können) zu lösen.
Mereologischer Trugschluss
Da wir Personen und nicht Gehirnen den Subjektstatus zuschreiben, dient der ständige Wechsel zwischen Gehirn und Person letztlich nur einem Zweck: der Verschleierung der Tatsache, dass es nicht gelingt, das Brückenproblem (wie wir es nennen können) zu lösen. Das Brückenproblem besteht darin, dass die Neurowissenschaften der Pädagogik nur dann etwas zu sagen haben, wenn sie in der Lage sind, zwischen der bedeutungsfreien (‹sinnlosen›) Welt der Hirnforschung und der bedeutungshaltigen (‹sinnvollen›) Welt der pädagogischen Praxis zu vermitteln. Da bisher niemand weiss, wie das Gehirn Bedeutungen hervorbringt, verheddert man sich in einer irrlichternden Begrifflichkeit und einer konfusen Terminologie.
Die Verwirrung der Sprachspiele hat auch einen Namen: mereologischer Trugschluss. Einfach gesagt, besteht ein mereologischer Trugschluss – oder wie der Neurobiologe Maxwell Bennett und der Philosoph Peter Hacker korrekter sagen: eine mereologische Verwechslung – darin, dass ein Merkmal, das auf ein Ganzes zutrifft, einem Teil des Ganzen zugeschrieben wird. Insofern ein Gehirn kein selbständiges Wesen ist, sondern Teil eines Menschen bildet, ist es falsch, vom «Lernen des Gehirns», von der «Wahrnehmung des Gehirns» oder von den «Empfindungen des Gehirns» zu sprechen. Denn Subjekt des Lernens, des Wahrnehmens und des Empfindens ist der Mensch (das Ganze) und nicht das Gehirn (ein Teil des Ganzen). «Psychologische Prädikate», schreiben Bennett und Hacker (2010), «sind Prädikate, die notwendigerweise auf das ganze Lebewesen zutreffen, nicht auf Teile von ihm» (S. 93).
Wenn Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler die Sprachspiele durchmischen und Gehirnen Leistungen zuschreiben, die nur Personen zukommen können, dann ist dies ein übles Manöver, da den Pädagoginnen und Pädagogen suggeriert wird, ihre Praxis lasse sich neurowissenschaftlich substituieren, während wir in Wahrheit meilenweit davon entfernt sind.
Ein ‹sinnloser› Lernbegriff
Wir sind nicht zuletzt deshalb meilenweit von einer neurowissenschaftlichen Substituierung des Unterrichts entfernt, weil der Lernbegriff der Hirnforschung rein formal begründet ist. Darin zeigt sich die behavioristische Erblast der Neurowissenschaften. Lernen ist Veränderung von Verhalten (Behaviorismus) oder Veränderung von synaptischen Verbindungen (Hirnforschung). Weder für den behavioristischen noch für den neurowissenschaftlichen Lernbegriff spielen die Inhalte des Lernens eine Rolle. Damit kann man zwar sagen, wie gelernt wird, aber nicht, wie etwas gelernt wird. Ausschlaggebend für das schulische Lernen ist aber nicht die Form, sondern der Inhalt des Lernens.
Der neurowissenschaftliche Lernbegriff ist aber nicht nur formal, sondern auch hochgradig abstrakt. Das ergibt sich aus einer weiteren Parallele zwischen Behaviorismus und Neurowissenschaften. Wie die Behavioristen zwischen tierischem und menschlichem Verhalten keinen Unterschied machten, weshalb die behavioristischen Lernprinzipien (z.B. das Prinzip der Verstärkung) für jede Art von Lebewesen Gültigkeit beanspruchen, wird in den Neurowissenschaften davon ausgegangen, dass es bezüglich des Lernens von Tieren und Menschen keine nennenswerten Unterschiede gibt. Dies deshalb, weil «menschliche und tierische Gehirne sich fast nicht unterscheiden» (Singer, 2004, S. 37).
Was bei Schnecken und anderen Weichtieren über zelluläre Eigenschaften bekannt ist, lässt sich gemäss Wolf Singer (2002a) «in der Regel direkt auf höhere Säuger und den Menschen übertragen» (S. 63). Es gibt zudem «fast keine Überträgersubstanzen im Säugetiergehirn, die nicht auch schon in einfachen Organismen, wie Insekten und Schnecken, zu finden wären» (ebd.). Selbst die Architektur des Gehirns ist bei Menschen und Tieren nicht wesentlich verschieden. Wie auch Gerhard Roth (1997) bemerkt, kann am menschlichen Gehirn «im Vergleich zu den ihm stammesgeschichtlich nahestehenden Tieren nichts grundlegend Neues und Anderes festgestellt werden» (S. 76). Lernen lässt sich daher ohne weiteres auf einer höchst abstrakten Ebene als Veränderung in der Verbindung von Nervenzellen definieren. Auch erforschen lässt sich das Lernen – wie schon im Behaviorismus – genauso gut an Tieren wie am Menschen.
Was können ein Lehrer und eine Lehrerin mit diesem Lernbegriff anfangen? Kann der Gehirnscan eines Schülers, der den Satz des Pythagoras partout nicht verstehen will, der ratlosen Lehrperson weiterhelfen?
Wie es bei Manfred Spitzer (2002) heisst, «besteht jegliches Lernen neurobiologisch betrachtet in der Veränderung der Stärke synaptischer Übertragung. Immer dann, wenn gelernt wird, nimmt die Stärke der Verbindung zwischen Neuronen zu» (S. 277). In ihrer didaktischen Belanglosigkeit ist eine solche Aussage kaum zu überbieten. Was können ein Lehrer und eine Lehrerin mit diesem Lernbegriff anfangen? Kann der Gehirnscan eines Schülers, der den Satz des Pythagoras partout nicht verstehen will, der ratlosen Lehrperson weiterhelfen? Wie das Lernen der behavioristischen Psychologie hat das Lernen der Neurowissenschaften mit dem schulischen Lernen wenig bis gar nichts zu tun. Wie der Erziehungswissenschaftler Thomas Müller (2007) zu Recht feststellt, ist pädagogisch nicht ein Lernbegriff gefordert, der sich auf die Kontinuitäten und Gemeinsamkeiten zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen abstützt, «sondern auch oder gerade Diskontinuitäten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Spezies berücksichtigt» (S. 211).
Sinnhaftes Lernen
Schulisches Lernen ist auf Inhalte bezogen, die Sinn machen und eine sachliche Gliederung aufweisen, an der sich die Gestaltung des Unterrichts orientieren kann. Im Lernverständnis der Hirnforschung haben Inhalte aber keinen Platz, weshalb sich sinnhaftes Lernen in den neurologischen Strukturen des Gehirns auch nicht abbilden lässt. Wenn sich Manfred Spitzer (2002) dem Mathematikunterricht zuwendet, wechselt er daher nicht zufällig das Sprachspiel. «Gerade in der Mathematik» sei «die so viel zitierte Vernetzung der zu lernenden Inhalte von grösster Bedeutung» (S. 275 – meine Hervorhebung). Damit hat er den formalen und abstrakten Lernbegriff der Neurowissenschaften hinter sich gelassen, muss sich aber nun die Frage gefallen lassen, wie er den Rollenwechsel vom Spezialisten für synaptische Verbindungen zum Mathematikdidaktiker bewerkstelligen kann. Lernen im Mathematikunterricht ist sinnvolles Lernen und setzt voraus, dass die Lernenden verstehen, worum es geht. Ein Gehirn dagegen versteht nichts davon, was in ihm abläuft.
Nach geläufiger Ansicht ist Verstehen Einordnen in einen grösseren Zusammenhang. Damit besteht immer die Möglichkeit des Missverstehens. Dann nämlich, wenn der Lerngegenstand in einen falschen oder unpassenden Kontext eingeordnet wird. Schulisches Lernen steht daher auch unter dem normativen Anspruch, richtig oder falsch zu sein. Auch dafür findet sich im Gehirn keine Entsprechung. Denn genauso wenig wie es im Gehirn einen Massstab gibt, mit dem sich über wahr oder falsch entscheiden liesse, gibt es einen Massstab, um Richtiges und Falsches abzumessen. Auch Irrtümer gibt es im Gehirn nicht, während sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer in Vielem irren können. Was immer mit dem Begriff der Neurodidaktik gemeint ist, begründen lässt sich schulisches Lernen mit den Mitteln, die von den Neurowissenschaften zur Verfügung gestellt werden, nicht. Ralph Schumacher (2006) spricht daher zu Recht von der prinzipiellen Unterbestimmtheit der Hirnforschung im Hinblick auf die Gestaltung von schulischem Unterricht.
Es ist unnötig zu betonen, dass auch in der Schule ohne Gehirne nicht gelernt werden kann. Die Rede vom «gehirngerechten» oder «gehirnbasierten» Lernen ist daher pleonastisch, denn selbstverständlich hat alles Lernen eine neurologische Grundlage. Aber bei der Unterrichtsgestaltung spielen die Gehirne der Schülerinnen und Schüler bestenfalls eine Nebenrolle. Zwar findet ohne Veränderung in den neuralen Netzwerken der Schülerinnen und Schüler kein Lernen statt, von ausschlaggebender Bedeutung für das Handeln der Lehrerinnen und Lehrer sind diese Veränderungen aber nicht, und sei es nur, weil den Lehrpersonen der Blick ins Gehirn der Lernenden verwehrt ist.
Besonnene Vertreterinnen und Vertreter der Neurowissenschaften sind sich dieser Tatsache bewusst. Sie zeigen sich skeptisch gegenüber den überzogenen Versprechungen von Neuropädagogik und Neurodidaktik, wie zum Beispiel der Zürcher Neuropsychologe Lutz Jäncke (2009), der «eine metastatisch anmutende Flut von wenig durchdachten Übertragungsversuchen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf den Schulalltag» (S. 47) beobachtet. Noch weiter geht ein dezidierter Kritiker der Neuropädagogik wie Jeffrey Bowers (2016): «Es ist schwer zu sehen, wie die Neuropädagogik den Unterricht jemals wird verbessern können» (S. 607 – eigene Übersetzung).
Da Lehrpersonen in neurowissenschaftlicher Hinsicht in der Regel Laien sind, sind die Studien nicht ohne Brisanz. Die Glaubwürdigkeit einer Erklärung psychischer Phänomene scheint für neurowissenschaftliche Laien grösser zu sein, wenn auf Hirnstrukturen und Hirnfunktionen verwiesen wird, als wenn lediglich Verhaltensdaten im Spiel sind.
Die Nervenzelle als Urgrund des Seins
Fragen wir uns noch, weshalb die Hirnforschung in pädagogischen Kreisen so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen vermag. Offenbar geht von neurowissenschaftlichen Studien eine verführerische Suggestivkraft aus. Darauf deutet eine Studie hin, in der drei Gruppen von Versuchspersonen – Laien, Studierende einer neurowissenschaftlichen Einführungsveranstaltung sowie Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler – Aussagen vorgelegt wurden, die sie hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit zu beurteilen hatten (vgl. Weisberg, Keil, Goodstein, Rawson & Gray, 2008). Die Aussagen enthielten Erklärungen für psychische Phänomene, die 1) entweder in sich schlüssig (gute Erklärung) oder nicht schlüssig (schlechte Erklärung) waren und sich auf neuropsychologische Begründungen stützten, die 2) entweder sachlich relevant oder sachlich irrelevant waren. Die vier Aussagenvarianten wurden kombiniert und den drei Versuchsgruppen vorgelegt. Es zeigte sich, dass die beiden Nicht-Expertengruppen (Laien und Studierende) schlechte Erklärungen für psychische Phänomene eher für korrekt hielten, wenn sie mit neurowissenschaftlichen Hinweisen versehen waren, und zwar auch dann, wenn die Hinweise sachlich irrelevant waren. Die dritte Versuchsgruppe (neurowissenschaftliche Expertinnen und Experten) liessen sich erwartungsgemäss durch die sachwidrigen Hinweise nicht beirren. Die Ergebnisse sind inzwischen durch weitere Studien bestätigt worden (vgl. Weisberg, Taylor & Hopkins, 2015).
Ein naturalistischer Reduktionismus nach dem Motto «Geist ist, was das Gehirn tut», scheint sich nicht nur in unserer Gesellschaft generell, sondern insbesondere auch in pädagogischen Kreisen breitzumachen.
Da Lehrpersonen in neurowissenschaftlicher Hinsicht in der Regel Laien sind, sind die Studien nicht ohne Brisanz. Die Glaubwürdigkeit einer Erklärung psychischer Phänomene scheint für neurowissenschaftliche Laien grösser zu sein, wenn auf Hirnstrukturen und Hirnfunktionen verwiesen wird, als wenn lediglich Verhaltensdaten im Spiel sind. Von Bildern von Gehirnen und Gehirnschnitten scheint eine zusätzliche Suggestivität auszugehen, wie eine weitere Studie zeigt (vgl. McCabe & Castel, 2008). Je tiefer eine Erklärung in die neuronalen Grundlagen unserer Existenz hinabreicht, desto eher scheint ihr Vertrauen entgegengebracht zu werden. Ein naturalistischer Reduktionismus nach dem Motto «Geist ist, was das Gehirn tut», scheint sich nicht nur in unserer Gesellschaft generell, sondern insbesondere auch in pädagogischen Kreisen breitzumachen. Als ob in der Nervenzelle der Urgrund menschlichen Seins liegen würde.
Ausblick
Das ist ein problematischer Trend, insbesondere im Hinblick auf die einleitend angesprochene Thematik einer Pädagogischen Anthropologie. Problematisch ist der naturalistische Reduktionismus, weil das Gehirn aus seiner Einbettung in biologische, soziale und kulturelle Kontexte herausgelöst und zur «eigentlichen» Determinante für pädagogische Entscheidungen erklärt wird. Dadurch ergibt sich ein armseliges Bild dessen, was den Menschen ausmacht und was die Aufgaben von Bildung und Erziehung sind. Der Reduktionismus verbindet sich mit einem verfehlten Glauben an den Determinismus, womit der Überzeugung von der Bildsamkeit des Menschen zu vernünftiger und verantwortlicher Selbstbestimmung gleichsam der Boden unter den Füssen weggezogen wird.
Ich werde daher in einem folgenden Beitrag für den Condorcet-Blog, der noch in Ausarbeitung ist, einen alternativen Zugang zur Nutzung der Neurowissenschaften diskutieren und dabei das Brückenproblem, wie ich es genannt habe, ins Zentrum stellen. Solange menschliche Gehirne nicht direkt beeinflussbar sind, liegt zwischen der Lehrperson und ihren Schülerinnen und Schülern ein Meer von Bedeutungen – der Neuropädagoge Paul Howard-Jones (2008) spricht von einem «Meer von Symbolen, die die menschliche Kommunikation in all ihren Formen repräsentieren» (S. 373 – eigene Übersetzung). Dieses Meer an Symbolen und Zeichen muss durchquert bzw. überbrückt werden, wenn Lernen in Gang gesetzt werden soll. Wie dieses Meer angesichts von Gehirnen, in denen sich nichts dergleichen wie Sinn und Bedeutung findet, im Verlauf der evolutionären und kulturellen Geschichte des Menschen entstehen konnte, ist die Frage, der ich nachgehen möchte.
Literaturverzeichnis
Battro, Antonio M. (2010). The Teaching Brain. Mind, Brain and Education, 4, 28-33.
Bennett, Maxwell R. & Peter M. S. Hacker (2010). Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Bowers, Jeffrey S. (2016). The Practical and Principled Problems With Educational Neuroscience. Psychological Review, 123, 600–612.
Braun, Anna Katharina & Michaela Meier (2004). Wie Gehirne laufen lernen oder: «Früh übt sich, wer ein Meister werden will». Überlegungen zu einer interdisziplinären Forschungsrichtung «Neuropädagogik». Zeitschrift für Pädagogik, 50, 507-520.
Bruer, John T. (1997). Education and the Brain: A Bridge Too Far. Educational Researcher, 26(8), 4-16.
Das Manifest (2004). Elf führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. Gehirn & Geist, Heft 6, 30-37.
Dichgans, Johannes (1994). Die Plastizität des Nervensystems. Konsequenzen für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 40, 229-246.
Falkenburg, Brigitte (2012). Mythos Determinismus. Wieviel erklärt uns die Hirnforschung? Berlin: Springer.
Feiler, Jacob B. & Maureen E. Stabio (2018). Three Pillars of Educational Neuroscience from Three Decades of Literature. Trends in Neuroscience and Education, 13, 17-25.
Fuchs, Thomas (2020). Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Berlin: Suhrkamp.
Fuller, Jocelyn K. & James G. Glendening (1985). The Neuroeducator: Professional of the Future. Theory Into Practice, 24, 135-137.
Giesinger, Johannes (2006). Erziehung der Gehirne? Willensfreiheit, Hirnforschung und Pädagogik. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9, 97-109.
Hasler, Felix (2012). Neuromythologie. Eine Streitschrift gegen die Deutungsmacht der Hirnforschung. Bielefeld: transcript.
Herrmann, Ulrich (2004). Gehirnforschung und die Pädagogik des Lehrens und Lernens: Auf dem Weg zu einer «Neurodidaktik»? Zeitschrift für Pädagogik, 50. 471-474.
Herrmann, Ulrich (2008). Lernen – vom Gehirn aus betrachtet. Wie schulisches Lernen verbessert werden kann: Neurowissenschaften und Pädagogik auf dem gemeinsamen Weg zur Neurodidaktik. Gehirn & Geist, Heft 12, 44-48.
Howard-Jones, Paul (2008). Philosophical Challenges for Researchers at the Interface between Neuroscience and Education. Journal of Philosophy of Education, 42, 361-380.
Huber, Matthias (2015). Neuropädagogische Massgeblichkeiten? Pädagogische Spurensicherung neurowissenschaftlicher Bildungsempfehlungen. In Sabine Krause & Ines Maria Breinbauer (Hrsg.), Im Raum der Gründe. Einsätze theoretischer Erziehungswissenschaft IV (S. 161–184). Würzburg: Königshausen & Neumann.
Hüther, Gerald (2004). Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. Welche sozialen Beziehungen brauchen Schüler und Lehrer? Zeitschrift für Pädagogik, 50, 487-495.
Jäncke, Lutz (2009). Neuro-Pädagogik: Ein Irrtum? Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 9(4), 33-49.
Kagan, Jerome (2000). Die drei Grundirrtümer der Psychologie. Weinheim: Beltz.
Kay, Lily E. (2005). Das Buch des Lebens. Wer schrieb den genetischen Code? Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Keil, Geert (2009). Willensfreiheit und Determinismus. Stuttgart: Reclam.
Markowitsch, Hans J. (2004). Warum wir keinen freien Willen haben. Der sogenannte freie Wille aus Sicht der Hirnforschung. Psychologische Rundschau, 55, 163-168.
Mausfeld, Rainer (2007). Über Ziele und Grenzen einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise zur Erforschung des Geistes. In Adrian Holderegger, Beat Sitter-Liver, Christian W. Hess & Günter Rager (Hrsg.), Hirnforschung und Menschenbild. Beiträge zur interdisziplinären Verständigung (S. 21-39). Freiburg i.Ue.: Academic Press.
McCabe, David P. & Alan D. Castel (2008). Seeing Is Believing: The Effect of Brain Images on Judgments of Scientific Reasoning. Cognition, 107, 343-352.
Metzinger, Thomas (2006). Der Preis der Selbsterkenntnis. Gehirn & Geist, Heft 7/8, 42-49.
Müller, Thomas (2007). Lernende Gehirne. Anthropologische und pädagogische Implikationen neurobiologischer Forschungspraxis. In Ulrike Mietzner, Heinz-Elmar Tenorth & Nicole Welter (Hrsg.), Pädagogische Anthrolpologie – Mechanismus einer Praxis (S. 202-219). Weinheim: Beltz.
Pauen, Michael (2007). Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes. München: Deutsche Verlags Anstalt.
Pauen, Michael & Gerhard Roth (2008). Freiheit, Schuld und Verantwortung. Grundzüge einer naturalistischen Theorie der Willensfreiheit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Pflüger, Hans-Joachim (2006). Von den Neurowissenschaften erziehen lernen? In Annette Scheunpflug & Christoph Wulf (Hrsg.), Biowissenschaft und Erziehungswissenschaft (S. 43-49). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Prinz, Wolfgang (2004a). Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch. In Christian Geyer (Hrsg.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente (S. 20-26). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Prinz, Wolfgang (2004b). Kritik des freien Willens. Bemerkungen über eine soziale Institution. Psychologische Rundschau, 55, 198-206.
Rösler, Frank (2004). Es gibt Grenzen der Erkenntnis – auch für die Hirnforschung! Gehirn & Geist, Heft 6, 32.
Roth, Gerhard (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Roth, Gerhard (2004a). Worüber dürfen Hirnforscher reden – und in welcher Weise? Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 52, 223-234.
Roth, Gerhard (2004b). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? Zeitschrift für Pädagogik, 50, 496-506.
Roth, Gerhard (2008). Homo neurobiologicus – ein neues Menschenbild? Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 44/45, 6-12.
Roth, Gerhard (2009). Aus Sicht des Gehirns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Schumacher, Ralph (2006). Die prinzipielle Unterbestimmtheit der Hirnforschung im Hinblick auf die Gestaltung schulischen Lernens. In Dieter Sturma (Hrsg.), Philosophie und Neurowissenschaften (S. 167-186). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Singer, Wolf (2002a). Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Singer, Wolf (2002b). «Ein Frontalangriff auf unser Selbstverständnis und unsere Menschenwürde». Interview mit Wolf Singer und Thomas Metzinger. Gehirn & Geist, Heft 4, 32-35.
Singer, Wolf (2003). Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Singer, Wolf (2004). Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen. In Christian Geyer (Hrsg.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente (S. 30-65). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Spitzer, Manfred (2002). Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Berlin: Springer.
Spitzer, Manfred (2003). Unter Strom. Die Hirnforschung darf als Schlüssel zum Lernen nicht ignoriert werden. Frankfurter Rundschau Nr. 251 vom 28.10.2003, S. 31.
Szücs, Dénes & Usha Goswami (2007). Educational Neuroscience: Defining a New Discipline for the Study of Mental Representations. Mind, Brain, and Education, 1, 114-127.
Tetens, Holm (1994). Geist, Gehirn, Maschine. Philosophische Versuche über ihren Zusammenhang. Stuttgart: Reclam.
Weisberg, Deena Skolnick, Frank C. Keil, Joshua Goodstein, Elizabeth Rawson & Jeremy R. Gray (2008). The Seductive Allure of Neuroscience Explanations. Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 470-477.
Weisberg, Deena Skolnick, Jordan C. V. Taylor & Emily J. Hopkins (2015). Deconstructing the seductive allure of neuroscience explanations. Judgment and Decision Making, 10, 429-441.
Wuketits, Franz M. (2008). Die Illusion des freien Willens. Aus Politik und Zeitgeschehen Nr. 44/45, 1-5.




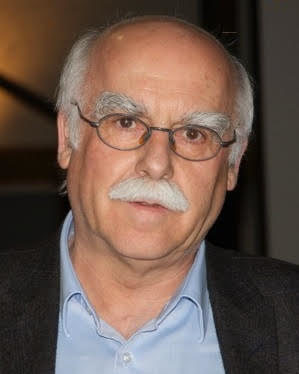


Walter Herzog moniert zu Recht die Einmischung der Neurowissenschaft in die Pädagogik. Allerdings sind das nicht die Einzigen, die glauben, sie müssten Lehrpersonen sagen, wie sie unterrichten müssen. Man denke an die Interventionen des Kinderarztes Remo Largo («Wer bestimmt den Lernerfolg?), an diejenigen des Philosophen Richard David Precht («Anna, die Schule und der liebe Gott»), an diejenigen des PISA-Evaluators Urs Moser («Kompetenzorientiert – adaptive – digital. Adaptives Lernen und Testen für eine zeitgemässe Evaluation des Lernfortschritts im Schulunterricht.»), an diejenigen des Bildungssoziologen Stefan Wolter «Bildungsbericht»), an diejenigen der Jakobsstiftung mit dem Schulpreis, etc.
Obwohl die Neurowissenschaft in den Worten Herzogs vieles ausspricht, was in den Augen der schulpraktisch Tätigen als Banalität erscheinen mag, sind solche Erkenntnisse eine gewisse Schützenhilfe, wenn Unterrichtende ihre Tätigkeit rechtfertigen müssen. Ein Beispiel: Wenn Jugendliche der Ansicht sind, sie könnten beim Lernen gleichzeitig Musik hören und SMS-Nachrichten beantworten, können Lehrpersonen immerhin mit gesicherten empirischen Belegen operieren, dass Multitasking auf Kosten der Lernqualität geht, weil die Aufmerksamkeit nicht gleichzeitig auf mehrere Dinge gerichtet sein kann, sondern nur zwischen den Dingen herpendelt, was die Konzentration nachweislich erschwert.
Es gibt auch das Umgekehrte: Bildungsfachleute bemühen gerne die Hirnforschung, wenn sie damit ihre Hypothesen begründen zu können glauben. So z.B. Fremdsprachendidaktiker(innen), um die These «Je früher, desto besser» zu begründen, die längst falsifiziert worden ist. Aber da gibt es in der Bildgebung irgendwelche Feuerchen, an die sich die Theoretiker klammern.
Mit grosser Vehemenz bestreitet Herzog in seinem dritten Beitrag das Diktum der Neurowissenschaft «Der Mensch ist sein Gehirn». Er stellt die These auf, dass das Gehirn wohl dank chemisch-elektrischer Vorgänge die Wahrnehmung, die Vernetzung und die kognitiven Operationen vornimmt. Hingegen sträubt er sich dagegen, dass das Gehirn diese Prozesse steuern, Sinn stiften und lernen kann. Er erwähnt nicht, dass diese Funktion dem Frontalkortex zugeschrieben wird, der erst im Alter von 18-22 Jahren vollgültig entwickelt ist, wie die Neurowissenschaft angibt.
Jedenfalls gibt sich Herzog hier als Antimaterialist zu erkennen, der dem Menschen neben dem Gehirn eine weitere Instanz zuschreibt, die über dem neuronalen Netzwerk die Fäden führt und seine eigentliche Menschlichkeit ausmacht. Die Antwort auf die Frage, welche Instanz es nun sei, die die Hirntätigkeit steuert und für das Lernen verantwortlich ist und welche Verbindung zwischen Steuerung und Gehirn besteht (Er nennt es «Brücke») will er in einem separaten Beitrag darlegen. Man darf gespannt sein und mit Faust auf die Lösung des Rätsels warten:
«Dass ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkungskraft und Samen
Und tu’ nicht länger in Worten kramen.»