Der Adressat der Neuropädagogik
Verlassen wir das Thema Willensfreiheit. Erstaunlicherweise spielt das «neue Menschenbild» in der angeschwollenen neuropädagogischen Literatur sowieso eine geringe Rolle. Das zeigt sich etwa daran, dass der freie Wille im Buch, das der Hirnforscher Manfred Spitzer (2002) über das Lernen geschrieben hat, unerwähnt bleibt, obwohl sich der Autor eingehend mit Fragen der moralischen und Werteerziehung auseinandersetzt. Irgendwie scheint man zu ahnen, dass es misslingen könnte, mit der Pädagogik ins Gespräch zu kommen, wenn man leugnet, dass der Mensch – als Erziehender oder Zu-Erziehender – in seinem Entscheiden und Handeln frei ist.

Dass dies keine Fehleinschätzung ist, zeigen Beispiele von Abwehrreaktionen seitens der Pädagogik, wie etwa Johannes Giesinger (2006), der die personale Perspektive als die «der Pädagogik angemessene Perspektive» (S. 97) bezeichnet. Mit der personalen Perspektive sind Begriffe wie Handlungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Willensfreiheit, Rationalität und Verantwortlichkeit verbunden. Keiner dieser Begriffe lässt sich Gehirnen zuordnen, weshalb Giesinger den platten Naturalismus der Neurowissenschaften aus pädagogischen Gründen zurückweist.
Von einem «neuen Menschenbild» ist in den pädagogischen Texten der Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler vermutlich auch deshalb nicht die Rede, weil sich philosophische Themen für einen öffentlichen Diskurs wenig eignen. Tatsächlich sind die Adressatinnen und Adressaten der pädagogisierenden Hirnforscherinnen und Hirnforscher (wie ich sie nennen möchte) nicht die für pädagogische Fragen zuständigen Wissenschaften, sondern in erster Linie die pädagogische Praxis. Ein Autor wie Manfred Spitzer zeigt kein Interesse an einem Diskurs mit Vertreterinnen und Vertretern der Erziehungswissenschaft oder der Pädagogischen Psychologie. Sein Publikum sind Angehörige pädagogischer Professionen wie Lehrerinnen und Lehrer, Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker sowie pädagogische Laien. Dementsprechend anspruchslos kommen die Texte der pädagogisierenden Hirnforscherinnen und Hirnforscher in erziehungswissenschaftlicher Hinsicht oft daher.
Pädagogische Binsenwahrheiten
Beispielhaft zeigt dies ein Artikel, den Gerald Hüther (2004) in der Zeitschrift für Pädagogik, einem erziehungswissenschaftlichen Publikationsorgan, veröffentlichte. Darin äussert er sich zur Gestaltung pädagogischer Beziehungen, führt aber keinen einzigen Verweis auf erziehungswissenschaftliche oder pädagogisch-psychologische Literatur auf. Ähnliches gilt für einen Text von Gerhard Roth (2004b) in derselben Zeitschrift. «Pädagogik» umfasst für diese Autoren offenbar das, was man intuitiv über Erziehung, Schule und Unterricht weiss, was man aus eigener Erfahrung kennt und wofür man keine wissenschaftliche Fachliteratur konsultieren muss.
Insofern erstaunt nicht, wenn man zu lesen bekommt, dass die neurowissenschaftlich hergeleiteten pädagogischen Empfehlungen nicht wirklich neu sind. Nichts von dem, was er vortrage, versichert uns Gerhard Roth (2004b), sei «einem guten Pädagogen inhaltlich neu» (S. 496). Das ist ihm eine so wichtige Aussage, dass er sie dreimal unterstrichen haben will. Beansprucht werde lediglich eine neurowissenschaftliche Begründung für altbekannte pädagogische Weisheiten. Schon Jahre zuvor sprach der Neurologe Johannes Dichgans (1994) von der «Verwissenschaftlichung von [pädagogischen, W.H.] Binsenweisheiten» (S. 244) durch die moderne Hirnforschung. In kritischer Absicht beurteilt auch Matthias Huber (2015) die neurowissenschaftlichen Bildungsempfehlungen als «pädagogische Binsenweisheiten mit reformpädagogischer Konnotation» (S. 171).
Ein Autor wie Manfred Spitzer zeigt kein Interesse an einem Diskurs mit Vertreterinnen und Vertretern der Erziehungswissenschaft oder der Pädagogischen Psychologie. Sein Publikum sind Angehörige pädagogischer Professionen wie Lehrerinnen und Lehrer, Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker sowie pädagogische Laien. Dementsprechend anspruchslos kommen die Texte der pädagogisierenden Hirnforscherinnen und Hirnforscher in erziehungswissenschaftlicher Hinsicht oft daher.
Je früher, desto besser?
Zu diesen Binsenweisheiten gehört der Satz «Je früher, desto besser.» Er findet sich wörtlich bei Wolf Singer (2003, S. 118). Dank der Hirnforschung scheint er wissenschaftliche Bestätigung erfahren zu haben. Als Sprichwort von Hans, der nimmermehr lernt, was Hänschen nicht gelernt hat, taucht er in Publikationen von pädagogisierenden Hirnforscherinnen und Hirnforschern mehrfach auf. «In neurobiologischer Hinsicht», schreibt Manfred Spitzer (2002), sei «diese Volksweisheit längst eingeholt und auf vielfache Weise bestätigt» (S. 241).
Allerdings fragt sich, was die Neurobiologie auf so vielfache Weise bestätigt hat. Denn die Aussage ist so vage gehalten, dass man alles Beliebige und selbst das Gegenteil aus ihr herauslesen kann. Tatsächlich heisst es beim Neurobiologen Hans-Joachim Pflüger (2006), es sei davon auszugehen, «dass Menschen zeitlebens lernen können, wenn auch die Lernfähigkeit ab der Pubertät […] abnimmt und die Einspeicherung neuer Inhalte schwerer zu erfolgen scheint» (S. 46). Kann also Hans doch noch lernen, was Hänschen zu lernen verpasst hat?
Der Neuropsychologe Lutz Jäncke (2009) meint jedenfalls, dass man sich «von dem unsäglichen Begriff des ‹kritischen Zeitfensters› endlich lösen» (S. 42) sollte.

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Neuroplastizität des Gehirns keineswegs auf die Kindheit beschränkt ist. Brigitte Falkenburg (2012, S. 155) meint gar, das alte Sprichwort von Hans, der nicht mehr lernt, was Hänschen nicht gelernt hat, gelte inzwischen als überholt. Eine scharfe Kritik am «Mythos der ersten drei Jahre» üben auch John Bruer (1997) und Jerome Kagan (2000). Umstritten ist selbst bei Hirnforscherinnen und Hirnforschern, wie weit die Konzepte der sensiblen bzw. kritischen Lernphasen und der kritischen Zeitfenster tragen, da sie kaum durch Erkenntnisse beim Menschen gestützt werden. Der Neuropsychologe Lutz Jäncke (2009) meint jedenfalls, dass man sich «von dem unsäglichen Begriff des ‹kritischen Zeitfensters› endlich lösen» (S. 42) sollte.
Binsenwahrheiten noch und noch
Es fällt nicht schwer, in der neurowissenschaftlichen Pädagogikliteratur weitere Binsenwahrheiten zu finden, wie zum Beispiel, dass Lernen kein passiver, sondern ein aktiver Vorgang ist, dass mehr lernt, wer es aufmerksam, motiviert und interessiert tut, wohingegen Angst und Stress die Lernleistung reduzieren, dass Kinder von Natur aus neugierig sind und lernen wollen, dass Belohnung befriedigend ist, Bestrafung und Deprivation dagegen vermieden werden sollten, dass gemeinsam lernen erfolgreicher ist als alleine lernen, dass das Vorwissen eine wesentliche Grundlage des Wissenserwerbs darstellt, dass Vertrauen ein bedeutsames Fundament von Erziehung ist, dass kein Kind gleich ist wie ein anderes, dass man auf die spontanen Fragen der Kinder eingehen soll etc. Wenn zutreffen sollte, dass diese und weitere Erkenntnisse «jedem guten Lehrer bekannt sind» (Roth, 2004b, S. 505), stellt sich die Frage, ob uns die Neurowissenschaften überhaupt etwas Belangvolles zu sagen haben.
Es fällt nicht schwer, in der neurowissenschaftlichen Pädagogikliteratur weitere Binsenwahrheiten zu finden, wie zum Beispiel, dass Lernen kein passiver, sondern ein aktiver Vorgang ist, dass mehr lernt, wer es aufmerksam, motiviert und interessiert tut, wohingegen Angst und Stress die Lernleistung reduzieren.

Von einer Wissenschaft, die pädagogisch etwas bieten will, würde man erwarten, dass sie über die Verkündigung von Plattitüden hinausgeht. Doch präziser scheint es nicht zu gehen, weil die Distanz zwischen Gehirn und Unterricht viel zu gross ist. Das zeigt sich besonders anschaulich, wenn sich die Hirnforscherinnen und Hirnforscher nicht dem Lernen, sondern dem Lehren zuwenden. Allein schon die Annahme von Manfred Spitzer (2003), «ein Lehrer, der weiss, wie das Gehirn funktioniert», würde deshalb «besser lehren können» (S. 31), ist falsch. Denn das Lernen ist keine Prämisse, aus der sich das Lehren deduktiv herleiten liesse. Zwischen Lehren und Lernen besteht kein logisches, sondern ein empirisches (kontingentes) Verhältnis. Lehren kann stattfinden, ohne dass gelernt wird, und Lernen ist möglich, ohne dass gelehrt wird. Keine noch so gute Lerntheorie kann per se etwas zur Optimierung des Lehrens beitragen.
Auch was Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler über das Lehren sagen, folgt daher nicht aus ihrer Forschung, jedenfalls nicht in einem irgendwie gearteten direkten Sinn, sondern entspricht wiederum im Wesentlichen ihrer Alltagspädagogik. Dies wird nicht selten auch freimütig eingestanden. So wenn Manfred Spitzer (2002) im Vorwort zu seinem Lern-Buch schreibt, er habe, um manches allgemeine Prinzip zu erläutern, das er aus der Hirnforschung ableite, «auf eigene Erlebnisse zurückgegriffen» (S. XIV). Bestätigung scheinen die Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler vor allem für ihre eigenen Binsenweisheiten zu finden.
Schulkritik
Wie die Behavioristen sind die Hirnforscher besonders artikuliert, wenn es darum geht, Erziehung und Unterricht, Bildung und Schule zu kritisieren. Noch harmlos tönt der Satz von Spitzer (2002): «jeder lernt […] auf seine Weise» (S. 417). Schon dezidiert kritischer ist Wolf Singer (2003), wenn er schreibt: «Man müsste auf der Basis von Fakten eine radikale Änderung der Bildungspolitik durchsetzen. Die Fakten sagen klar, dass Menschenkinder unglaublich unterschiedlich geboren werden und mit ihren Fragen und Interessen einen enormen Raum überspannen, der abgedeckt werden muss. Ein Bildungssystem ist nur dann gerecht und effizient, wenn jeder entsprechend seinen sehr unterschiedlichen Anlagen möglichst optimale Antworten findet für das, was er fragt» (S. 117).

Ähnlich sprechen die Neurobiologin Anna Katharina Braun und ihre Mitautorin Michaela Meier (2004) von der Einzigartigkeit des Gehirns und leiten daraus ab, dass «der individuellen Entwicklung des einzelnen Kindes (und vor allem seines Gehirns!) mehr Rechnung getragen werden (muss)» (S. 518). Bei Gerhard Roth (2004b) kann man lesen, «dass der gute Lehrer eigentlich den Lern- und Gedächtnisstil eines jeden seiner Schüler genau kennen müsste, um seine Tätigkeit daran optimal anzupassen» (S. 502) – was, wie er ehrlicherweise zugibt, eine fast unlösbare Aufgabe darstellt.
Die Neurowissenschaften dienen zur Legitimation einer reformpädagogischen Schulkritik, deren Massstab einzig und allein im Individuum liegt.
Trotzdem ist genau dies die Stossrichtung der neurowissenschaftlichen Schulkritik, die genauso abgedroschen wirkt wie die pädagogischen Binsenweisheiten, die uns von den Vertreterinnen und Vertretern der Disziplin serviert werden. Ulrich Herrmann (2008), ein Erziehungswissenschaftler, der für die Erkenntnisse der Neurowissenschaften voller Begeisterung ist, schreibt, dass aufgrund der neurowissenschaftlichen Forschung jetzt schon offensichtlich sei, «dass die üblichen Strukturen und Prozesse schulischen Lernens und die dortigen Formen der Leistungserbringung und ‑bewertung allen [!] grundlegenden Einsichten der Neurowissenschaften widersprechen» (S. 48). Die Neurowissenschaften dienen zur Legitimation einer reformpädagogischen Schulkritik, deren Massstab einzig und allein im Individuum liegt.
 Die unendliche Komplexität des Gehirns
Die unendliche Komplexität des Gehirns
Pikant ist allerdings, dass sich das Hohelied vom Individuum ausgerechnet auf dem Terrain der Hirnforschung nicht singen lässt. Als vor einigen Jahren mehrere deutsche Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler ein Manifest zur Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung veröffentlichten, waren höchst optimistische Töne zu vernehmen. So glaubte man, dass die Neurowissenschaften am Ende ihrer Bemühungen «sozusagen das kleine Einmaleins des Gehirns verstehen» (Das Manifest, 2004, S. 36) würden. Ausdrücklich war auch hier von einem «neuen Menschenbild» die Rede. Was unser Bild von uns selbst betreffe, würden uns in absehbarer Zeit beträchtliche Erschütterungen ins Haus stehen.
Zur Frage, was Hirnforscherinnen und Hirnforscher eines Tages wissen werden, war dann aber zu lesen, dass «eine vollständige Beschreibung des individuellen Gehirns und damit eine Vorhersage über das Verhalten einer bestimmten Person nur höchst eingeschränkt gelingen» (S. 36) werde. Flankierend zum Manifest schrieb der Neuropsychologe Frank Rösler (2004), dass selbst der akribischste Forscher eine Zustandsbeschreibung des Gehirns «in absehbarer Zeit nicht (wird) leisten können» (S. 32). Auch wenn das Gehirn deterministisch funktioniere, sei es «in seiner Komplexität niemals [!] vollständig beschreib- und verstehbar» (ebd.). Diesem Urteil hat sich Wolf Singer (2003) angeschlossen, indem er ebenso deutlich formuliert: «Wir werden nie [!] ein individuelles menschliches Gehirn in seiner spezifischen Funktion erfassen können, dafür ist es zu komplex und zu einmalig» (S. 95). Da das Gehirn auch ständig im Umbau begriffen ist, wäre selbst bei vollständiger Kenntnis seines aktuellen Zustands eine Prognose individuellen Verhaltens nicht möglich.
Ist es nicht überheblich, der Schule vorzuwerfen, sie würde dem individuellen Kind nicht gerecht, wenn man selber nicht in der Lage ist, das individuelle Gehirn zu verstehen?
Ist es nicht überheblich, der Schule vorzuwerfen, sie würde dem individuellen Kind nicht gerecht, wenn man selber nicht in der Lage ist, das individuelle Gehirn zu verstehen? Auch wenn der Unterricht in seiner Komplexität nicht an die Komplexität eines menschlichen Gehirns heranreichen mag, ist er immer noch komplex genug, um Lehrpersonen vor vergleichbare Probleme zu stellen wie die Hirnforscherinnen und Hirnforscher. Wobei Letztere aufgrund ihrer experimentellen Forschungsmethoden weit mehr Möglichkeiten haben, ihren Gegenstand zu kontrollieren als Lehrerinnen und Lehrer.
Der überzogene Individualismus, den die pädagogisierenden Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler an den Tag legen, hindert sie daran, sich ein angemessenes Bild von der Unterrichtsrealität zu machen.
Sozialität des Unterrichts
Der überzogene Individualismus, den die pädagogisierenden Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler an den Tag legen, hindert sie daran, sich ein angemessenes Bild von der Unterrichtsrealität zu machen. Forschungsobjekt der Neurowissenschaften sind Menschen «als isolierte zerebrale Subjekte in einem sozialen Vakuum», wie der Pharmakologe Felix Hasler (2012, S. 229) schreibt. Doch das Gegenüber von Lehrerinnen und Lehrern sind nicht individuelle Kinder, jedenfalls nicht nur und nicht in erster Linie, sondern Schulklassen, die sich zwar aus Individuen zusammensetzen, aber mehr als die Summe ihrer Teile bilden. Allen Forderungen nach vermehrter Individualisierung zum Trotz, beruht schulischer Unterricht auf einer sozialen Ordnung, zu deren Verständnis die Erkenntnisse der Hirnforschung wenig beitragen. Von den individuellen Gehirnen zu den sozialen Interaktionen in einer Schulklasse ist ein dermassen weiter Weg – zwar nicht in Metern gemessen, aber begrifflich und theoretisch –, dass schwer zu sehen ist, wie die Hirnforschung jemals in der Lage sein wird, der pädagogischen Schulpraxis behilflich zu sein.
Allen Forderungen nach vermehrter Individualisierung zum Trotz, beruht schulischer Unterricht auf einer sozialen Ordnung, zu deren Verständnis die Erkenntnisse der Hirnforschung wenig beitragen.
Geradezu absurd wäre es, die soziale Ordnung in einer Schulklasse aus den «Wechselwirkungen zwischen Gehirnen» (S. 12) hervorgehen zu lassen, wie eine Formulierung von Wolf Singer (2003) suggeriert. Die Absurdität wird umso deutlicher, wenn wir eine Bemerkung des Philosophen Holm Tetens (1994) aufgreifen, wonach «unsere Gehirne füreinander mit Blindheit geschlagen sind» (S. 48). In der Tat, ein Gehirn sieht nichts, hört nichts, schmeckt nichts, riecht nichts und hat auch keine Tastempfindungen – all dies sind Sinneswahrnehmungen, die wir nicht Gehirnen, sondern Menschen zuschreiben. Ohne die Körper der Menschen, in denen sie sich befinden, würden Gehirne nichts über die sie umgebende Welt erfahren, also auch nichts über andere Menschen, geschweige denn über andere Gehirne.
Lehrende und lernende Gehirne
Dass Lehrende und Lernende Gehirne haben, ohne die sie nicht miteinander kommunizieren können, Gehirne also eine notwendige Bedingung von Sozialität im schulischen Unterricht sind, steht ausser Zweifel. Dass Gehirne jedoch miteinander kommunizieren, so dass «Dialoge zwischen Gehirnen» (Singer, 2003, S. 58) stattfinden, muss als terminologischer Missgriff bezeichnet werden. Wie sollen denn Gehirne in direkten Kontakt zueinander treten?
Mittlerweile gibt es aber nicht nur Gehirne, die Dialoge führen, sondern auch Gehirne, die lernen, ja selbst solche, die lehren. Noch wissen wir zwar wenig über die lehrenden Gehirne, aber der Neurowissenschaftler Antonio Battro (2010) ist überzeugt, «dass das Klassenzimmer bald eine ausgewählte Umgebung sein wird, um das lehrende Gehirn in Interaktion mit dem lernenden Gehirn zu untersuchen» (S. 31 – meine Übersetzung). Es werde möglich sein, «den Dialog zwischen lehrenden und lernenden Gehirnen in verschiedenen Umgebungen und bei grossen Untersuchungsgruppen zu erforschen» (ebd.). Die vertraute Vorstellung, im Unterricht würden sich lehrende und lernende Personen begegnen, scheint ausgedient zu haben, denn in Wahrheit sind es interagierende Gehirne, die den Kern des pädagogischen Geschehens ausmachen.
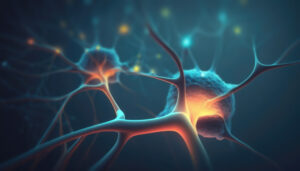
Selbst wenn zutrifft, was tatsächlich der Fall zu sein scheint, dass das Gehirn ein «Sozialorgan» (Hüther, 2004, S. 489) darstellt, «auf Sozialverhalten hin ausgerichtet (ist)» (Braun & Meier, 2004, S. 517) und «für die Gestaltung von sozialen Beziehungen optimiert» (Hüther, 2004, S. 489) wurde, erfahren wir durch den Blick ins Gehirn nicht, was Sozialität ist und wie sie realisiert wird. Wir können dem Gehirn noch so lange «beim Denken zuschauen», was wir – dank bildgebender Verfahren – zu sehen bekommen, sind keine Gedanken, sondern physische Ereignisse – Hirnströme oder Sauerstoffkonzentrationen –, die den Gedanken zwar zugrunde liegen, diese aber nicht ausmachen. Synaptische Verbindungen sind etwas gänzlich anderes als soziale Beziehungen. Folglich führen die Studien der Hirnforscherinnen und Hirnforscher auch nie so weit, dass sie den Austausch von Gedanken erklären könnten. «Wie genau wir uns das Gehirn auch anschauen – sei es durch ein Mikroskop, durch moderne bildgebende Geräte oder zukünftig vielleicht mit noch genaueren Verfahren – wir finden stets nur physikalische Objekte der üblichen Art: Neuronen und Synapsen, Neurotransmitter, Ionen, Elektronen und Protonen» (S. 6), versichert uns der Neuropsychologe Rainer Mausfeld (2007).
Die Paradoxie: Unweigerlich müssen Manfred Spitzer, Gerald Hüther, Hans-Joachim Pflüger, Wolf Singer, Gerhard Roth sowie ihre neuropädagogischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter an die Vernunft und die Verantwortung der Eltern und Lehrkräfte appellieren, an die sie sich wenden. Sie müssen Argumente verwenden, um zu überzeugen, womit ihre Gesprächspartner nicht Gehirne, sondern Personen sind.
Nicht Gehirne untersuchen Gehirne
Damit gerät die Hirnforschung in eine Paradoxie. Jedenfalls dann, wenn sie die Ergebnisse ihrer Forschung nicht für sich behalten, sondern weitergeben will. Denn ihre Botschaften müssen gelesen oder gehört werden, und sie müssen verstanden werden. Sie müssen kommuniziert werden und können nicht kausal in die Hirne der Pädagoginnen und Pädagogen injiziert werden. Noch sind wir längst nicht so weit, dass sich Wissen auf pharmakologischem Weg übertragen oder mittels Neurochips implantieren liesse. Unweigerlich müssen Manfred Spitzer, Gerald Hüther, Hans-Joachim Pflüger, Wolf Singer, Gerhard Roth sowie ihre neuropädagogischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter an die Vernunft und die Verantwortung der Eltern und Lehrkräfte appellieren, an die sie sich wenden. Sie müssen Argumente verwenden, um zu überzeugen, womit ihre Gesprächspartner nicht Gehirne, sondern Personen sind.
Das gilt auch innerwissenschaftlich. Wer ein Experiment plant, durchführt und auswertet, tut dies als Person und nicht als Gehirn. Wer die Ergebnisse seiner Forschung publiziert, auf einem Kongress vorstellt oder gegenüber Kritik verteidigt, tut dies ebenfalls als Person. Es ist schlicht verfehlt, wenn Wolf Singer (2002a) schreibt, bei der Erforschung des Gehirns würde «sich ein kognitives System im Spiegel seiner selbst» (S. 61) betrachten. Es würden also das Erklärende und das zu Erklärende ineinander verschmelzen. Gehirne werden in keiner Weise von Gehirnen erforscht, sondern von Menschen. Die Formulierung stellt nichts anderes als den Versuch dar, die erkenntnistheoretischen und methodologischen Schwierigkeiten der neurowissenschaftlichen Forschung durch Kurzschluss zweier sich ausschliessender Sprachspiele zu verschleiern.
Pädagogische Schizophrenie
Das Problem wird durchaus gesehen. Singer (2003) selbst spricht von der «Unvereinbarkeit verschiedener Beschreibungssysteme» (S. 25) und postuliert «zwei voneinander getrennte Erfahrungsbereiche […], in denen Wirklichkeiten dieser Welt zur Abbildung kommen» (S. 32). Zu unterscheiden seien die Dritte-Person-Perspektive, wie sie den Naturwissenschaften zugrunde liege, und die Erste-Person-Perspektive, wie sie im lebensweltlichen Alltag eingenommen werde.
In praktischer Hinsicht steht der Hirnforscher damit vor einem unlösbaren Konflikt: «Ich kann bei der Erforschung von Gehirnen nirgendwo ein mentales Agens wie den freien Willen oder die eigene Verantwortung finden – und dennoch gehe ich abends nach Hause und mache meine Kinder dafür verantwortlich, wenn sie irgendwelchen Blödsinn angestellt haben» (S. 12). Das ist ein weitgehendes Eingeständnis, denn hier geht es nicht mehr um eine allgemeine pädagogische Binsenwahrheit, sondern um die konkrete Erziehungspraxis von Wolf Singer – eine Erziehungspraxis, die Singer (2002b) als existentiell bedrohlich wahrnimmt, wie er in einem Interview eingesteht: «Für mich als Hirnforscher bedeutet das ein ständiges Problem: Ich lebe gewissermassen als dissoziierte Person» (S. 32).
Zurück beim alten Menschenbild?
Andere scheinen mit der Paradoxie zweier sich ausschliessender Beschreibungssysteme besser zurechtzukommen. Michael Pauen und Gerhard Roth (2008) beispielsweise akzeptieren die «Weltsicht der Gründe», wie sie der Ersten-Person-Perspektive innewohnt, und meinen, dass sich diese ohne Selbstwiderspruch gar nicht bestreiten lasse. «Wer behauptet, dass Menschen nicht nach Gründen zu handeln und sich nicht an Gründen zu orientieren vermögen, der muss seine Behauptung begründen. Damit handelt er so, als wären Menschen eben doch in der Lage, nach Gründen zu handeln und sich an Gründen zu orientieren» (S. 113). Dieser performative Widerspruch (wie er in der Philosophie genannt wird) ist Pauen und Roth Anlass genug, um die Fähigkeit, nach Gründen zu handeln und sich an Gründen zu orientieren, als konstitutives Merkmal von Personalität anzuerkennen. Sie halten es für abwegig, wenn gesagt wird, geistige Prozesse seien in Wirklichkeit nichts anderes als neuronale Aktivitäten. «Nein! Geistige Prozesse sind geistige Prozesse, doch sie sind, nach allem was wir wissen, neuronal realisiert» (S. 126). Die kausalen Prozesse im Gehirn würden lediglich die Bedingung dafür darstellen, dass wir uns frei fühlen und in unserem Handeln von Gründen leiten lassen.
Sind wir damit wieder bei unserem alten Menschenbild? Tatsächlich will uns Pauen (2007) genau dies glauben machen. Die Rede von einem «neuen Menschenbild» sei verfehlt, da sich nicht das Menschenbild, sondern lediglich dessen Erklärung verändert habe. Es sei falsch, wenn die Neurowissenschaften von einem «neuen Menschenbild» sprechen, denn dieses existiere gar nicht! Es gebe nur ein Menschenbild, und dieses sei das alte, für das die Neurowissenschaften allerdings eine neue Erklärung geben. Kern des alten Menschenbildes bilden «das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein sowie die Fähigkeit, frei und verantwortlich zu handeln und sich dabei von Gründen leiten zu lassen» (S. 21). In unserem Alltag würden wir seit vielen tausend Jahren von diesem Menschenbild bestimmt.
Verbesserung der pädagogischen Praxis
Das ist allerdings etwas viel an Beschwichtigung. Die Neurowissenschaften wollen doch nicht alles beim Alten lassen und uns nur neue Erklärungen für längst Bekanntes geben. Wenn Wolf Singer (2002b) von «einem Frontalangriff auf unser Selbstverständnis und unsere Menschenwürde» (S. 33) spricht, dann hat er nicht eine abgehobene theoretische Frage im Sinn. Und wenn uns Gerhard Roth (2009) die Botschaft übermittelt, dass wir «unser Gedächtnis nicht im eigentlichen Sinne verbessern (können)» (S. 105), dann macht auch er keine Aussage, die lediglich von theoretischem Interesse wäre. Den Nutzen der Hirnforschung darauf zu beschränken, dass sie uns bessere Erklärungen dafür liefert, was wir immer schon wussten, unterbietet die praktischen Ambitionen, die von dieser Disziplin ausgehen.
Das zeigen die Texte der pädagogisierenden Hirnforscherinnen und Hirnforscher unübersehbar. Es sind nicht akademische Fragen der Bildungsphilosophie oder ungelöste Probleme der pädagogischen Theorie, die hier abgehandelt werden, sondern praktische Fragen zur Verbesserung von Erziehung und Unterricht. Im Kern beansprucht die Neuropädagogik, wie es in einem Beitrag von Jeffrey Bowers (2016) heisst, «dass durch neue Erkenntnisse über das Gehirn der Unterricht verbessert werden kann» (S. 600 – eigene Übersetzung). In einer systematischen Analyse von Fachzeitschriften, die im Zeitraum von 1985 bis 2017 erschienen sind, zeigen Jacob Feiler und Maureen Stabio (2018), dass in den Artikeln, die sich zur Definition, zu den Zielen oder zum Leitbild der Neuropädagogik äussern, die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse zur Verbesserung der pädagogischen Praxis – neben Interdisziplinarität und interdisziplinärem Austausch – ein Hauptkriterien zur Identifizierung der Disziplin bildet.




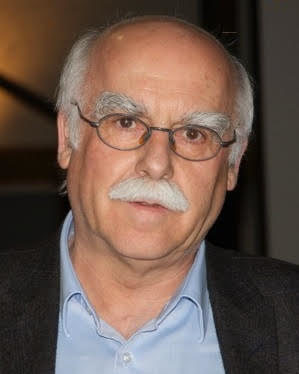


So einen starken Artikel habe ich schon lange nicht mehr gelesen – Die Neurowissenschaft lobt sich selbst und verkauft den Pädagogen etwas, was sie nicht brauchen! Ein nachvollziehbarer Mechanismus, wie Menschen mit praktischem Gehirntraining motiviert werden können, wäre eindeutig von grösserem Wert als ein Auflebenlassen von Binsenweisheiten, die – unter welchem Gesichtswinkel man sie betrachtet – vielleicht auch nicht stimmen. Man könnte, bevor man die Bücher der Protagonisten der Zunft reinzieht, also getrost ein technisch vortrainiertes neuronales Maschinennetz nach dessen Meinung dazu befragen. Zum Beispiel so:
“Ich suche nach einer fundierten Kritik an der Neurowissenschaften bezüglich ihres interdisziplinären Leitbildes, wonach die Pädagogik aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse ihr in den Hauptkriterien ihrer Disziplin folgen soll.” – Das Fazit auf den kürzesten Nenner gebracht: Schuster bleib bei deinen Leisten.