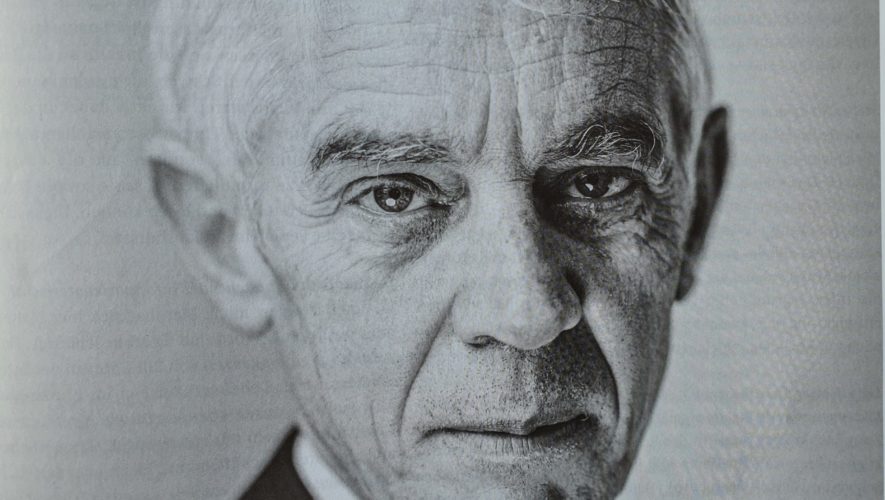Herr Vetterli, ist Bildung die wichtigste Ressource der Schweiz?
Was hat das Land an natürlichen Ressourcen? Es gibt Wasser und Wasserkraft. Es gibt schöne Aussichten für den Tourismus. Und es gibt die Köpfe der Leute, die hier leben. Deshalb ist Bildung absolut zentral. Drei Viertel der Unternehmen in der Schweiz sind im tertiären Sektor tätig. Die Beschäftigten im Dienstleistungssektor brauchen vor allem Bildung.
Wie haben Sie persönlich das Schweizer Bildungssystem erlebt?
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben in der Schweiz eines der besten öffentlichen Bildungswesen der Welt. Der freie Zugang für alle ist hierzulande gewährleistet. In Europa gibt es einige weitere Länder, wo das ebenfalls so ist. Weltweit ist es aber relativ selten. Ich war lange in Übersee.

Sie lebten in den USA.
Ja, dort ist der freie Bildungszugang nicht gleich möglich. Deshalb ist dies eine Stärke der Schweiz. Die Qualität des öffentlichen Schulwesens wird hierzulande unterschätzt, weil man sie als gegeben wahrnimmt – wie die Luft, die wir atmen. Man würde es erst merken, wenn die Schulen in 20 Jahren nicht mehr so gut wären. Deshalb müssen wir die nötigen Ressourcen bereitstellen. Es braucht dafür die Überzeugung, dass Bildung ein demokratisches Recht ist.
In Ihrer eigenen Bildungskarriere, was war für Sie prägend?
Ich ging sehr gern in die Schule und war breit interessiert. Es gab eigentlich keine Fächer, die mich langweilten. Eine wichtige Phase war für mich das Gymnasium in Neuchâtel. Wir hatten Lehrer, die uns wirklich herausforderten und intellektuell stimulierten, was wir Schüler schätzten. Ein zweiter wichtiger Abschnitt war für mich das Diplomstudium in den USA: In Stanford habe ich erlebt, wie eine Forschungsuniversität funktioniert. Hier wurde ich für die Forschung begeistert. Diese Dynamik war mir vorher in der Schweiz noch nicht begegnet, inzwischen gibt es sie aber auch bei uns.

Sie haben den akademischen Weg gewählt. Wie wichtig ist die Berufslehre für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz?
Sehr wichtig. Die Berufslehre ist einer der Gründe dafür, dass wir kaum Jugendarbeitslosigkeit haben. Es braucht in der Bildung unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Ansprüche. Wichtig ist auch die Durchlässigkeit im dualen System, die relativ gut funktioniert. Auch wenn man mit einer Lehre ins Berufsleben startet, kann man später noch eine Fachhochschule oder Universität besuchen. Das verhindert, dass schon mit 18 Jahren alle beruflichen Weichen gestellt werden müssen, wie dies in anderen Ländern der Fall ist.
Und wie geht es der Berufslehre heute?
Das System der Berufslehre ist zerbrechlich. Es benötigt Firmen, die bereit sind, in die Lernenden zu investieren. Wenn Firmen sehr kurzfristig denken, dann verzichten sie auf Lehrlinge. Deshalb ist dieses Modell, das auch im Ausland oft bewundert wird, nicht einfach zu kopieren. Denn es braucht eine langfristige Perspektive bei den Unternehmen. Diese haben die meisten Firmen in der Schweiz, und das müssen wir beibehalten.
Die Qualität des öffentlichen Schulwesens wird hierzulande unterschätzt, weil man sie als gegeben wahrnimmt – wie die Luft, die wir atmen.
Die Maturitätsquoten der Schweizer Kantone sind sehr unterschiedlich. Machen zu viele Genfer und Waadtländerinnen die Matura oder zu wenige Glarnerinnen und Schaffhauser?
Es besteht ein kultureller Unterschied. Die Deutschschweizer Kantone orientieren sich eher an Deutschland und Österreich, die die Berufsbildung ebenfalls kennen – anders als Italien und Frankreich. In Genf hat die Berufsbildung nicht dieselbe Ausstrahlung wie in der Deutschschweiz. Wichtig ist letztlich aber, dass das Niveau der Matura gehalten wird. Dann ist mir eigentlich egal, wie hoch die Quote ist.
Stellen Sie denn einen Qualitätsunterschied zwischen Maturanden aus unterschiedlichen Kantonen fest?
Hier ziehe ich den Joker und mache keine offiziellen Aussagen (lacht). Was man aber sagen kann: Der wichtigste Unterschied besteht zwischen Kantonen, wo man die Maturität in drei Jahren erreichen kann – Waadt, Neuenburg, Jura sowie im französischsprachigen Teil des Kantons Bern – sowie den anderen Kantonen, wo die Mindestdauer bei vier Jahren liegt. In vier Jahren kann man die Inhalte gründlicher vermitteln. Mit dem Projekt «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» könnte sich das in nächster Zeit aber angleichen.
Weiterhin fehlen in der Schweiz etwa viele Fachleute in Datenwissenschaften oder Cybersecurity. Aber auch für klassische Ingenieure, Mathematikerinnen und Physiker hat der Arbeitsmarkt noch viele Stellen offen.
Mit Blick auf den Arbeitsmarkt: Vermittelt das Schweizer Bildungssystem die richtigen Qualifikationen?
Zum Fachkräftemangel in der Schweiz gibt es ja Statistiken des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO). Weiterhin fehlen in der Schweiz etwa viele Fachleute in Datenwissenschaften oder Cybersecurity. Aber auch für klassische Ingenieure, Mathematikerinnen und Physiker hat der Arbeitsmarkt noch viele Stellen offen. Ich will damit nicht sagen, dass wir nur in dem Bereich ausbilden sollen, wo der Markt sucht, denn manchmal ist er sehr kurzfristig ausgerichtet. Deshalb setze ich mich für eine sehr gute Grundausbildung ein. Dazu gehören bei uns Physik, Mathematik und Computational Thinking. So können sich die Absolventen später in verschiedenen Zweigen der Wirtschaft zurechtfinden.
Zuletzt war auch der Fachkräftemangel in Medizin und Betreuung ein grosses Thema. Was müsste man ändern, damit mehr junge Leute Felder betreten, wo es Arbeitskräfte braucht?
Wahrscheinlich bräuchte es für die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien mehr Transparenz, was ihre Studienwahl betrifft. Man sollte ihnen klarer machen, wo die Jobs von morgen sind. Gleichzeitig betone ich: Wir als Universität arbeiten nicht in erster Linie für die Wirtschaft, sondern für die Studierenden.
Um diesen Standard zu halten, braucht es Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung.
Wo sind die Jobs von morgen?
In der Schweizer Wissensgesellschaft werden naturwissenschaftlich basierte Berufe weiterhin sehr wichtig bleiben. Eine gute Ausbildung in Ingenieurswissenschaften, Lebenswissenschaften, Pflegewissenschaften oder Medizin wird in den nächsten Jahren relevant bleiben. Natürlich bin ich hier als Präsident einer technischen Hochschule nicht ganz unbefangen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Schweiz ein Land mit sehr hohen Einkommen, hoher Lebensqualität und Lebenserwartung ist. Um diesen Standard zu halten, braucht es Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung.
Welche Themen kommen an den Schulen heute zu kurz?
Eine solide Grundausbildung ist zentral. Für uns als EPFL sind Mathematik und Naturwissenschaften natürlich besonders wichtig. Trotzdem müssen sich die Inhalte an die Zeit anpassen, und dies geschieht in der Schweiz oft nur langsam. In den Kantonen Waadt und Wallis waren wir aktiv dabei, in der Volksschule das Fach «Computational Thinking» zu etablieren. Es geht dabei nicht ums Programmieren, sondern um die Fähigkeit, komplexe Probleme so zu formulieren, dass sie sowohl Menschen wie auch Computer verstehen und lösen können. Diese Fähigkeit ist wichtig für eine Person im 21. Jahrhundert.
Und das fehlt im bestehenden Informatikunterricht?
Ja, und das ärgert mich. Man hat sich hier bisher hauptsächlich mit Powerpoint, Word und Excel beschäftigt. Das geht letztlich zurück auf einen Besuch von Bill Gates in der Schweiz, als er den Bundesrat traf. Dabei verkaufte er im Prinzip die Produkte von Microsoft. Er wurde empfangen wie ein Staatsoberhaupt – die Naivität hier macht mir etwas Angst. Gates ist ein schlauer Mann und ein guter Geschäftsmann. Es ist aber falsch, bestimmte Programme zu unterrichten.
Was hat Sie als EPFL-Präsident in der Pandemie am meisten überrascht?
Mich hat überrascht, wie schlecht die Schweiz vorbereitet war, dann aber doch relativ schnell und gut reagiert hat. Es gab am Anfang viel zu wenig Masken, und der Bund sagte öffentlich, dass Masken nichts bringen. Das war falsch. Wieso sollen Masken nur innerhalb eines Spitals funktionieren, nicht aber ausserhalb?
Auch die WHO war am Anfang skeptisch gegenüber der Maskenpflicht.
Ich habe mir notiert, wer wann welche Aussage gemacht hat. Denn das Thema der wissenschaftlich basierten Entscheidung interessiert mich stark. Ein moderner Staat sollte seine Entscheidung auf wissenschaftliche Grundlagen abstellen. Es ist aber eine komplizierte Geschichte, lassen wir das also lieber (lacht)!
Es ist aber hochspannend.
Man kann doch im 21. Jahrhundert nicht seriös verlangen, dass die Wissenschaft einen Maulkorb erhält.
Die Vertreter der SVP wollten nicht der Wissenschaft einen Maulkorb anlegen, sondern die Rolle der wissenschaftlichen Taskforce einschränken.
Die Politik entscheidet. Die Taskforce hat der Politik nie gesagt, was sie machen muss, und das kann sie auch gar nicht, da sie diese Macht nicht hat. Sie hat die Politik wissenschaftlich beraten. Die Entscheide muss aber die Politik treffen.
Die Frage ist, wieso die Schweiz nicht eine ständige wissenschaftliche Taskforce und einen ‹Chief Scientist› hat. Jedes andere Land, das ich kenne, hat eine solche Institution.
Die Exponenten der Taskforce haben aber auch Politik gemacht – mit Äusserungen in der Öffentlichkeit.
An diesem Punkt ist Kritik wahrscheinlich berechtigt. Man kann die Regierung nicht beraten und gleichzeitig in der Öffentlichkeit kritisieren. Dass dies ein Problem war, habe ich meinen Kollegen auch gesagt.
Insgesamt sind Sie mit der Arbeit der Taskforce aber zufrieden?
Ja. Die Frage ist eher, wieso die Schweiz nicht eine ständige wissenschaftliche Taskforce und einen «Chief Scientist» hat. Jedes andere Land, das ich kenne, hat eine solche Institution. In der Schweiz musste die Covid-Taskforce innert drei Wochen eingerichtet werden. Da ist es normal, dass auch Fehler geschehen.

Wie haben die pandemiebedingten Umstellungen an der EPFL funktioniert?
Das Umschalten ging sehr schnell. Innert 72 Stunden haben wir auf Online-Betrieb gewechselt. Es war nicht perfekt, aber es gab in der Lehre praktisch keinen Unterbruch, was ziemlich beeindruckend war. Forschung, welche die Coronapandemie betraf, wurde durchgehend weitergeführt. Und nach dem ersten Shutdown konnte auch die restliche Forschung wieder fast auf normalem Niveau fortgeführt werden. Wir haben jedoch die psychologischen Auswirkungen der Pandemie etwas unterschätzt. Dies sicher auch deshalb, weil am Anfang niemand wusste, dass sie anderthalb Jahre dauern würde. Gerade für die jüngeren Studenten war und ist die Situation weiterhin belastend.
Was hat die Situation bei Ihren Mitarbeitern ausgelöst?
Die Pandemie brachte Dinge zum Vorschein, die vorher nicht sichtbar waren. Manche Leute waren froh, zu Hause zu arbeiten, und waren dort sogar effizienter. Andere wurden total aus ihrer Komfortzone geworfen. Sie wollten unbedingt ins Büro zurück. Wir hatten aber eine strenge Homeoffice-Regel. Hier wurde sichtbar, wie wichtig die soziale Komponente am Arbeitsplatz ist.
Und bei den Projekten?
Hier war die Pandemie ein Beschleuniger: Seit Jahren kämpften wir zum Beispiel bei der Einführung der digitalen Unterschrift mit rechtlichen Fragen und der Cybersicherheit. In der Pandemie ist es uns dann aber innert weniger Wochen gelungen, dieses Projekt umzusetzen. Corona hat auch gezeigt, dass Homeoffice grundsätzlich funktioniert. Deshalb: Behalten wir, was wir Gutes gelernt haben, und lösen wir die Probleme, die noch bestehen.
Welche langfristigen Auswirkungen wird der Digitalisierungsschub auf die Hochschulen haben?
Als EPFL waren wir 2013 wahrscheinlich die erste Uni Kontinentaleuropas, die Online-Kurse angeboten hat. Wir hatten schon vor der Pandemie 100 bis 150 Kurse online durchgeführt und relativ viel Material entsprechend aufbereitet. Damit waren wir relativ gut vorbereitet. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass nicht alles online funktioniert. Laborkurse kann man nicht online machen, kreatives Brainstorming ist schwierig, Projektarbeit kaum möglich. Es braucht ein gutes Gleichgewicht. Es wird ein «New Normal» geben mit einer Kombination aus Online-Materialien und Präsenzunterricht.
In der Pandemie fanden keine Austauschsemester und keine Konferenzen statt. Was heisst das für die internationale Hochschulzusammenarbeit?
Schwierig ist es speziell für die jüngeren Forschenden. Sie sind in der Phase, in der sie sich ein Netzwerk aufbauen müssen. Eine Online-Konferenz ist interessant. Vorträge funktionieren gut. Es ist aber schwieriger, ein Netzwerk aufzubauen. Das geschieht sonst oft beim Kaffee und in der gemeinsamen Diskussion.
Wird sich die Reisetätigkeit langfristig verändern?
Früher reisten wir zu viel. Es gab zu viele Konferenzen – wichtige und weniger wichtige. Wir müssen uns nun irgendwo vor und nach der Pandemie wieder einpendeln. Letztlich bleiben Reisen und Vernetzung aber wichtig.
Was passiert nun, da das Rahmenabkommen mit der EU jetzt definitiv nicht zustande kommt?
Man muss jetzt schauen, wie es mit dem Forschungsabkommen weitergeht. Ähnliche Probleme hatten wir schon 2014, als ich noch beim Nationalfonds war. Es ist nicht gut für uns, wenn wir kein Forschungsabkommen haben. Unser Ziel und jenes der schweizerischen Regierung ist es darum, trotzdem eine Assoziierung an das neue Forschungsprogramm «Horizon Europe» zu erreichen.
Wird der internationale Wettbewerb unter den Spitzenhochschulen härter?
Ja, das ist klar. Die Konkurrenz besteht dabei nicht nur zwischen Hochschulen, sondern zwischen ganzen Wirtschaftsräumen und politischen Systemen. Es geht also nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um Geopolitik. Und Asien spielt eine zunehmend wichtige Rolle.

Wie sind die Schweizer Hochschulen hier aufgestellt?
Relativ gut. Sieben unserer zwölf Hochschulen befinden sich unter den 200 besten der Welt. Das ist mehr als die Hälfte. In den USA ist der Anteil der Spitzenunis viel tiefer. Die Hochschulen sind eine Stärke der Schweiz, und sie werden von den Steuerzahlern und der Politik gut unterstützt. Die Mittel sind hier gut investiert. Der «soziale Vertrag» zwischen Hochschulen, Politik und Wirtschaft funktioniert.
Hat die Coronakrise das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft geschwächt?
Nein, im Gegenteil. Das Vertrauen in die Wissenschaft ist gestiegen. Das zeigen verschiedene Studien. Wissenschafter und Ärzte geniessen weiterhin viel Vertrauen. Viel mehr als Politiker oder Journalisten (lacht).
Wer jetzt nicht erkennt, wie magisch die Wissenschaft sein kann, der wird es wohl nie verstehen.
Das war aber schon vor der Krise so.
Ja, aber die Unterschiede haben sich noch verschärft. Die Wissenschaft hat sich insgesamt gut positioniert. Wir dürfen stolz fragen: Wer hätte erwartet, dass wir nach weniger als einem Jahr schon Impfstoffe haben? Und nicht irgendwelche Vakzine, sondern High-Tech-Impfstoffe. Die mRNA-Technik wurde zwar für andere Anwendungen entwickelt, die smarten Forscher von Biontech und Moderna kamen aber innert weniger Wochen darauf, diese Technik neu zu nutzen. Was kann man sich sonst noch wünschen? Wer jetzt nicht erkennt, wie magisch die Wissenschaft sein kann, der wird es wohl nie verstehen.
Das Gesundheitswesen wächst, die soziale Wohlfahrt benötigt mehr Geld und das Bildungswesen steht in einem internationalen Wettbewerb: Macht es Ihnen keine Sorgen, wenn die Ausgaben der öffentlichen Hand weiter ansteigen?
Das ist eine beinahe philosophische Frage. Am Schluss geht es hier um Werte und den Sinn des Lebens. Als Gesellschaft muss man entscheiden, wie man die Ressourcen einsetzen will. Das ist ein wirklich schwieriges Problem, weil die Einschätzungen dazu von Person zu Person variieren.
Machen Sie ein Beispiel.
Blicken wir auf die Gesundheitskosten in einer alternden Gesellschaft: Ist es richtig, 15 Prozent des BIP für die Gesundheit einzusetzen, nur 10 oder gar 20 Prozent? Diese Entscheidung muss eine Gesellschaft fällen. Was klar ist: Wenn wir diese Frage nicht beantworten, werden wir irgendwann in eine Wand fahren. Mit unendlichen Ressourcen könnten wir das Leben stark verlängern. Unsere Ressourcen sind aber begrenzt.
Durch die enorme Neuverschuldung haben viele Staaten aber bereits Ressourcen der künftigen Generationen angezapft.
Ja. Das beschränkt sich aber nicht nur auf das Gesundheitssystem, sondern betrifft auch Sozialversicherungen und die Klimapolitik. In verschiedenen Bereichen schauen wir auf die heutige Generation und vernachlässigen die Konsequenzen, die erst in 50 Jahren sichtbar werden. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Es ist wichtig, dass wir ehrlich über diese sehr komplexen Abwägungen diskutieren.
Die Schweiz hat ein starkes öffentliches Bildungssystem. Wäre es trotzdem gut, wenn private Angebote mehr Platz hätten?
Schauen Sie: Ich kam aus den USA in die Schweiz zurück, weil ich meine Kinder in einem öffentlichen System in die Schule schicken wollte. Wir lebten in der berühmten Universitätsstadt Berkeley, und sogar dort schickt man seine Kinder nicht in die öffentliche Schule.
Deshalb werde ich das öffentliche Bildungssystem bis in mein Grab verteidigen. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt.
Was ja traurig ist.
Genau. Das Schulsystem in den USA funktioniert definitiv nicht besser als das System der Schweiz. Der meritokratische Zugang zu Bildung funktioniert bei uns besser als in weiten Teilen Amerikas. Deshalb muss man vorsichtig sein mit Änderungen im Schweizer System. Und bei den Hochschulen liefert die Schweiz Topresultate. Es braucht also keine private Hochschule, um gute Ergebnisse zu erzielen. Deshalb werde ich das öffentliche Bildungssystem bis in mein Grab verteidigen. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt.
Daniel Jung, Journalist vom Schweizer Monat. Dieses Interview erschien zuerst im Schweizer Monat und erscheint mit feundlicher Genehmigung der Redaktion im Condocet-Blog.