Die Oxford Dictionaries haben das Wort «post-truth» (postfaktisch) zum internationalen Wort des Jahres 2016 gewählt. Das Adjektiv beschreibe Umstände, in denen die öffentliche Meinung weniger durch objektive Tatsachen als durch das Hervorrufen von Gefühlen und persönlichen Überzeugungen beeinflusst werde.
Auch die im Kanton Basel-Stadt wieder aufgeflammte Diskussion über Vor- und Nachteile der integrativen Schule bewegt sich leider weitgehend auf dieser postfaktischen Ebene. Das Erziehungsdepartement behauptet allen Ernstes, dass die im Riehener Einwohnerrat geforderte Wiedereinführung der Einführungsklassen dem Behindertengleichstellungsgesetz widerspreche und deshalb abzulehnen sei. Eine substanzielle pädagogische Begründung wird schon gar nicht mitgeliefert.
In der Sonder-, Heil-, Behinderten- oder Rehabilitationspädagogik finden sich allerdings sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob das Fortbestehen spezieller Einrichtungen dem Inklusionsgedanken widerspreche. In der UN-Konvention von Salamanca aus dem Jahr 1994 ist an keiner Stelle die Rede davon, dass Sonderschulen abzuschaffen seien. Im Mittelpunkt der Bemühungen um Integration stehen nicht organisatorische Fragen, sondern die Erfüllung der Bedürfnisse aller Lernenden.
So kann sich etwa die Gebärdensprache Gehörloser nur dort entfalten, wo den Betroffenen ein entsprechender sozialer Ort bereitgestellt wird. Ähnlich verhält es sich im Hinblick auf intensivpädagogische Settings bei schwer verhaltensgestörten Schülern.
«Ein überschaubarer institutioneller Rahmen ist die Voraussetzung dafür», schreibt Prof. Dr. Bernd Ahrbeck, «dass sich intensive Beziehungserfahrungen einstellen, die für eine persönliche Veränderung unabdingbar sind.» (Inklusion – Eine Kritik, Verlag W. Kohlhammer 2014) Die Reihe der Beispiele liesse sich fortsetzen.
Der Kanton Basel-Stadt hat sich entschlossen, die UNESCO-Erklärung mit der generellen Zielsetzung einer «Bildung für alle» kompromisslos umzusetzen: Liquidation der Kleinklassen, Abschaffung der Einführungsklassen, Reorganisationen beim Logopädischen Dienst, bei der Psychomotorik und bei der Sprachheilschule. Die Konsequenz ist nicht etwa eine spürbare Verbesserung des Förderangebots für die schwächeren Kinder, sondern vor allem eine belastende Vermehrung des bürokratischen Aufwandes für die unterrichtenden und beurteilenden Personen.
Diese Bildungspolitik ist aber nicht «alternativlos», um den Lieblingsbegriff der deutschen Kanzlerin zu gebrauchen. «Freiheitlich angelegte demokratische Strukturen vertragen sich nicht mit ekklesialen Alleinseligmachensansprüchen», mahnt Emil E. Kobi, ehemals Privatdozent für Heilpädagogik an der Universität Basel.
«Unterschiedliche kulturelle Erwartungen erfordern eine variantenreiche Schule. Schule bedarf, gerade für Behinderte, der Wahl- und Wechselmöglichkeiten. Ein Inklusions-Konzept, das nicht in den Ruch einer ‹Totalen Institution› geraten will, hat zumindest die Möglichkeit zur Selbst-Exklusion offen zu halten.» (publiziert in «Heilpädagogik online», 02/08)
Zurecht weist Kobi darauf hin, dass Erziehung und Bildung stets kultureller Rahmenbedingungen, Orientierungen und einer gesellschaftlichen und ideellen Trägerschaft bedürfen. Es kann deshalb wohl nicht an einer UN-Konferenz in der schönen Stadt in Kastilien-León entschieden werden, welche spezifischen Schulformen in Basel-Stadt oder Riehen zulässig sind.
In der UN-Konvention von Salamanca aus dem Jahr 1994 ist an keiner Stelle die Rede davon, dass Sonderschulen abzuschaffen seien. Im Mittelpunkt der Bemühungen um Integration stehen nicht organisatorische Fragen, sondern die Erfüllung der Bedürfnisse aller Lernenden.
Fast allen Fachleuten, den Pädagogen an der «Front» sowieso, ist klar, dass verhaltensauffälligen, lerngestörten, sozial, oft auch sprachlich und kulturell noch nicht integrierten Kindern eine besonders geförderte Schulentwicklung geboten werden muss. Die «integrative Schule» bietet dafür nur ein ungenügendes, für alle Beteiligten oft frustrierendes Angebot.
Die Konsequenz ist nicht etwa eine spürbare Verbesserung des Förderangebots für die schwächeren Kinder, sondern vor allem eine belastende Vermehrung des bürokratischen Aufwandes für die unterrichtenden und beurteilenden Personen.
Dazu kommt noch ein kaum übersehbarer Etikettenschwindel: Die heilpädagogische Betreuung in einer Vielzahl von Programmen und Personen führt zu einer Verzettelung des Unterrichts, zu Unruhe und Konzentrationsproblemen. Die Schüler sind formal «integriert», sie stehen schliesslich auf der gleichen Klassenliste, werden aber häufig separiert unterrichtet. Den Kindern fehlt dann eine stabile und vertraute Lernumgebung, wie sie in den unterdessen verteufelten, fälschlicherweise als integrationsfeindlich denunzierten Kleinklassen gewährt wurde.
Kritikern der «integrierten Schule», die sich nicht vorbehaltlos der karitativ-missionarischen Agitation unterwerfen und sich einem «romantisierenden Idealismus» (Kobi) verweigern, werden Vorurteile, falsches Bewusstsein, Aberglaube, antiquiertes Denken, mangelnde geistige Beweglichkeit vorgeworfen und zuweilen stellt man sie sogar unter Rassismusverdacht.
Schulpolitische Fragen werden hierzulande kaum kontrovers debattiert. Es herrscht ein Klima der Diskussionsverweigerung. Der Forderung, Einführungs- oder gar Kleinklassen wieder einzuführen, wird nicht mit pädagogischen, sondern fast ausschliesslich mit formalen Argumenten begegnet. Aus dem Dokument von Salamanca leitet sich das Konkordat Sonderpädagogik ab, davon das revidierte Schulgesetz. Und daraus wiederum der absolute Integrationsauftrag. Ein geschlossener, widerspruchsfreier Kreislauf. Wir kennen das Muster von päpstlichen Enzykliken.
«Die Wirklichkeit dringt nicht in die Welt des Glaubens», klagt Marcel Proust. Eine verhängnisvolle Entwicklung. Nicht nur, aber vor allem für die Schulen.
Fast allen Fachleuten, den Pädagogen an der «Front» sowieso, ist klar, dass verhaltensauffälligen, lerngestörten, sozial, oft auch sprachlich und kulturell noch nicht integrierten Kindern eine besonders geförderte Schulentwicklung geboten werden muss.




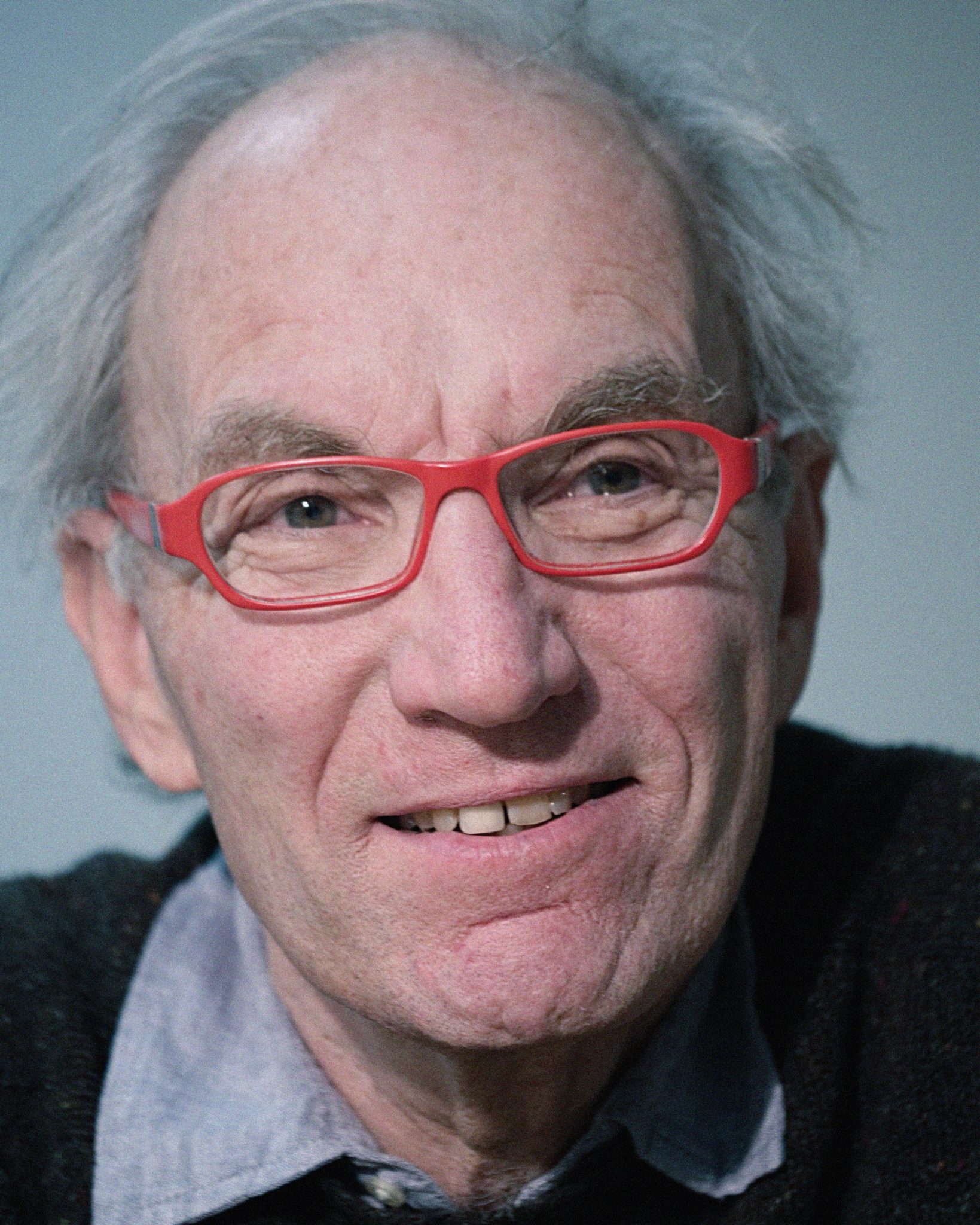

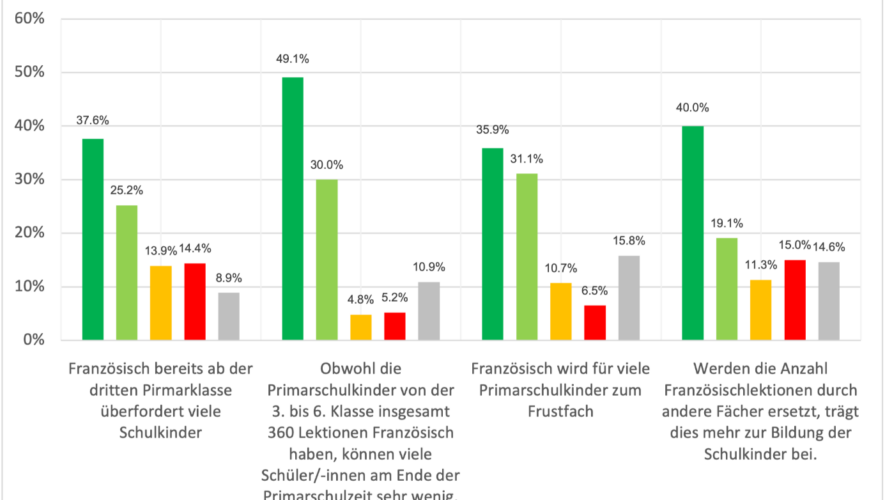
Der Kommentar von R. Stark spricht mir aus Herz und Seele.
Riccardo Bonfranchi