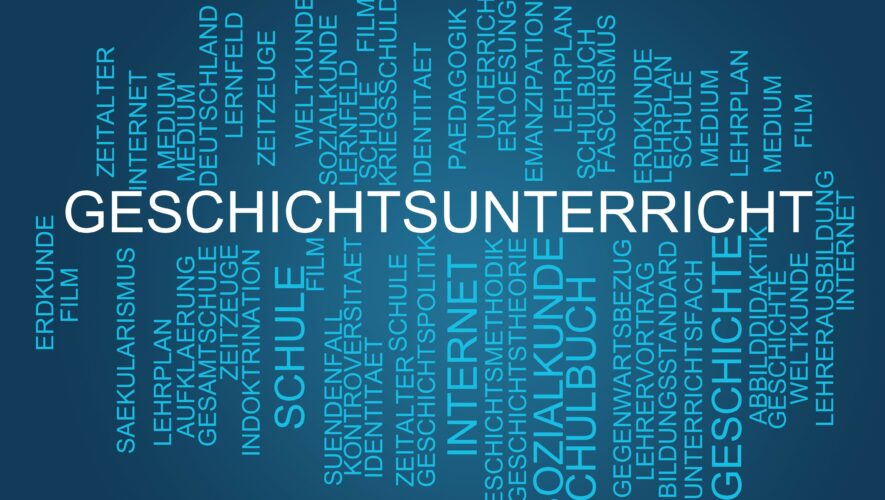Soeben rauschen zum fünften Mal die PISA-Ergebnisse durch den Blätterwald. Wiederum eine Hiobsbotschaft: die Schweizer Schüler(innen) unterdurchschnittlich schlecht im Lesen (484 Punkte, Durchschnitt aller Länder 487 Punkte), sehr gut in Mathematik (515 Punkte, Durchschnitt aller Länder 487 Punkte). Zudem die unerfreuliche Tendenz, dass die Lesefähigkeit seit 2012 konstant abnimmt, dass inzwischen 24% der 15-Jährigen nicht mehr verstehen, was sie lesen.1
Völlig entgegengesetzte Resultate
- Nirgendwo wurde auf den grundlegenden Widerspruch hingewiesen: Im Mai dieses Jahres publizierte die EDK die Resultate der ÜGK (Überprüfung der Grundkompetenzen 2017) im 9. Schuljahr. Diese hatten ein exakt gegenteiliges Bild gezeichnet: Mathematik schwach, nur wenige erreichen die Mindeststandards. Lesen topp, die meisten verfügen über gute Lesekompetenzen.2 Ein halbes Jahr später die PISA-Ergebnisse von 2018 genau umgekehrt, sehr gut in Mathematik, grottenschlecht im Lesen: Wie ist das möglich?
PISA eruiert, ob die 15-Jährigen die nötigen fachlichen Kompetenzen fürs Leben erworben hätten, während die ÜGK einen Ausschnitt der Grundkompetenzen des Lehrplans überprüft.
Der Bericht des PISA-Konsortiums geht in einer Fussnote auf die Unterschiede der beiden Tests ein: PISA eruiere, ob die 15-Jährigen die nötigen fachlichen Kompetenzen fürs Leben erworben hätten, während die ÜGK einen Ausschnitt der Grundkompetenzen des Lehrplans überprüfe.
Der Steuerzahler reibt sich die Augen
Man reibt sich die Augen. Hat man nicht in einem aufwändigen Verfahren des Projektes Harmos unter dem Eindruck des PISA-Schocks des Jahres 2000 den Lehrplan 21 geschaffen, der genau diejenigen Kompetenzen vermitteln sollte, die im PISA-Schulrucksack gefehlt hatten? Wurde nicht die ganze Kompetenzorientierung damit begründet, dass die Lernenden bisher bloss totes Wissen angehäuft, statt die Anwendungsfähigkeiten für praktische Lebensaufgaben gelernt hätten?
Was gilt jetzt?
Wie ist der Widerspruch zu erklären? Entweder enthält der Lehrplan 21 die falschen Kompetenzen, die Schüler(innen) lernen etwas anderes als das von PISA geforderte. Oder die Tests und die Bewertung einer der Prüfungsinstanzen liegen falsch. Jedenfalls wäre es dringend notwendig, die Diskrepanz zwischen den Resultaten erklärt zu bekommen.
- Der Artikel «Pisa: Medienkompetenz der Schüler muss gefördert werden», NZZ, 3.12., von Erich Aschwanden schafft das Kunststück, die schlechten Lesekenntnisse in ein flammendes Plädoyer für die Digitalisierung umzumünzen. Inzwischen seien Lesekompetenzen als Medienkompetenzen zu betrachten. An den PISA-Ergebnissen sei abzulesen, dass die Schule mit der Digitalisierung hinterherhinke.

Bild: api
Allerdings steht davon nichts im Bericht des PISA-Konsortiums. Im Gegenteil: Der Bericht stellt fest, dass die Lesekompetenzen international ab 2012 abnähmen und dass diese Abnahme mit der Ausbreitung des Smartphones korreliere. Ausserdem wird beklagt, dass die Lesefreude markant abgenommen habe, dass das Lesen als Freizeitvergnügen hingegen stets mit besseren Leseleistungen korreliere.
Das Beispiel des NZZ-Artikels zeigt, wie es offensichtlich der IT-Branche gelingt, jedes schulische Thema sofort so umzubiegen, dass es Wasser auf ihre Mühle wird.
1 Konsortium PISA.ch (2019). PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich. Bern und Genf: SBFI/EDK und Konsortium PISA.ch.
2 Konsortium ÜGK (Hrsg.) (2019). Überprüfung der Grundkompetenzen. Nationaler Bericht der ÜGK 2016: Mathematik 11. Schuljahr. Bern und Genf: EDK und SRED. https://doi.org/10.18747/PHSG-coll3/id/386
und
Konsortium ÜGK (Hrsg.) (2019). Überprüfung der Grundkompetenzen. Nationaler Bericht der ÜGK 2017: Sprachen 8. Schuljahr.Bern und Genf: EDK und SRED. https://doi.org/10.18747/PHSG-coll3/id/385