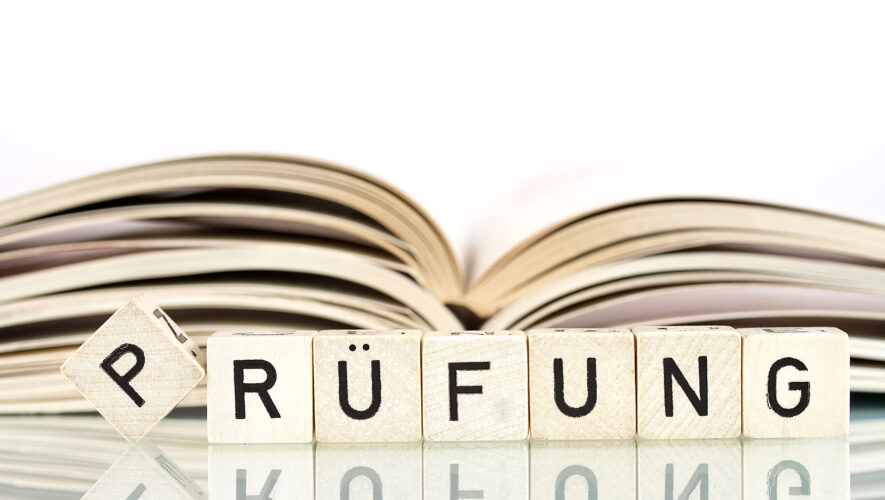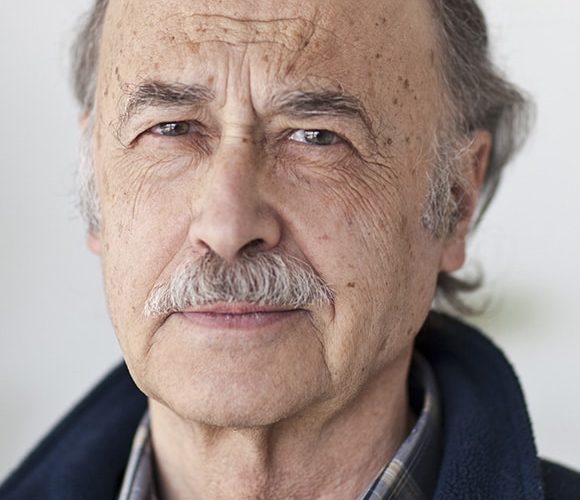Linda McMahon ist ehemalige Wrestling-Managerin, Milliardärin, im Vorstand der Trump Media & Technologie Group und neue Bildungsministerin in der US-Regierung von Donald Trump. Ihr Ziel und offizielle Aufgabe: Abschaffung des Bildungsministeriums, dem sie vorsteht.

und Präsident des Zürcher Verbandes der
Lehrkräfte in der Berufsbildung.
In der Schweiz hätte gemäss SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) bloss die schriftliche Schlussprüfung im Fach Allgemeinbildung (ABU) an gewerblich-industriellen Berufsfachschulen abgeschafft werden sollen. Dennoch kam es darüber in den letzten Monaten landesweit zu einer grossen, in den Medien und im Bundeshaus ausgetragenen Kontroverse. Das ist positiv; Bildungsfragen sind zentral, und es ist gut, wenn sich breite Kreise mit ihnen befassen.
Bis anhin setzt sich die Schlussnote der Allgemeinbildung zu einem Drittel aus der Erfahrungsnote, zu einem Drittel aus der Vertiefungsarbeit und zu einem Drittel aus der schriftlichen Schlussprüfung zusammen. Diese bewährte Dreiteiligkeit hätte nun verändert werden sollen: Die schriftliche Schlussprüfung wäre weggefallen, die Schlussnote hätte zu 50% aus der Erfahrungsnote und zu 50% aus der Vertiefungsarbeit (neu: Schlussarbeit) bestanden. Die vom SBFI mit der ABU-Reform beauftragte private Firma Interface hatte diese Idee 2021 eingebracht, ohne Begründung und ohne empirischen, hauptsächlich wohl vor einem pekuniären Hintergrund: Wenn man bei einer Reform nur etwas an den Stellschrauben dreht und diese feinjustiert, ist das Auftragsvolumen um einiges geringer, als wenn man mit dem Vorschlaghammer dreinschlägt, um dann alles neu aufbauen zu können. Weil die Pädagogischen Hochschulen drittmittelabhängig sind, sprangen sie auf diesen Zug auf. Auch hier gilt: Je mehr verändert wird, je mehr lässt sich verdienen, weil die Neuerungen in den Kantonen und an den einzelnen Schulen implementiert werden müssen: eine lohnende Aufgabe, der sich die Pädagogischen Hochschulen noch so gerne annehmen.
Ich behaupte: Finanzielle Aspekte standen am Ursprung der Reformvorlage, nicht pädagogische Überlegungen, auch wenn dies vielen Beteiligten nicht bewusst war.
Schriftliche Abschlussprüfungen sind fair, weil man keine externe Hilfe in Anspruch nehmen kann.
Von nun an galten gemäss den Protokollen die folgenden, unhinterfragten und darum unhaltbaren Prämissen, die von den Hochschulen eingebracht worden waren: Schriftliche Schlussprüfungen fragen Faktenwissen ab, mündliche Prüfungen sind kompetenzorientiert.
Nicht berücksichtigt wurden die vielen, sehr guten Argumente, die für die Beibehaltung der schriftlichen Schlussprüfung sprechen:
- Sie ist fair, weil man keine externe Hilfe in Anspruch nehmen kann.
- Sie verhindert eine Abwertung des Fachs, weil es ja in der Berufskunde eine schriftliche Schlussprüfung gibt, im Übrigen auch in den weiterführenden Ausbildungen.
- Sie ermöglicht es, am Ende der Lehrzeit so wichtige Themen wie Miet- und Arbeitsrecht, Schweizer Demokratie, Versicherungen, Steuern, Migration, Wirtschaft und Umwelt zu vertiefen.
- Sie führt dazu, dass die Schlussnote inhaltlich und personell breiter abgestützt, also aussagekräftiger ist, was zur Qualitätssicherung beiträgt.
- Sie ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, noch einmal Leistung zu zeigen und damit Selbstvertrauen zu tanken.

Nun ist es nicht so, dass das Projekt im stillen Kämmerlein ausgearbeitet worden wäre. Es entstand in einer zwar stillen, aber sehr grossen und folglich auch sehr teuren Kammer. Am Projekt beteiligt waren neben der erwähnten Firma Interface 3 Personen in der Projektleitung, 10 aus der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK, 7 in der Tripartiten Berufsbildungs-Konferenz TBBK, 15 in der Begleitgruppe, 4 in der Pädagogischen Fachberatung, 16 in der Arbeitsgruppe und 7 aus der Table Ronde Berufsbildender Schulen. In der Schweiz nennt man ein solches Gebilde «Verbundpartnerschaft», hier bestehend aus Vertretungen von SBFI, Schulen, Kantonen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite.
Spätestens, als Ende 2022 ChatGPT aufkam, hätte jemand aus diesem grossen Personenkreis versuchen sollen, die Notbremse zu ziehen oder wenigstens Fragen zu stellen. KI veränderte die Ausgangslage radikal. Dank ihr ist es möglich, Arbeiten schreiben zu lassen, ohne dass ein Nachweis möglich ist. Das abzuschaffen, was noch überprüfbar ist und das aufzuwerten, was nicht mehr überprüfbar ist, macht wenig Sinn. Statt nun noch einmal über die Bücher zu gehen, lautete die Losung, in aller Einigkeit weiterzumarschieren, immer geradeaus, auch wenn vorne allenfalls ein Abgrund ist. Niemand wagte, das zeigen die Protokolle, den Widerspruch; die Verbundpartnerschaft wurde zur Verbandelungspartnerschaft. Wenn man sich nur noch gegenseitig nach dem Maul redet, finden keine Gespräche mehr statt.
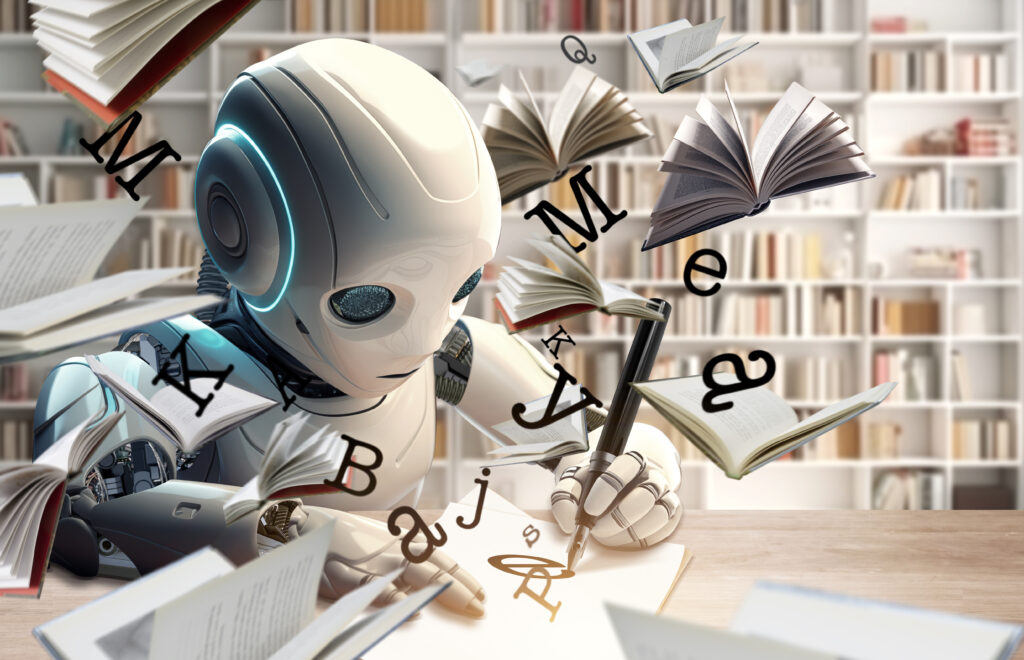
Schliesslich einigte man sich auf einen Notnagel und eine ziemlich abenteuerliche Argumentation: Die schriftliche Schlussprüfung werde gar nicht abgeschafft, sondern bloss ersetzt durch eine mündliche Prüfung über die Schlussarbeit, was es zudem ermögliche, vertiefende Fragen zu stellen und so eine allfällige KI-Arbeit als solche zu entlarven. Eine mündliche Prüfung sei besonders zeitgemäss und im Zuge der Ausrichtung nach Handlungskompetenz alleinseligmachend.
Dies ist in zweierlei Hinsicht falsch:
Erstens: Es gab schon immer nach der Vertiefungsarbeit eine Fragerunde in Form einer mündlichen Prüfung, die in die Bewertung einfloss.
Zweitens: Wenn man – was man sinnvollerweise tun müsste – eine KI-Arbeit verhindern will, kann man nur noch sehr eng gesteckte Themen bewilligen, z.B.: Das Berghaus Edelweiss im Gafiental hinter St. Antönien. Die Schülerin, die dieses Thema wählt, reist ins Gafiental, interviewt den Besitzer und die Köchin, spricht mit den Kunden, hilft drei Tage lang aus, unternimmt eine Wanderung, fotografiert, filmt, beschreibt Gasthaus, Gastwirt, Gäste, Gegend. Das kann man alles überprüfen und KI mit Ausnahme der Sprachkorrektur verhindern. Aber: Eine sinnvolle, mündliche Prüfung darüber ist unmöglich, weil die Arbeit selbsterklärend ist. Mündliche Prüfungen über schriftliche Arbeiten machen nur Sinn, wenn sie allfällige KI-Arbeiten betreffen, die man ja nicht wollen sollte. Es handelt sich hier also um die Quadratur des Kreises, die, wie wir wissen, niemals gelingen kann.
Am Ende nützte es dem SBFI nicht einmal mehr, dass es im Zusammenhang mit der Auswertung der Vernehmlassung getrickst hatte, indem es z.B. Nicht-Antworten zu den Befürwortern der Abschaffung zählte.
Noch vor einem Jahr schien es ausgeschlossen, die Abschaffung der schriftlichen Schlussprüfung verhindern zu können, obschon es an der Basis rumorte und die grosse Mehrheit der ABU-Lehrerinnen und -lehrer an der schriftlichen Schlussprüfung festhalten wollte. Nach und nach begann sich der Widerstand zu formieren. So begannen ab April 2024 zum Beispiel zwei aktive und zwei ehemalige ABU-Lehrer aus dem Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung ZLB das scheinbar Unmögliche zu versuchen. Sie gewannen Unterstützung in ihrem Umfeld, sie argumentierten, alarmierten, fanden Gehör in der Presse und auch im Bundeshaus, wo bereits erste Parlamentarierinnen kritische Fragen gestellt oder Interpellationen eingereicht hatten (Nina Fehr Düsel, Regina Durrer, Marie-France Roth-Pasquier). Später machte Thierry Burkart Druck.

Am Ende nützte es dem SBFI nicht einmal mehr, dass es im Zusammenhang mit der Auswertung der Vernehmlassung getrickst hatte, indem es z.B. Nicht-Antworten zu den Befürwortern der Abschaffung zählte. Der Druck war nun nämlich sehr massiv: Die Kommissionen Wissenschaft, Bildung und Kultur sowohl des National- als auch des Ständerats forderten vom Bundesrat die Beibehaltung der schriftlichen ABU-Schlussprüfung. Dem SBFI fehlte nun einerseits die Kraft, die Sache durchzuzwängen, andererseits der Mut zum Rückzug. So wurde am 28.2.2025 anlässlich einer äusserst kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekanntgegeben, dass der Entscheid, ob es eine schriftliche Schlussprüfung gibt oder nicht, den Kantonen überlassen wird – eine Niederlage, kaschiert als (im Übrigen fauler!) Kompromiss: Kantönlidenken statt der anvisierten Harmonisierung. Wird so das Ziel der Reform, die Stärkung des Fachs Allgemeinbildung, erreicht? Wenigstens wurde die geplante, noch grössere Schwächung verhindert.

Die Abschaffungsbefürworterinnen und -befürworter, die sich nun in den Kantonen durchsetzen wollen, bringen als Hauptargument ins Spiel, eine schriftliche Schlussprüfung sei nicht handlungskompetenzorientiert.
Dazu ist zweierlei zu sagen:
Erstens: Eine mündliche Prüfung ist nicht handlungskompetenzorientierter als eine schriftliche. Letztere kann sehr wohl handlungskompetenzorientiert sein, indem man z.B. konkret panaschieren und kumulieren oder eine Klage wegen missbräuchlicher Kündigung einreichen lässt.
Zweitens: Man sollte die Handlungskompetenzorientierung gerade im Fach Allgemeinbildung nicht zum Fetisch erheben, das Wissen, Denken und Handeln nicht gegeneinander ausspielen. Grotesk und Zeichen einer Fehlentwicklung, dass ich diese Selbstverständlichkeit betonen muss.
Um zu Linda McMahon und Donald Trump zurückzukehren: Die aktuellen Vorgänge in den USA sind von fundamentaler Bedeutung – auch für uns. Es drängt sich geradezu auf, sie im Fach Allgemeinbildung zu besprechen. Wenn man nicht einen lächerlichen Kniff anwendet («Schreiben Sie einen Brief an Donald Trump») wird diese Unterrichtssequenz nicht handlungskompetenzorientiert vonstatten gehen können. Sieht irgendjemand hierbei ein Problem? Ernsthaft?
Wer nur noch handelt, wird zum Tier!