Gestern kehrte ich in meinem Bieler Lieblingslokal ein, um dort einen Kaffee zu trinken und einige Geschäfte zu besprechen. Am Tresen entdeckte ich Matthias G.* einen Ex-Schüler, der bereits seit zwei Jahren in diesem Betrieb arbeitet. Mathias war vor rund 12 Jahren einer meiner «schwierigen» Schüler. Intelligent, aber frech, robust und stinkfaul. Zu mir in die Klasse kam er nach einem befristeten Timeout, weil er sich mit dem vorherigen Klassenlehrer nicht verstand. Auch bei mir knallte es ab und zu, aber er erwies sich als führbar. Wir suchten für ihn eine Leerstelle als Motorradmechaniker, sein Traumberuf. In der Schnupperlehre brillierte der schulmüde Rabauke und das Geschäft offerierte ihm sofort einen Lehrvertrag. Er konnte sich sogar – wenn es in der Schule nicht ging – kurzfristig abmelden, und an den Motorrädern herumwerkeln. Die Lehre freilich brach er – bedingt auch durch den tragischen Tod seiner Mutter – nach anderthalb Jahren wieder ab. Mit grossem Einsatz durch den Vater und den Behörden konnte er seine Lehre in einem anderen 2-Radgeschäft abschliessen.

Es folgten Wanderjahre durch das juvenile Leben eines Mitglieds der Generation Z. Vor zwei Jahren traf ich Matthias hinter der Bar des besagten Lokals wieder. Er sah blendend aus, wirkte aufgestellt und freundlich und erwies sich als ein richtiger Chrampfer. «Die Arbeit macht mir richtig Spass. Der alternative Groove der Beiz, die vielen jungen Leute, die Gespräche, ich merkte, ich brauche das,», erklärte er mir nach seinem Arbeitseinsatz bei einem Bier. Bald einmal übernahm er auch Verantwortung für eine Schicht und war laut den Besitzern des Restaurants eine unverzichtbare Arbeitskraft. Seinen Schilderungen ergaben das Bild eines für solche Jungs nicht seltenen Reifeprozesses und eine nicht für möglich gehaltene Wandlung zu einem bodenständigen Erwachsenen.
In letzter Zeit aber habe ich Matthias nicht mehr hinter dem Tresen gesehen, bis eben gestern. Ich ging erfreut zu ihm und meinte, es sei schön, ihn mal wieder hier zu erleben. Er antwortete, dass er mich eh mal sprechen müsse. Er hätte jetzt noch einen anderen Job. Er sei jetzt Lehrer an einem Oberstufenzentrum. Auf meinen verdutzten Blick lächelte er: «Es ist keine richtige Klasse, sondern eine Förderklasse, 7. bis 9.!» Etwas naiv fragte ich ihn, ob er denn eine Zusatzausbildung gemacht hätte. Er verneinte, aber – so fügte er hinzu – das werde er sicher nachholen. Die Arbeit mache ihm nämlich Spass. «Gell», meinte er augenzwinkernd, «das hättest du nicht gedacht!» Ich schluckte meine aufkommende Empörung runter, weil ich Matthias sehr mochte und fragte ihn weiter, wie es denn so ginge. Er meinte, dass es am Anfang etwas chaotisch gewesen sei, aber es jetzt gut ginge. Vielleicht, könne ich ihm ja noch ein paar Tipps geben.
Zuzufügen ist noch, dass diese Förderklasse in Biel eigentlich eine Kleinklasse ist. 12 Schüler, allesamt mit einem spezifischen Förderbedarf und fast ausschliesslich mit Migrationshintergrund. Sie seien brav, die Eltern auch.
Reklamationen sind wohl keine zu erwarten. Heilpädagoginnen sind rar gesät, und diejenigen Pädagogen, die eine solche Klasse führen und wirklich fördern könnten, haben sich längstens in gut alimentierte Bürojobs verzogen, wo sie an neuen Inklusionsmodellen , an einer notenfreie Schulstube oder an der Abschaffung der Hausaufgaben arbeiten.
*Name geändert




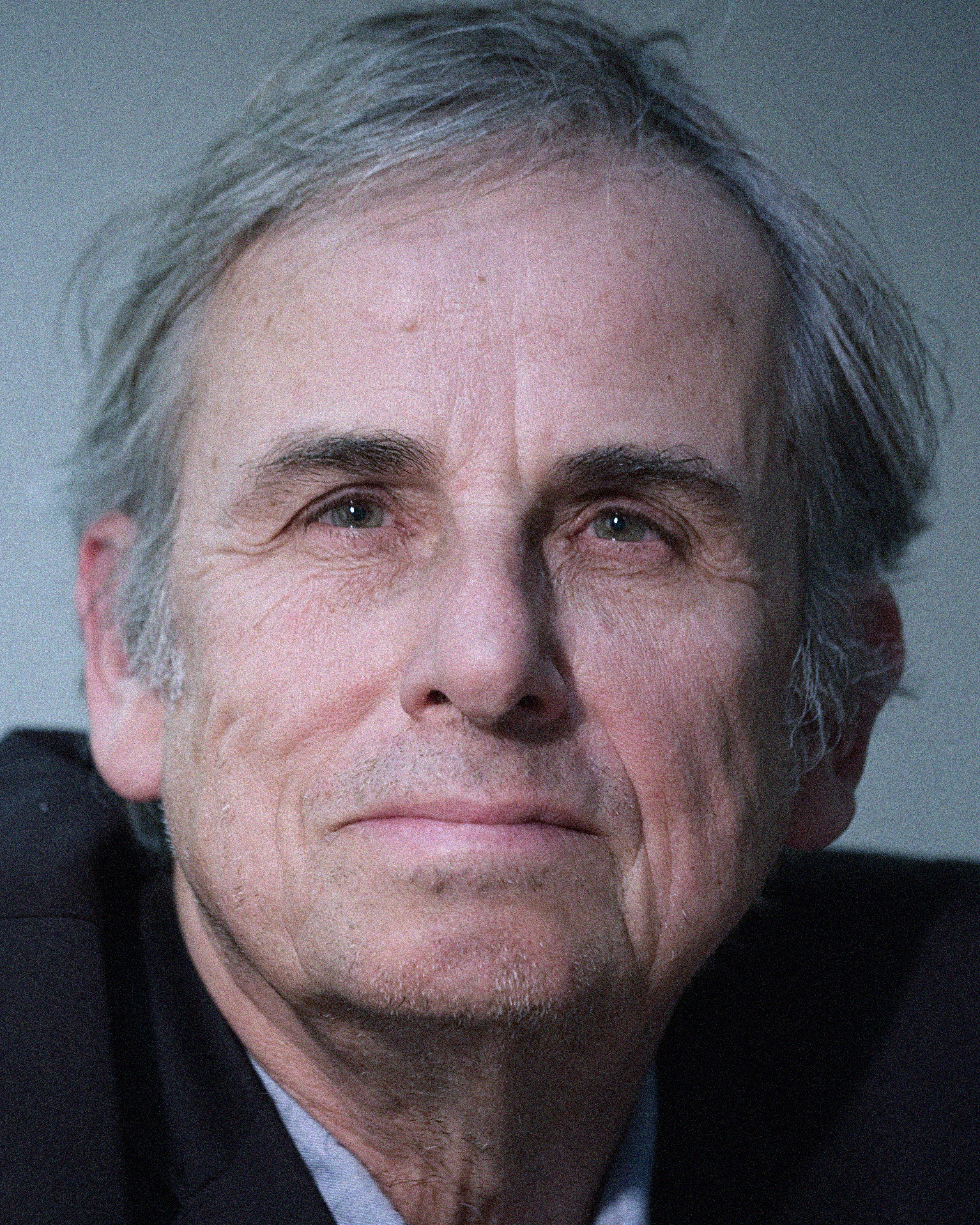


Von der Bar in die Lernbar…
Grundsätzlich sind viele Wege möglich. Ich habe das mit Schülern auch erlebt. Doch dieses Beispiel ist krass. Es zeigt, wie krass die Zustände in staatlichen Schulen wirklich sind. Staatsverschuldet!