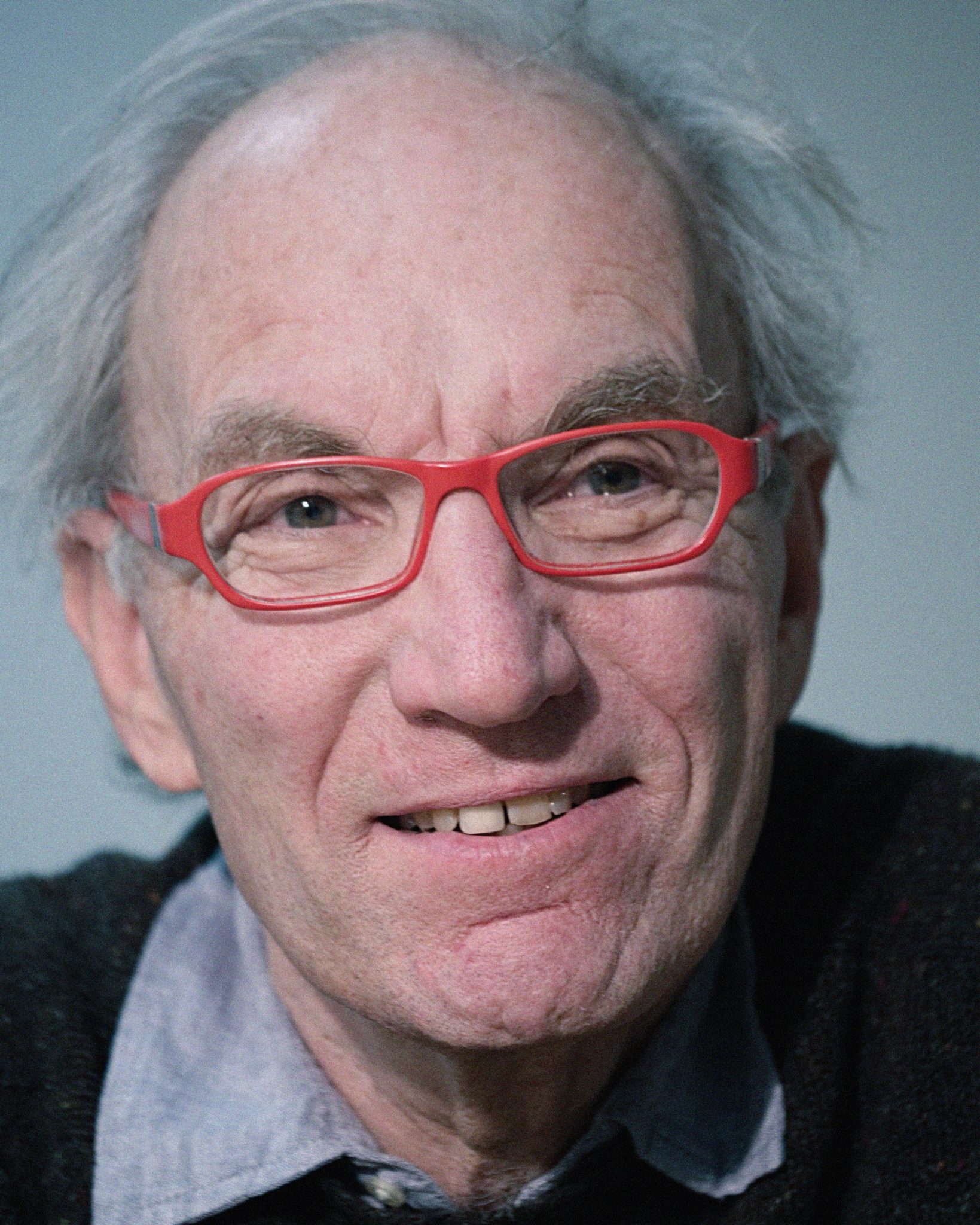«Kaum blickten wir in die Vergangenheit, sahen wir nichts als Fortschritt. Kaum blickten wir in die Zukunft, nichts als Niedergang.» Roger Willemsen
Zeitungen – auf Papier. Damit bin ich aufgewachsen. Zu Hause im damals sehr konservativen St. Gallen hatten wir den Appenzeller Volksfreund abonniert, das Hoforgan des Innerrhoder Dorfkönigs Raymond Broger, die Ostschweiz, devote Schleppenträgerin des aufstrebenden katholisch-konservativen (später CVP, heute Mitte) Politikers Kurt Furgler, die sozialdemokratische AZ und, besonders wichtig, die Frankfurter Rundschau mit dem sozialistischen Emigranten Karl Gerold als Herausgeber und Chefredaktor.
Karl Gerold war 1933 nach einigen Tagen Haft und dem Entzug der Grenz- und Passpapiere nach Basel geflüchtet. 1943 heiratete er die Basler Pianistin Elsy Lang. Auch in der Schweiz wurde die Lage für Gerold bald brenzlig. Nach mehreren vergeblichen Versuchen verhaftete ihn die Fremdenpolizei, 1943/44 sass er monatelang im Gefängnis respektive im Internierungslager. Und, für die heutige Neutralitätsdebatte interessant, 1945 wurde der Widerstandskämpfer Karl Gerold von einem Schweizer Militärgericht wegen geheimdienstlicher Tätigkeit für die Allierten (!) zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.
Heute wird gerne die Mär verbreitet, in der Politik und in den Medien, die politischen Auseinandersetzungen seien, im Gegensatz zu früher, unversöhnlich, konfrontativ, kompromisslos.
Vor gut fünfzig Jahren begann ich auch regelmässig zu schreiben. Artikel für die Ostschweizer, später die Basler AZ. Kolumnen für den Baslerstab, den Doppelstab, die bz und zuletzt die Basler Zeitung. Unzählige Gastkommentare und Leserbriefe kamen hinzu.
Auf der anderen Seite nahm mich die Politik gefangen. 1968 Eintritt in die SP, angeworben vom nachmaligen St. Galler Polizeidirektor Florian Schlegel. In Basel dann Grossrat, Partei- und Fraktionspräsident, Verfassungs- und Grossratspräsident.

Keine Zeit für politische Leichtmatrosen. Parteispaltung, Jugendunruhen, Häuserbesetzungen, die Auseinandersetzungen um die Stadtgärtnerei.
Diese Konflike waren schon im beschaulichen St. Gallen aufgetreten. Aus Empörung über den angeblich zu jugendfreundlichen Kurs der SP hatte der Gewerkschaftssekretär Toni Falk während der Sitzungen im Volkshaus sogar den WC- Schlüssel weggesperrt. Und als wir endlich einen jüngeren Redner für die 1.-Mai-Kundgebung nominieren durften, Ende der 1960er Jahre, hatte unser Sprecher Willi Gerster nichts Besseres tun, als über sein Steckenpferd, die freie Liebe zu referieren. Damit war dann das Tischtuch endgültig zerschnitten.
Nicht die Intensität der Diskussionen hat zugenommen, sondern die Empfindlichkeit der Akteure.
Heute wird gerne die Mär verbreitet, in der Politik und in den Medien, die politischen Auseinandersetzungen seien, im Gegensatz zu früher, unversöhnlich, konfrontativ, kompromisslos. Wer damals, in diesen guten, alten Zeiten dabei war, kann sich über derart nostalgische Beschreibungen nur wundern. Helmut Hubachers Wahlschlacht 1976, die mit harten Bandagen und persönlichen Angriffen geführten Debatten anfangs der 1980er Jahre, der Streit um die Polizeieinsätze (keine Erfindung von 2023), die Fichenaffäre, die Debatte um die Nordtangente, um die Atomenergie. Die sich häufenden Abwahlen von Regierungsräten: Schmid, Stutz, Gysin, Schaller.
Nicht die Intensität der Diskussionen hat zugenommen, sondern die Empfindlichkeit der Akteure. In den Parteien und auf den Redaktionen. Es gehört unterdessen zum guten Ton, ein Opfer zu sein. Von irgendwas und irgendwem sind sie immer gekränkt. Die Folge: Denkverbote, Maulkörbe. «Ohne Streit», diagnostizierte einst Heiner Geissler, «wird man zuerst uninteressant, dann langweilig, schliesslich einschläfernd und am Schluss ein Fall für das Betäubungsmittelgesetz. Konform, uniform, chloroform.»
Als Politiker im Ruhestand und emiritierter Kolumnist kenne ich beide Seiten der Medaille. Jahrzehntelang, quasi von Amtes wegen, konnte ich mich über Journalistinnen und Journalisten aufregen, die meine Partei und ihre Exponenten ungerecht beurteilt hatten. Eine zweistellige Zahl von Redaktorinnen und Redaktoren in den verschiedenen Lokalressorts kann davon ein Lied singen. Und eine gute Handvoll Chefredakteure dazu.
In den letzten Jahren ist noch die Unsitte aufgekommen, Politikerinnen und Politker zu benoten; nach teilweise fragwürdigen, dubiosen Kriterien. Angelehnt an die Noten, die am Tage nach einem Fussballspiel an die Kicker vergeben werden. Klassisches Beispiel: Der Torhüter war während des gesamten Spiels unbeschäftigt. Note 4.5.
Hier wäre aber Vorsicht geboten, vielleicht sogar Demut. Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen und Journalisten liegen beide in den Reputations-Rankings der Berufe regelmässig auf den hintersten Plätzen. Ihr Ansehen übertrifft nur knapp die Werte von Versicherungsvertretern und Mitarbeitern von Call-Centern.

Mit der – notwendigen – Pflicht und Fähigkeit der Journalisten, die Volksvertreter kritisch zu begleiten und Missstände gründlich aufzuklären, hat leider ihr Wille zur Selbstkritik nicht Schritt gehalten. Auf der Notenskala: austeilen 6, einstecken 3.
Das ist kein Aufruf zum Bürgerkrieg. Aber geraten wird doch zu etwas mehr Gelassenheit in der vielleicht rauer gewordenen Debattenlandschaft.
«Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des Journalismus, dass Selbstkritik nicht seine stärkste Seite ist. Obwohl wir Journalisten gerne alle andern kritisieren», schreibt Markus Wiegand, «bewegt sich die Fähigkeit, den Medienzirkus selbst zu reflektieren, auf dem intellektuellen Niveau eines Faultiers.» (Jornalist:in, 01/2023)
Auf dem übersichtlichen Platz Basel kommt noch die Scheu der Medien hinzu, sich gegenseitig zu kritisieren. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Oder eben: konform, uniform, chloroform. Es wäre aber wichtig, dass Medien auch Medien kritisieren, über ihre Fehler und Versäumnisse berichten. Dieser Grundsatz ist alt. Mitten im 2. Weltkrieg, entnehme ich der Süddeutschen Zeitung (28.4.2023), gaben Time und die Encyclopedia Britannica 200’000 Dollar aus, um den Zustand der Presse zu untersuchen. 1946 hiess es dann im Bericht:
«Wir empfehlen, dass die Angehörigen der Presse, sich in intensiver gegenseitiger Kritik üben. Ein hoher professioneller Standard wird kaum erreicht werden, solange die Fehler und Irrtümer, die Betrügereien und Verbrechen einzelner Pressevertreter von anderen Mitgliedern des Berufsstandes schweigend übergangen werden. Wenn die Presse rechenschaftspflichtig sein soll – und das muss sie sein, wenn sie weiterhin frei bleiben soll – müssen sich ihre Mitglieder gegenseitig mit dem einzigen Mittel disziplinieren, welches ihnen zur Verfügung steht, nämlich der öffentlichen Kritik.»
Es ist offensichtlich. Politiker und Journalisten pflegen dieselbe Lieblingspflanze: die Mimosa pudica, auch Schamhafte Sinnpflanze genannt. Diese reagiert auf mechanische Reize mit dem Einklappen ihrer Blätter. Analog den beleidigten Leberwürsten, die sich in Redaktionsstuben, Parlamenten und Regierungen breit gemacht haben.
Das ist kein Aufruf zum Bürgerkrieg. Aber gelangen wird doch zu etwas mehr Gelassenheit in der vielleicht rauer gewordenen Debattenlandschaft. Auf unbequeme Inhalte, auch wenn sie dem Zeitgeist der eigenen Blase widersprechen – ironisch, polemisch, zugespitzt, pointiert, schwarzhumorig oder provokant geäussert –, nicht immer reflexartig reagieren mit heftigster Empörung, drastischen Diskriminierungsvorwürfen oder pauschalen Anschuldigungen.
Wer aber die Hitze nicht erträgt, muss dann halt die Küche meiden.
Dieser Artikel erschien zuerst im bajour.ch