
Die Harmos-Bildungsgeschichte kann noch um einen sehr realitätsnahen Treppenwitz erweitert werden. So wollte um die Jahrtausendwende der Zürcher Bildungsdirektor Ernst Buschor mit seinem Flair für den angloamerikanischen Zeitgeist das Primarschulfranzösisch durch immersiv vermitteltes Frühenglisch ersetzen. Die Proteste aus der Romandie hielten ihn aber nicht davon ab, das wichtige Englischprojekt umzusetzen. Vielmehr sollten im Kanton Zürich nun beide Fremdsprachen bereits in der Primarschule in gestaffelter Reihenfolge eingeführt werden.
Die Begeisterung fürs Englisch und die politische Konzession ans Französisch führten dazu, dass plötzlich die unsinnige Didaktik einer schulischen Dreisprachigkeit in der Mittelstufe salonfähig wurde. Seriöse Sprachwissenschafter warnten zwar vor einem Irrweg, doch die Pädagogischen Hochschulen versprachen mit spielerischen Methoden und sensationellen neuen Lehrmitteln einen garantierten Erfolg. Die Euphorie weckte die hohe Erwartung in der Bevölkerung, dass fast jedes Kind mit Leichtigkeit früh drei Sprachen lernen werde.
Man indoktrinierte unerfahrene Lehrpersonen mit höchst umstrittenen Lehrmethoden und lehnte einen klar strukturierten Sprachenunterricht ab.
Eine von den Zürcher Lehrerverbänden unterstützte Volksinitiative, welche eine einzige Fremdsprache an der Primarschule vorsah, hatte in dieser aufgeheizten Stimmung einen schweren Stand. Als Bundesrat Berset ankündigte, dass im Falle einer Annahme der Initiative das beliebte Englisch gestrichen werden müsste, war die Sache entschieden. Die Abstimmung wurde verloren und zementierte so die Dreisprachigkeit an der Zürcher Primarschule. Nachdem auch in anderen Kantonen ähnliche Volksinitiativen ohne Chancen waren, konnte die EDK ihr fragwürdiges Mehrsprachenkonzept fast widerstandslos durchsetzen.

Im Kanton Zürich war der Aufwand zur Entwicklung der Lehrmittel und für die Ausbildung der Primarlehrkräfte im Englisch gewaltig. Die Pädagogische Hochschule Zürich versuchte sich als ein führendes Zentrum für moderne Sprachendidaktik im europäischen Bildungswettbewerb zu positionieren. Man indoktrinierte unerfahrene Lehrpersonen mit höchst umstrittenen Lehrmethoden und lehnte einen klar strukturierten Sprachenunterricht ab. Das Schwergewicht in den Fachdidaktiken der Lehrerbildung verschob sich zum Englisch, welches auf Kosten anderer Bildungsbereiche sehr viel Ausbildungszeit verschlang. Die für die Deutschförderung so wichtigen Realienfächer zählten zu den Verlierern. Für den arg zusammengestrichenen Geschichtsunterricht fehlte ein überzeugendes Konzept und die unterdessen wieder aufgewerteten Naturwissenschaften führten ein Mauerblümchendasein.
Man redete sich heraus und liess die unangenehmen Studien in den tiefsten Schubladen verschwinden.
In der Schulpraxis zeigte das überladene Sprachenkonzept schon bald seine unerfreulichen Auswirkungen. Statt besserer kommunikativer Fähigkeiten machte sich Hektik und Oberflächlichkeit im Unterricht der Mittelstufe breit. Wie mehrere bekannte Studien aufdeckten, waren die Kenntnisse im Französisch bei den meisten Schülern am Ende der Primarschulzeit rudimentär und im Deutsch stellte man erhebliche Mängel bei den Grundlagen fest. Spätestens nach den ernüchternden Resultaten der offiziellen Zentralschweizer Studie zur Bilanz des frühen Französischunterrichts und dem Absturz eines Fünftels unserer Schulabgänger beim nationalen Vergleichstest im Deutsch hätten bei den Bildungsdirektionen die Alarmglocken läuten müssen. Doch die vielgerühmte Bildungssteuerung versagte kläglich. Man redete sich heraus und liess die unangenehmen Studien in den tiefsten Schubladen verschwinden.
Das überladene Sprachenkonzept ist uns in jeder Hinsicht teuer zu stehen gekommen. Der neue Lehrplan platzt aus allen Nähten, die Freude am Sprachenlernen hat bei vielen Kindern abgenommen, die aufsummierten Kosten für den frühen Fremdsprachenunterricht sind enorm und die angestrebte Harmonisierung der Bildung bleibt ein nicht eingelöstes Versprechen. Ein Weiterwursteln mit noch mehr finanziellen Mitteln hilft nicht weiter. Die Bildungspolitik muss jetzt endlich über die Bücher und den Mut aufbringen, das gescheiterte Dreisprachenkonzept der Primarschule zu ändern.






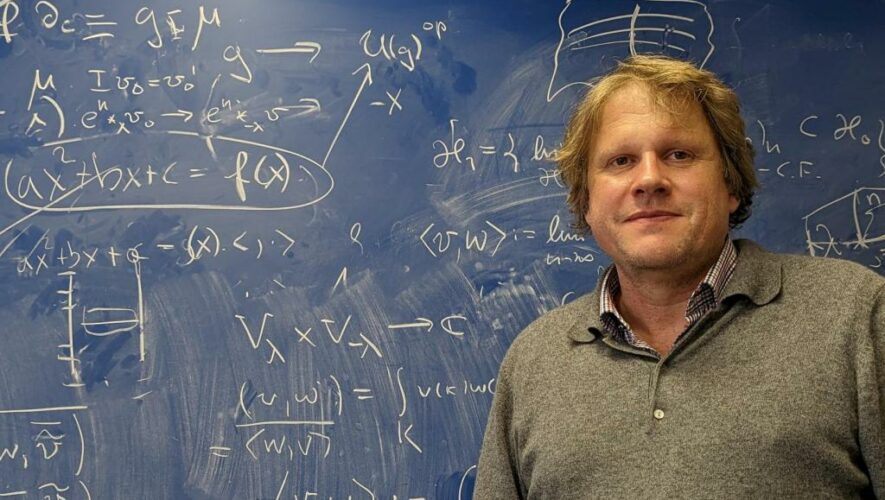
Skandinavier und Holländer können im Vergleich deutlich besser Englisch als Schweizer. Weshalb wohl? Die Sprachenlastigkeit in den Schweizer Schulen ist kein Segen und übertreibt zudem den Bildungsvorsprung der Mädchen.