
Marc Bourgeois, am Wochenende stimmen die Zürcher über eine Tagesschule ab, die jährlich entweder 75 oder 126 Millionen Franken kosten soll. Ob das bisherige Angebot mit privaten Horts oder Mittagstischen genügt, steht eigentlich gar nicht mehr zur Debatte. Sind selbst die Bürgerlichen inzwischen auch für mehr Staat in der Bildung?
Marc Bourgeois: Gegen eine schlanke Tagesschule mit dem Ziel, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen, spricht nichts. Ich stelle aber ernüchtert fest, dass jene Kreise Oberhand gewinnen, welche die Eltern gleichzeitig von jeder Verantwortung entbinden wollen. Dies unter dem Vorwand der «Chancengerechtigkeit». In Wirklichkeit dürfte es diesen Kreisen, zu denen an vorderster Front Gewerkschaften gehören, schlicht darum gehen, noch mehr Stellen zu schaffen. Man muss schon froh sein, dass die Tagesschule noch freiwillig ist. Mit Betonung auf «noch».
In Zürich soll die Widerspruchslösung zum Tragen kommen: Man muss das Kind abmelden, wenn man es nicht in die Tagesschule schicken will. Die Freiwilligkeit ist doch gegeben?
In der Verordnung, ja – obwohl ich bezweifle, dass einen der Staat zu einem freiwilligen, kostenpflichtigen Angebot zwingen kann, wenn man sich nicht Monate zuvor abgemeldet hat. Das ist schlimmer als jede Abo-Falle. Dass es mit der Freiwilligkeit aber nicht weit her ist, erkennt man im Evaluationsbericht zu den Tagesschulen. Dort heisst es, das Ziel, 90 Prozent der Primarschüler und 75 Prozent der Oberstufenschüler an die Tagesschulen zu bringen, sei noch nicht erreicht worden. Die Politik hat aber nie ein solches Mengenziel festgelegt; das wurde einfach von der Verwaltung bestimmt.

Erreicht werden soll dieses Ziel durch unsanften Druck: Wer sein Kind nur an einem Tag in der Schule lässt, bezahlt oft mehr als jene, welche sich für die Tagesschule entscheiden und ihr Kind an allen Tagen mit Nachmittagsunterricht in der Schule lassen. Zudem droht mit einer Verwischung der Grenzen zwischen Bildung und Betreuung auch eine pädagogische Benachteiligung der abgemeldeten Kinder, und sie drohen zu Aussenseitern zu werden. Von Freiwilligkeit würde ich da nicht mehr sprechen.
Bloss ein Systemfehler?
Das Ganze ist zunächst gut gemeint, aber dahinter steckt der sozialistische Gedanke der Gleichschaltung. Mir ist klar, geworden, dass das genau der Effekt ist, den sich linke Kreise herbeiwünschen: Ihnen ist es egal, ob Eltern arbeiten gehen oder zuhause bleiben. Im Vordergrund stehen mehr staatliche Arbeitsplätze und ein ausgedehnter Einfluss auf die Kinder. Auch wenn solche Vergleiche schwierig sind: Es ist kein Zufall, dass gerade in der DDR unfreiwillige Tagesschulen – teils sogar «Wochenschulen» – einen Höhepunkt erlebten. Der Einfluss des Staates auf die Denkhaltung der Kinder war so riesig. Dass dieser Stempel auch politisch gefärbt ist, dürfte jedem klar sein; Stichwort Linksdrall an Schulen.
Immer mehr Kinder von bildungsnahen Familien ergänzen die Volksschulbildung durch zusätzliche Angebote. Sie trauen der Volksschule nicht mehr.
Man will allen Kindern dieselben Startchancen geben. Das klingt doch auch für die FDP verlockend?
Chancengerechtigkeit ist ein urliberales Anliegen. Aber kein Politikbereich ist so unehrlich wie die Bildungspolitik. Es geht um Kinder, da wird mit Emotionen gelogen, dass sich die Balken biegen. So werden als gute Gründe für steigende Ausgaben stets «Chancengerechtigkeit», «Bildungsqualität» und «Vereinbarkeit von Familie und Beruf angegeben». Die wahren Gründe: Bildungspersonalpolitik statt Bildungspolitik, Abschottung des Berufsstandes und Vereinnahmung der Kinder.
Wer sicher profitiert hat, ist der aufgeblähte Personaletat.
Gerade in der Bildung braucht es Mut, sich gegen Forderungen aus dem Bildungskuchen zu stemmen. Denn wir reden vermeintlich von Geldern, die den Kindern zugutekommen. Gibt es aber Hinweise darauf, dass die Bildung durch all die teuren Reformen besser geworden ist? Oder chancengerechter? Wenn es Indizien gibt, dann deuten sie in die gegenteilige Richtung. Immer mehr Kinder von bildungsnahen Familien ergänzen die Volksschulbildung durch zusätzliche Angebote. Sie trauen der Volksschule nicht mehr. Und die einzigen einigermassen objektiven Zeitreihen, die Pisa-Daten, zeigen seit der Einführung der schulischen Integration nur nach unten.
Man hat Unsummen darin investiert; die Bildung ist dabei weder besser, noch gerechter geworden. Cui bono, fragt man sich da. Nun, wer sicher profitiert hat, ist der aufgeblähte Personaletat. Was die Betroffenen dabei vergessen: Je mehr Geld in diesem System unnütz versickert, desto weniger steht letztlich für Bildung zur Verfügung, und desto höher wird der Kostendruck auf die einzelne Stelle.
Sie können aus einer schwachen Schülerin keine Raketenwissenschafterin machen. Aber aus einer möglichen Raketenwissenschafterin sehr wohl eine schwache Schülerin.
Was ist an «gleichen Startchancen»schlecht?
Wenn alle nicht nur die gleichen Chancen haben sollen, sondern auch dieselben Resultate erreichen sollen, oder dank einer Abschaffung von Noten gar keine messbaren Resultate erreichen sollen, dann kann das Niveau nur sinken. Sie können aus einer schwachen Schülerin keine Raketenwissenschafterin machen. Aber aus einer möglichen Raketenwissenschafterin sehr wohl eine schwache Schülerin. Und genau das passiert gegenwärtig im schulischen Integrationsmodell – bei der Integration von stark verhaltensauffälligen und extrem leistungsschwachen Kindern in die Regelklassen. Weil dies eine Lehrperson alleine nicht stemmen kann, stellt man einfach weitere Förderlehrpersonen und Assistenzen ins Klassenzimmer. Mit der Folge, dass oftmals Bahnhofsstimmung und ein Kommen und Gehen herrscht. Von den Kostenfolgen ganz zu schweigen. Leider schwappt dieser Trend der Gleichmacherei allmählich auch auf den vorschulischen Bereich über.
Wie kommen Sie darauf, schon von einer vorschulischen Nivellierung zu sprechen?
Zuerst hat man den früher freiwilligen Kindergarten für obligatorisch erklärt. Kindergärtner werden an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet, der Kindergarten wird von einem Lehrplan gesteuert. Dann hat man das Eintrittsalter in den Kindergarten gesenkt. Jetzt bestehen Bestrebungen, auch vorschulische Angebote für bildungsferne Kinder verpflichtend zu machen. Es ist absehbar, dass man zwecks einer guten «Durchmischung» früher oder später auch bildungsnahe Kinder zu solchen Angeboten verpflichten will. Die Kinder werden immer früher der Verantwortung der Eltern entzogen, weil sonst gewisse Kinder einen Startvorteil haben könnten. Aber hilft man den schwachen Kindern wirklich, wenn man die stärkeren ihrer Vorteile beraubt?
Haben Sie den Kindergarten als bereits verschult erlebt, oder durften Ihre Kinder noch spielen?
Wir haben ihn nicht als verschult erlebt. Das liegt daran, dass die Kindergartenlehrpersonen heute meist noch nach gewohntem Muster die Kinder befähigen, die Welt besser zu verstehen. Der Lehrplan wird da meist links liegen gelassen. Aber das ändert sich langsam. Obwohl das Volk Nein zur Grundstufe gesagt hat, bildet man die Kindergartenlehrpersonen demnächst gleich aus wie die Primarlehrpersonen. Das wird Folgen haben.
Seit wann hat die Schule Ihrer Ansicht nach Schlagseite erhalten?
Eine wesentliche Zäsur war der Entscheid für das schulische Integrationsmodell, das vor gut zehn Jahren eingeführt wurde. Seit dieser Zeit ist die Schweiz im internationalen Vergleich konstant zurückgefallen, wie die Pisa-Studien ergeben haben, und zwar in allen Disziplinen. Nicht wenige Lehrmeister bestätigen dieses Bild: Viele Schulabgänger erreichen nicht einmal mehr die tief angesetzten Mindestanforderungen. Ich habe selber fast 20 Jahre lang in meinem IT-Betrieb Lehrlinge ausgebildet. Seit diesem Herbst verzichte ich darauf. Die Vorkenntnisse sind ungenügend, und der Betreuungsaufwand steigt immer mehr.
Da wird schon in frühen Klassen von Selbstkompetenz gesprochen, von Lerninseln, von Eigenverantwortung und von selbstgesteuertem Lernen. Ich spüre den Effekt nicht.
Viele Berufsbildungsleute – die in der Mehrheit bürgerlich gesinnt sind – sprechen aber von einer kompetenten Jugend. Sie könnten vielleicht nicht mehr so gut schreiben, seien aber enorm anpassungsfähig und wüssten sich zu helfen. Was sagen Sie dazu?
Es ist möglich, dass sich die Flexibilität erhöht hat. Aber was nützt Anpassungsfähigkeit im Betrieb, wenn ein Lernender sprachlich so schwach ist, dass er kein einziges Mail richtig beantworten kann? Da wird schon in frühen Klassen von Selbstkompetenz gesprochen, von Lerninseln, von Eigenverantwortung und von selbstgesteuertem Lernen. Ich spüre den Effekt nicht. Ich bin schon froh, wenn ein Lernender überhaupt auf ein dringendes Mail eines Kunden reagiert.

Die Meinung der Bildungsexperten lautet, dass die Anforderungen an die Schüler stetig gestiegen sind, dass der Druck zugenommen hat und die Bildung ein hohes Niveau hat.
Das stimmt wohl. Man will tendenziell zu viel. Und vernachlässigt dadurch das Wesentliche: Das Lesen, Schreiben und die Mathematik, ein Grundstock an Allgemeinbildung und wohl eine Fremdsprache. Das hat teils mit dem überfrachteten Lehrplan 21 zu tun. Die Lehrpersonen müssen von Thema zu Thema hetzen. Das Motto der Grundschule scheint auch zu lauten: Übe keinen Druck aus, mache keinen Frontalunterricht, keine vertieften Repetitionsphasen, einfach nichts, was nach Drill und Druck klingt und gewisse Kinder aus der Komfortzone katapultieren könnte. Ich sehe das bei unseren Kindern: Die Themen werden kurz gestreift. Zwei Jahre später auf höherem Niveau. In der Zwischenzeit haben sie alles vergessen, weil sich der Stoff nie setzen konnte. Ergänzend hinzu kommt die Tendenz, keine Hausaufgaben mehr zu erteilen. Das wirklich selbständige Üben in Ruhe geht so verloren.
Was sind die Gründe?
Der «gute» Grund? Einmal mehr die Chancengerechtigkeit. Weil nicht alle Kinder zuhause Unterstützung erhalten, soll kein Kind Unterstützung erhalten. Auch dies eine Nivellierung nach unten. Der wahre Grund? Es ist natürlich angenehmer, keine Hausaufgaben korrigieren zu müssen. Ohne Hausaufgaben verlieren jene Eltern, die das wünschen, aber auch den Draht zur Schule. Das versucht man dann mit aufwändigen Konstrukten wie nichtssagenden «Zeigehefte» wettzumachen. Bildungsnahe Eltern machen es auf ihre eigene Weise wett: Sie senden ihre Zöglinge lange vor dem Übertritt in die Oberstufe scharenweise in den Privatunterricht. Oder man gibt den Kindern zuhause Zusatzaufgaben.
Nun gibt es aber auch neue Einsichten und Studien, die belegen, dass die Einführung von Frühfranzösisch falsch war oder dass das Integrationsmodell die Normalklasse zu stark belastet. Doch korrigiert wird nicht auf das nächste Semester. Warum nicht?
Das kann ich nur für den Kanton Zürich beantworten. Der Prozess verläuft träge: Verschiedene Bildungsinstitute erhalten den Auftrag, Erhebungen zu machen. Das dauert, zwei, drei Jahre. Dann erklärt die Verwaltung, sie müssten erst mal die Grundlagen für einen Entscheid erarbeiten. Zwei, drei Jahren später kommt das Geschäft endlich ins Parlament und kann politisch diskutiert werden. Natürlich ist es komplex, wenn ein Bildungsdampfer wie der Kanton Zürich an einer Stellschraube etwas ändert; es könnte beispielsweise plötzlich zu einem Mangel oder einem Überfluss an Personal führen, zu ungeeignet qualifiziertem Personal oder unpassenden Schulhäusern. Was mir bei diesen Prozessen aufgefallen ist: Wir haben nie Bildungspolitik gemacht. Sondern Bildungspersonalpolitik betrieben.
Erklären Sie.
In jedem parlamentarischen Geschäft geht es im Kern immer ums Personal, nie um die Qualität. Ein aktuelles Beispiel zum Thema Lehrpersonenmangel: Im Kanton Zürich verdienen die Primarlehrer 25 Prozent mehr als im Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone. Allen ist bewusst, dass das Lohnniveau nicht Auslöser des Mangels ist. Im Gegenteil: Noch höhere Löhne könnten zu noch tieferen Pensen führen. Nun heisst es, man müsse am sogenannten Lektionenfaktor schrauben, damit die Lehrer entlastet würden. Der Lektionenfaktor ist die Massgabe für den Jahresaufwand einer einzelnen Wochenlektion. Daran etwas zu ändern, ist nichts anderes als eine versteckte Formulierung, die Löhne zu erhöhen. Und wenn heute von einer Flötenlehrerin, die Sechsjährige unterrichtet, verlangt wird, sie müsse dafür über ein Studium verfügen, denn geht es um eine klassische Marktabschottung, und zugleich um Arbeitsbeschaffung für FHs.
Wie lässt sich dann die Bildungsqualität steigern, ohne einfach neue Finanzmittel einzuschiessen?
Die erste, wichtigste Massnahme wäre, wieder mehr Ruhe und Kontinuität in die Klassenzimmer und den Schulbetrieb zu bringen und die Anzahl Bezugspersonen pro Kind zu reduzieren. Das bedingt Anpassungen am integrativen Schulmodell.
Das ist eine Absage an die integrative Klasse.
Zumindest in der heutigen Form. Man muss schon sehr angestrengt wegschauen, um so zu tun, also ob das heutige System funktioniere. Einfach immer noch mehr Mittel ins System zu kippen und noch mehr Personal ins Klassenzimmer zu stellen kann nicht die Lösung sein. Der gutgemeinte Gedanke bei ihrer Einführung war, Kinder sozial nicht zu isolieren. Man tut dabei so, als ob sich die Kinder nicht begegnen würden, wenn sie nicht in derselben Klasse sitzen. Das ist aber falsch. Heute wird Integration in der Klasse zum Schein ausgelebt. Da sitzen die Sonderpädagogen hinter den verhaltensauffälligen Kindern und betreuen sie separat. Die Kinder sind so besonders stigmatisiert, vor dem Hintergrund, dass allen klar ist, wer «blöd» ist und den Unterricht ständig stört. Das führt auch zu absurden Effekten: Die Eltern begabter Kinder argumentieren, dass ihr Kind mehr verdient habe, als im täglichen Chaos einer integrativen Klasse unterrichtet zu werden. Die Folge ist: Sehr schwache und stark verhaltensauffällige Kinder werden integriert, leistungsstarke wiederum in Förderprogrammen separiert. Verlierer im System sind die durchschnittlichen Kinder. Sie erhalten zu wenig Aufmerksamkeit.
Zurück zur Steigerung der Bildungsqualität, ohne höheren Aufwand zu generieren:
Es braucht wohl auch eine Verschlankung des Lehrplans. Er soll sich vermehrt an den für alle Berufe zwingenden Grundkompetenzen orientieren: Mathe, Deutsch, Lesen, Allgemeinbildung, vielleicht nur eine Fremdsprache. Dann kann der Unterricht auch wieder aus einer Hand geführt werden. Obwohl die Lehrmittel besser geworden sind, können die Lehrpersonen heute immer weniger Fächer abdecken. Der Optimalfall ist für mich ganz klar, wenn eine Lehrperson in der Primarschule eine Klasse eigenverantwortlich führen kann, getreu nach dem Motto: ein Raum, eine Chefin oder ein Chef. Jede zusätzliche Person schafft neue Schnittstellen und Koordinationsaufwand. Im Team ist dann niemand mehr wirklich für das Weiterkommen des Kindes persönlich verantwortlich.
Eine Schule ohne Leistungsmessung spiegelt den Kindern nicht nur eine Welt vor, in der Leistung nicht zählt, sondern ist auch eine Missachtung der Leistung der Kinder.
Schliesslich setzte ich mich für eine schlanke, wenig aufwändige Leistungsmessung ein: die Noten. Kompetenzorientierter Unterricht ist nicht falsch, aber man kann nicht Dutzende Kompetenzen pro Kind messen. Eine Parlamentsmehrheit im Kanton Zürich hat kürzlich im Gesetz festgehalten, dass es Semesternoten geben muss. Eine Schule ohne Leistungsmessung spiegelt den Kindern nicht nur eine Welt vor, in der Leistung nicht zählt, sondern ist auch eine Missachtung der Leistung der Kinder. Noten sind nicht perfekt. Aber sie sind besser als keine Noten.
Die Ratslinke hat zwar beteuert, man wolle die Noten nicht abschaffen, nur um dann im nächsten Satz zu sagen, dass Noten überflüssig seien. Genau deshalb hat der Kantonsrat hier präventiv eine Notenpflicht eingeführt.
Der Trend geht in Richtung «keine Noten».
Ja, Kreise um das Institut für Erziehungswissenschaften an der Uni Zürich geben Bücher heraus wie «Schule ohne Noten». Folgt man diesen Personen in den sozialen Medien, so erkennt man rasch, wie radikal links sie ticken. Neben diesem Institut führt die Uni auch das Institut für Bildungsevaluation; Bildungsforschung betreibt auch die Pädagogische Hochschule, ebenso die ETH. Und alle müssen immer neue Ansätze, neue Reformen erfinden. Sie würden sich sonst als überflüssig erweisen. Das wäre das Schlimmste für die Bildungsindustrie. Dabei bräuchte die Volksschule vor allem etwas: endlich einen Reformstopp.
Das sind viele Akteure, die sich für die Staatsschule einsetzen. Liegt eine Lösung darin, die Konkurrenz, die Privatschulen, zu stärken?
Das ist eine Entwicklung, die abzusehen ist: Viele Reiche kaufen sich bereits jetzt aus der Volksschule heraus und lassen ihren Nachwuchs an Privatschulen ausbilden. Am Zürichberg besucht jedes sechste Kind eine Privatschule. Und dort, wo ein solcher Entscheid folgerichtiger wäre, aber das Portemonnaie dünner ist, nämlich in Schwamendingen, sind es weniger als drei Prozent. Da sich nicht beliebig viele Eltern Privatschulen leisten können, erfolgt die Privatisierung der Bildung unsichtbar, indem Kinder bildungsnaher Eltern neben der Volksschule gefördert werden. Insgesamt ist das ein unerfreulicher Trend, der genau das Gegenteil der angestrebten Chancengerechtigkeit erreicht, und an angloamerikanische Verhältnisse erinnert, wo Geld über Bildung entscheidet. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen.
Können Sie das Ruder mit Ihrer Partei herumreissen?
Die FDP im Kanton Zürich begleitet die sich jagenden Reformen kritisch. Aber ganz ehrlich? Man kann schon den Glauben verlieren. Die Personallobbys rund um den Bildungsbereich sitzen einfach am längeren Hebel. Zeit für die Bürgerlichen, sich wieder vermehrt um dieses Thema zu kümmern.






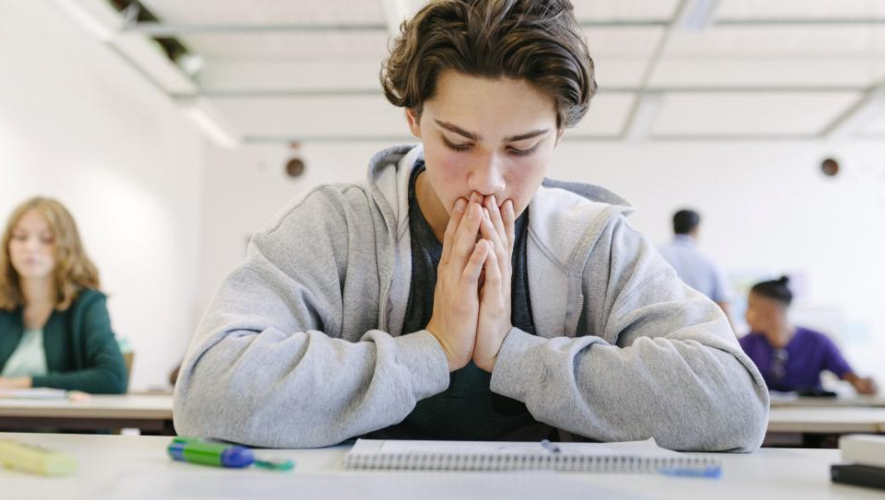
Pädogen sind weder verantwortlich für die andauernden Schulreformen, noch machen sie Bildungspolitik.
Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten mit Schülerinnen und Schülern unterrichtend an der Front und sind in erster Linie LEIDTRAGENDE der verfehlten Bildungspolitik der letzten 20 Jahre.
Aber dass Bildungspolitik in jeder Hinsicht unehrlich ist – diesen Satz unterschreibe ich sofort und mit Nachdruck.
Lieber Herr Vuilliomenet, so wollte ich auch nicht verstanden sein. Es gibt in der Tat immer mehr mutige Lehrpersonen, die auf Fehlentwicklungen hinweisen. Auf den ersten Blick gegen ihre eigenen Interessen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Meine Frau gehört bekanntlich auch zu dieser Sorte. Momentan haben die gewerkschaftlich orientierten Lehrpersonalverbände aber weit mehr Gewicht in der Politik. Unsere Bildungsdirektorin im Kanton Zürich bewegt nichts – ausser gewerkschaftliche Forderungen zu erfüllen. Und ja, ich halte es für hochgradig unethisch, wenn man die Zukunft der Kinder auf dem Altar der Gewerkschaften opfert. Ich will gute und faire Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen, weil davon auch die Kinder profitieren. Aber ich will keine Stellenexplosion. Denn die hilft auch dem bestehenden Lehrkörper nicht. Sie hilft nur der Mitgliederstatistik der Gewerkschaften.
Die Stimmbürger des Kantons Zürich haben im kommenden Frühjahr die Freiheit, die Bildungsdirektorin, die nichts bewegt, abzuwählen. Hoffentlich nehmen sie diese Chance auch wahr.
Das sind interessante Töne aus dem Munde eines FDP-Politikers. Trotzdem bleibe ich bei meiner Feststellung, dass die FDP auch einiges gut zu machen hat. Hat sie doch in der Vergangenheit fast alle dieser umstrittenen Reformen unterstützt: HarmoS, Integrationsartikel, Frühenglisch, Lehrplan 21, Kompetenzorientierung u.v.m.
Und ich nehme an, dass auch der Fall Rodriguez mit der unverschämten Entlöhnung den FDP-Parlamentariern bekannt war. Ich bin gespannt, wie sich die neue Haltung der FDP auf die Reformpolitik auswirken wird. An den Taten soll man sie messen.
Marc Bourgeois beweist in seinem Beitrag eine gehörige Portion Mut. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und korrigiert in einigen Bereichen die Bildungspolitik seiner Partei. Mir gefällt sein pragmatischer Ansatz für die Lösung der aktuellen schulischen Herausforderungen. Da sind wir nicht mehr beim kreisenden Adler, der von oben auf das Schulgeschehen herabschaut, sondern begleiten die Frösche unten im Weiher. Und diese Frösche stehen ganz schön unter Druck.
Die Krux ist nur, dass viele Bildungspolitiker kaum bereit sind, den Augen öffnenden Perspektivenwechsel mitzumachen. Es fällt ihnen schwer, eigene Fehler einzugestehen und deutliche Kurskorrekturen in der Bildungspolitik vorzunehmen. Doch diese müssen jetzt vorgenommen werden, um die Belastungen der Lehrkräfte zu reduzieren und die Schule wieder auf Erfolgskurs zu führen. Konkret bedeutet dies, dass das überladene Programm des Lehrplans entschlackt, das Integrationsmodell durch Kleinklassen ergänzt und die Fremdsprachenfrage neu aufgerollt werden.