WELT: Herr Brügelmann, welche Note würden Sie dem deutschen Schulsystem geben?
Hans Brügelmann: Ich finde Noten als Urteile grundsätzlich schwierig. Aber klar ist: Das Bildungssystem wird seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Ein großes Problem ist die Bildungsungerechtigkeit. Wir haben ein sehr normiertes Schulsystem, das keine Rücksicht auf individuelle Lernbiografien nimmt. Allerdings stimmt, dass zu viele junge Menschen in der Schule die grundlegenden Kompetenzen nicht in zureichendem Maße erlernen, auch beim Lesen, Schreiben oder Rechnen.
WELT: Woran liegt das?

Brügelmann: Wir nehmen zu wenig Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen. Schon sechsjährige Schulanfänger unterscheiden sich in allen Kompetenzbereichen um rund drei Entwicklungsjahre. Doch Schule tut meist so, als ob Gleichaltrige zur gleichen Zeit dasselbe lernen könnten.
WELT: Woher kommen diese Unterschiede?
Brügelmann: Das hat zum Teil mit Begabung zu tun, vor allem aber mit den sozialen Milieus, aus denen die Kinder kommen. Haben sie Sprachvorbilder, um einen breiten Wortschatz zu entwickeln? Machen ihre Eltern Würfelspiele mit ihnen? Manche Kinder haben mit fünf Jahren ein großes Interesse für Schrift und Zahlen und erwerben schon wichtige Teilkompetenzen, andere wissen nicht, was Buchstaben sind. Der soziale Hintergrund prägt sie, auch eine mögliche Migrationsgeschichte. Diese Erfahrungen lassen sich nicht in wenigen Monaten aus- und angleichen.
WELT: Junge Menschen empfinden großen Stress, das zeigen aktuelle Erhebungen. Wird die Schule dem gerecht?
Brügelmann: Ob der Stress wirklich zugenommen hat, weiß ich nicht. Aber in der Gesellschaft wächst generell die Bereitschaft, psychische Belastungen ernst zu nehmen, anders als in früheren Zeiten. Auch der Blick auf die Schule verändert sich. Früher ging es darum, dass die ältere Generation ihr Wissen an die jüngere weitergibt. Dass diese die Werte und Vorstellungen, wie Gesellschaft gestaltet wird, übernehmen. Heute wird jedoch überall mehr Beteiligung und Mitwirkung gefordert, etwa flachere Hierarchien in Unternehmen.

Auch Schule kann mit Belehrung von oben nach unten nicht mehr funktionieren. Viele Kinder und Jugendliche erleben im Alltag einen Widerspruch zur Forderung, sich demokratisch zu engagieren. Daran ändern auch Formate wie Schülervertretungen nichts Grundlegendes, wenn zum Beispiel Unterrichtsinhalte nicht mitbestimmt werden können. In den Schulen erleben junge Menschen sich als von Fremdanforderungen und Fremdurteilen abhängig.
WELT: Florian Fabricius von der Bundesschülerkonferenz führt den Stress auch auf Leistungsdruck in der Schule zurück – und fordert, erst ab der Oberstufe zu benoten. Wie bewerten Sie das?
Brügelmann: Die Abhängigkeit von Noten ist in der Tat ein Problem. Zwar beanspruchen sie, objektiv, präzise und vergleichbar zu sein. Aber jeder von uns kennt die Situation: Es gibt einen Lehrerwechsel, und die Noten in der Klasse verändern sich. Einfach, weil der neue Lehrer andere Kriterien für seine Bewertung anlegt oder anders gewichtet. Noten entstehen zudem im Kontext der jeweiligen Klasse. In einer schwächeren Klasse werden identische Leistungen oft besser bewertet als in einer starken Klasse.
Hinter der gleichen Note können ganz unterschiedliche persönliche Leistungen stecken.
Und noch einmal zu den verschiedenen Voraussetzungen: Wenn zwei Schülerinnen in einer Mathearbeit dieselbe Fehlerzahl haben, sagt das nicht viel aus. Wir sehen nicht, was Einzelne aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, welche Anstrengungsbereitschaft gezeigt wurde, wie das Potenzial ausgeschöpft wurde. Hinter der gleichen Note können also ganz unterschiedliche persönliche Leistungen stecken, die im bloßen Ergebnisvergleich verschwinden.
WELT: Nun ist eine schriftliche Mathearbeit aber doch sehr klar: Es gibt richtig und falsch. Ist das nicht die objektivste Form der Bewertung von Leistung?
Brügelmann: Die Frage ist, was Sie bewerten wollen: Einen Schüler im Vergleich mit anderen im Hinblick auf das Produkt, das am Ende rauskommt? Oder die Entwicklung eines Schülers.

Nehmen Sie ein Migrantenkind, das vor zwei Jahren nach Deutschland kam und in dieser Zeit sprachlich große Fortschritte gemacht hat. Im Vergleich dazu: Ein Schüler aus einem akademischen Haushalt, der sprachbegabt und familiär gefördert ist, aber eine schlampige Arbeit geschrieben hat. Beide könnten die gleiche Note für ihre Arbeit bekommen – aber die sagt nichts darüber aus, wie sie ihr jeweiliges Potenzial ausgeschöpft haben.
WELT: Spätestens bei einer Bewerbung an Universitäten oder bei Unternehmen wird aber doch eine Form der Vergleichbarkeit benötigt.
Brügelmann: Die Abiturnote sagt doch nicht viel darüber aus, ob sich jemand zum Beispiel für ein Medizinstudium eignet. Zu einem guten Mediziner gehören auch soziale Kompetenzen. Vielmehr müssten intensive Bewerbungsgespräche geführt werden, wie etwa in Finnland beim Lehramtsstudium. Von Unternehmen wissen wir schon lange, dass viele die Aussagekraft der Noten sehr gering einschätzen – und lieber eigene Einstellungsverfahren entwickeln. Die knappen Kapazitäten an Hochschulen sind allerdings ein Problem und erschweren andere Formen der Auswahl.
WELT: Und wie sieht Ihre Alternative zur Note aus?
Brügelmann: Schüler sollten mit ihren Lehrern gemeinsam konkrete Arbeitspläne vereinbaren, die regelmäßig miteinander besprochen werden: Was wurde erreicht? Wo gibt es Schwierigkeiten? Das ermöglicht, Schüler nicht zum gleichen Termin an gleichen Anforderungen zu messen, sondern ihre unterschiedlichen Lernwege zu berücksichtigen. Beim Pkw-Führerschein läuft es doch auch so: Es gibt zwar klare Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Doch niemand erwartet, dass 20 Schüler den Führerscheinkurs gleichzeitig beginnen und gleichzeitig die Prüfung bestehen.
Wir brauchen also förderorientierte Rückmeldungen statt der verbreiteten Fixierung auf Selektion.
Und noch eins: Viele Schulen haben jetzt schon statt Noten differenzierte Kompetenzraster: Lernziele aus dem Lehrplan, die in konkrete Beschreibungen von Leistungen übersetzt wurden. Darauf aufbauend werden Rückmeldegespräche zwischen Lehrkraft, Schülerin und Eltern geführt. Wo stand die Schülerin noch vor einem halben Jahr? Welche Fortschritte wurden gemacht? Welche Unterstützung ist erforderlich, um die nächsten Ziele zu erreichen? Wir brauchen also förderorientierte Rückmeldungen statt der verbreiteten Fixierung auf Selektion.


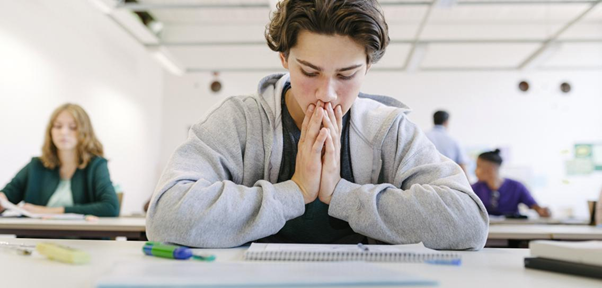




Danke für die klare Stellungnahme. Gerade der Schlussatz “Wir brauchen also förderorientierte Rückmeldungen statt der verbreiteten Fixierung auf Selektion.” stützt klar die Forderung des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, auf die Selektion am Ende der 6. Klasse zu verzichten. Eine föderorientierte Rückmeldekultur ist jedoch nur möglich, wenn die Lehrpersonen dafür auch Ressourcen haben. Eine Veränderung von Unterrichtsdesgins und die Übernahme von (altersgerechter) Verantwortung für das eigene Lernen durch die Schülerinnen und Schüler ist Grundlage dafür.
Auch hier wieder die eierlegende Wollmilchsau. Das Kompetenz-Wirrwarr-Modell war eine Totgeburt. War nach dem Pisa-Desaster immer noch weiter in die falsche Richtung marschiert, hat keinen Millimeter seines Philologie- oder Pädagogikberufes nicht verstanden. Die Kompetenz-Didaktiker sind Paradebeispiele für Verlierer, die jedes Spiel vergeigen und immer noch meinen, sie könnten mit Seifenblasen anstatt Fussbällen eigene Tore erzielen.
Hans Brügelmann meint es sicher gut. Aber wenn ich dieses Interview lese, wird mir klamm ums Herz. Die Schule hat derart viele Probleme – die grösstenteils auf Reformen der letzten Jahre zurückzuführen sind, initiiert von Leuten die an das Gute glauben. Lasst uns zuerst mal sicherstellen, dass die Kinder besser lesen, schreiben, rechnen können. Danach können wir die Perfektionierung weitertreiben und uns sehr, sehr gut überlegen, was den Menschen motiviert, im Leben zu reüssieren.
Fast immer, wenn ich Berichte und Artikel zur Bildung und Schule von Fachpersonen der Fachhochschulen und Universitäten lese, schaue ich im dafür sehr hilfreichen Internet nach, welchen beruflichen Werdegang diese durchlaufen haben, so auch bei Hans Brügelmann. Da liest man auf seiner Homepage: 1966 Abitur – ab 1967 Studien an Unis – 1970 1. jur. Staatsexamen – dann bis 1974 Studium der Erziehungswissenschaften und Graduierung zum Lic. rer. soc. in Erziehungs- und Rechtswissenschaften, darauf Dissertation (1975) – 1980-1993 Professor für Anfangsunterricht (Universität Bremen) – 1993-2012 Professor für Erziehungswissenschaften Grundschulpädagogik/-didaktik (Universität Siegen).
Zwischen 1975-1980 war er auch mal ausserhalb des Elfenbeinturms tätig, so als wiss. Mit-arbeiter am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik (Münster) und – staunt dann doch schon zu der “akademische Regression” (!) – wiss. Mitarbeiter in der Evaluationsgruppe „Einstufige Juristenausbildung Baden-Württemberg“ am Landgericht Konstanz!
Und staunt dann weiter, dass sich im ganzen Currculum Vitae KEINE Ausbildung o.ä. als Lehrer auf irgendeiner Stufe findet.
Solche Fachpersonen nehme ich mal – vielleicht zwar ein Vorurteil – vorerst nicht ernst, wenn sie sich zu Praxisthemen auslassen. Leider gilt diese Feststellung meist auch, wenn Schweizer Bildungsexpertinnen und -experten aus dem tertiären Bereich in Medien zu Problemen in der Volksschule oder der Sek II ihre Meinung über uns “herabschweben” lassen.
Daher unterlasse ich es inhaltlich zum Interview Stellung zu nehmen! Wen es noch interessiert: “Die in den frühen 1980er Jahren einsetzende Reform des Lese- und Schreibunterrichts an den Grundschulen hat Hans Brügelmann nachhaltig beeinflusst, unter anderem mit seinen mehrfach aufgelegten Büchern Kinder auf dem Weg zur Schrift (9. Auflage. 2013) und Die Schrift erfinden, in denen er sich mit dem Spracherfahrungsansatz für eigenständige Zugänge der Kinder zum Lesen und Schreiben und eine stärkere Fehlertoleranz eingesetzt hat.” (https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Br%C3%BCgelmann ) Jürgen Reichen und “Schreiben nach Gehör” lässt grüssen!
Gerade im Hinblick auf das Zitat aus Wikipedia wäre ja wohl zu fragen, was die dort gemeinten Reformen seit den frühen 1980er Jahren denn nun gebracht haben. Nach 40 Jahren wird man das doch hoffentlich in Umrissen einschätzen können.
In der Bildungsforschung kann man Blödsinn machen, soviel man will: man bleibt Experte für Bildung. Das gilt wohl auch für Herrn Brügelmann:
https://schule-mathematik.blogspot.com/2017/08/grodaz-brugelmann.html
https://schule-mathematik.blogspot.com/2019/11/schreiben-nach-gehor.html