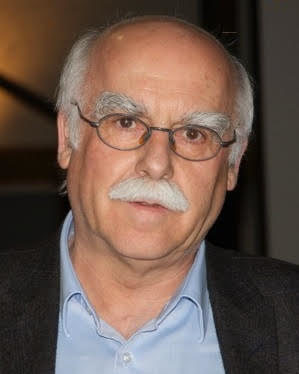Der Versuch, eine Pädagogische Anthropologie als Integrationswissenschaft zu begründen, den Heinrich Roth in den 1960er und 1970er Jahren unternommen hat, ist seit längerem in Misskredit geraten. Angesichts der Vielfalt und Heterogenität der Ergebnisse moderner Human- und Sozialwissenschaften macht es kaum mehr Sinn, sich um ein ganzheitliches Bild des Menschen als Grundlage für Erziehung und Unterricht zu bemühen. Umso erstaunlicher ist, wenn ausgerechnet eine Disziplin, die sich streng wissenschaftlich gibt, von einem «neuen Menschenbild» spricht. Zwar wird hinter das «neue Menschenbild» oft ein Fragezeichen gesetzt, wie bei Wolf Singer (2003) und Gerhard Roth (2008). Was uns die Autoren mitteilen, ist aber sehr wohl im Indikativ gehalten und erhebt den Anspruch, anthropologisch relevant zu sein. In den Worten des Philosophen Thomas Metzinger (2006) bewegen wir uns «auf ein grundlegend neues Verständnis dessen zu, was es heisst, Mensch zu sein» (S. 42).

Aber können wir einem «neuen Menschenbild» zustimmen, das unser gewohntes Selbstverständnis als Menschen radikal in Frage stellt? Die Hirnforschung und die Neurowissenschaften – um diese Disziplinen geht es – nehmen für sich in Anspruch, nicht nur das Bild des Menschen in dramatischer Weise zu verändern, sondern auch die Grundlagen unserer Kultur weitreichend umzugestalten. Dazu gehört, dass dem Menschen der freie Wille und die Entscheidungsfreiheit abgesprochen werden, das Ich zur Illusion erklärt wird und die Prinzipien von Schuld und Sühne ausser Kraft gesetzt werden. Wie zu Zeiten der Hochblüte des Behaviorismus, finden wir uns «Jenseits von Freiheit und Würde» (Skinner) wieder. Der Unterschied zum Behaviorismus liegt einzig darin, dass die Behavioristen die Blackbox Mensch nicht öffnen wollten, weil sie glaubten, psychologische Erklärungen liessen sich auf der Verhaltenseben ausreichend begründen, während die Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler die Blackbox gleichsam im wörtlichen Sinn öffnen, um mittels anspruchsvoller Methoden nachzusehen, wie es im Gehirn des Menschen zu- und hergeht.
Wie aus dem Behaviorismus eine Pädagogik und Didaktik hervorgegangen sind, die auf der Basis einfachster Lernprinzipien Anleitungen zur Gestaltung von Erziehung und Unterricht geben, haben sich aus der Hirnforschung eine Neuropädagogik und eine Neurodidaktik entwickelt, die sich gleichermassen zumuten, der pädagogischen Praxis zu besserer Wirksamkeit und mehr Erfolg zu verhelfen. Besonders weit sind sie dabei allerdings noch nicht gekommen, obwohl seit der Prägung des Begriffs des Neuropädagogen durch Jocelyn Fuller und James Glendening (1985) schon fast 40 Jahre vergangen sind.
Ich setze mich im Folgenden kritisch mit dem Ansinnen auseinander, Pädagogik und Didaktik neurowissenschaftlich zu begründen. Dabei fokussiere ich zwei Themen, nämlich die vermeintliche Illusion der Willensfreiheit als Teil des «neuen Menschenbildes» und die neurowissenschaftlichen Empfehlungen zur Gestaltung von Schule und Unterricht.
Die Willensfreiheit wird als fiktive immaterielle Kraft dargestellt, der die materielle Ordnung der Natur nichts anhaben kann.
Leugnung der Willensfreiheit

In Bezug auf das «neue Menschenbild» scheinen die Neurowissenschaften allerdings weniger die Pädagogik als die Philosophie im Visier zu haben. Das zeigt die Fixierung auf den freien Willen. In einem Streitgespräch mit dem Philosophen Lutz Wingert äussert der Hirnforscher Wolf Singer (2003) die Ansicht, dass die naturwissenschaftliche Sicht keinen Raum lasse «für ein mentales Agens wie den freien Willen, das dann auf unerklärliche Weise mit den Nervenzellen wechselwirken müsste, um sich in Taten zu verwandeln» (S. 12). Auch das Prinzip von Schuld und Sühne hält Singer für verzichtbar, denn die Annahme, wir seien verantwortlich für das, was wir tun, sei «aus neurobiologischer Sicht nicht haltbar» (S. 20). Da wir durch die Verschaltungen in unserem Gehirn festgelegt sind, sollten wir «aufhören, von Freiheit zu sprechen» (Singer, 2004, S. 30).
So sieht es auch der Evolutionsbiologe Franz Wuketits (2008), der den freien Willen unumwunden zur Illusion erklärt. Und auch für den Kognitionspsychologen Wolfgang Prinz (2004a) ist die Idee eines freien menschlichen Willens «mit wissenschaftlichen Überlegungen prinzipiell nicht zu vereinbaren» (S. 22). Gibt es keinen freien Willen, so fallen gewohnte Unterscheidungen dahin, wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Handeln im Affekt und Handeln mit Bedacht. Folgen wir dem Psychologen Hans Markowitsch (2004), dann haben wir es dabei mit einer Scheinunterscheidung zu tun, denn beide Handlungsformen seien durch unser Gehirn determiniert. Der Unterschied zwischen meinem «unfreiwilligen» Wutanfall und meinem «freiwilligen» Entschluss, eine Tasse Kaffee zu trinken, liegt einzig darin, dass jeweils andere neurologische Strukturen involviert sind. Der Mensch ist in allem, was er tut, vollständig determiniert, weil sein Gehirn ein deterministisches Organ ist.
Der Determinismus dient als Argument, um gegen eine Philosophie vorzugehen, die scheinbar noch in metaphysischen Positionen verharrt. Ohne eine einzige Quelle zu zitieren, stellt Gerhard Roth (2008) die «traditionelle Sicht» der Willensfreiheit so dar, als hätte bei einer willentlichen Entscheidung das Ich «das letzte Wort» (S. 9). Die Willensfreiheit wird als fiktive immaterielle Kraft dargestellt, der die materielle Ordnung der Natur nichts anhaben kann.
Was wir im Alltag Personen zuschreiben, nämlich kognitive Leistungen wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Lernen, erscheint in den Neurowissenschaften als Verdienst des Gehirns.
Wir sind niemand
 Als erlebnismässiges Zentrum unseres Handelns wird damit auch das Ich zur Illusion. Wenn die Wissenschaft keinen Platz für den freien Willen hat, dann folgt daraus zwar nicht, dass wir uns nicht entscheiden können, aber wir treffen unsere Entscheidungen, wie sich Wolfgang Prinz (2004b, S. 202) ausdrückt, ohne dass da jemand wäre, der die Entscheidungen trifft. Was wir im Alltag Personen zuschreiben, nämlich kognitive Leistungen wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Lernen, erscheint in den Neurowissenschaften als Verdienst des Gehirns.
Als erlebnismässiges Zentrum unseres Handelns wird damit auch das Ich zur Illusion. Wenn die Wissenschaft keinen Platz für den freien Willen hat, dann folgt daraus zwar nicht, dass wir uns nicht entscheiden können, aber wir treffen unsere Entscheidungen, wie sich Wolfgang Prinz (2004b, S. 202) ausdrückt, ohne dass da jemand wäre, der die Entscheidungen trifft. Was wir im Alltag Personen zuschreiben, nämlich kognitive Leistungen wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Lernen, erscheint in den Neurowissenschaften als Verdienst des Gehirns.
Wenn Gerhard Roth (2004a, S. 229) den Satz «Nicht das Ich, sondern das Gehirn hat entschieden», als korrekt empfindet, dann unterstellt er, unsere gewöhnliche Rede vom Menschen als Subjekt lasse sich ersetzen durch eine Sprache, in der das Gehirn die Rolle des Subjekts spielt. So wie sich die Willensfreiheit als Illusion erweist, ist unser Ich blosse Einbildung, die durch unser Gehirn erzeugt wird. Wörtlich heisst es bei Roth (2009): «Ich bin ein Konstrukt des Gehirns, dem ein konstruierter Körper und eine konstruierte Umwelt zugeordnet sind» (S. 50). Unverblümt ausgedrückt, bin ich nichts anderes als ein Hirngespinst.
Wille als Motivbereinigung
In neueren Arbeiten hat Gerhard Roth seine Position etwas geändert. Unter dem Einfluss des Philosophen Michael Pauen hält er die Willensfreiheit nicht mehr für ein metaphysisches Phantom, sondern versucht, sie in den Kontext der Naturkausalität einzuordnen. Die Funktion des Willens soll darin liegen, in einer Situation, in der wir unterschiedliche Handlungstendenzen verspüren, eine Bereinigung vorzunehmen (vgl. Roth, 2009, S. 196ff.). Der Wille dient gewissermassen zur Motivsortierung. Vorausgesetzt wird, dass ich nicht unter Zwang stehe, weder innerem Zwang (wie zum Beispiel bei einer Geisteskrankheit oder bei Drogensucht) noch äusserem Zwang (wie zum Beispiel, wenn mir eine Pistole auf die Brust gesetzt wird). Ein so verstandener Wille stellt nicht mehr eine unbedingte (metaphysische) Ursache meines Handelns dar, sondern ist seinerseits bedingt, nämlich durch meine Motive, Überzeugungen und Wünsche.
Erklären können wir damit die berühmten, Martin Luther zugeschriebenen Worte «Hier stehe ich und kann nicht anders.» Nicht erklären können wir hingegen, dass zum alltäglichen Begriff der Willensfreiheit auch gehört, dass wir uns auch anders entscheiden können.
Allerdings ändert sich nichts daran, dass der Eindruck der freien Entscheidung lediglich ein Gefühl darstellt, nämlich das subjektiv empfundene Begleitgefühl des physiologisch bedingten Prozesses der Motivsortierung. Dieser läuft im Gehirn ab, ohne dass eine Ich-Instanz eingreifen würde oder könnte. Wenig überraschend erachtet es Roth (2009, S. 197) daher als Geschmacksfrage, ob wir am Begriff der Willensfreiheit überhaupt noch festhalten wollen oder nicht.

Wille als personale Urheberschaft
Etwas anders als Roth argumentiert Michael Pauen (2007), der nicht bei den Motiven, Wünschen und Zielen als «Letztursachen» einer willentlichen Entscheidung ansetzt, sondern diese in die Person dessen, der sich entscheidet, einbindet. Willensfreiheit ist personale Urheberschaft. Die Entscheidungsgründe werden nicht dem Gehirn der Person zugeordnet, aber auch nicht einer mentalen Teilinstanz – heisse diese nun Ich, Geist, Seele oder wie auch immer –, sondern der Person selber als körperlich-seelischer Ganzheit. Insofern ist die Person in ihren Entscheidungen selbstbestimmt. Selbstbestimmung ist eine Form von Determination, womit sich der Gegensatz von Freiheit und Determination, wie es den Anschein macht, in Luft auflöst.
Wer frei handelt, setzt also nicht eine Kausalkette in Gang, sondern wird durch all das zu einer Entscheidung geführt, was ihn als Person ausmacht. Wenn «ich» mich zu etwas entscheide, dann heisst dies nicht, dass meine Entscheidung von einem immateriellen «Ich» getroffen wird. Wenn «ich» mich auf mich beziehe, dann heisst dies im grammatikalischen Sinn lediglich, dass die Entscheidung weder aus äusserem oder innerem Zwang noch per Zufall erfolgt ist, sondern von mir selber getroffen wurde. Die grammatikalischen Ausdrücke «ich» und «mich» bezeichnen mich als Person in ihrer leiblich-seelischen Ganzheit und nicht eine fiktive Instanz in meinem Inneren.
Ob der Begriff der Willensfreiheit damit adäquat rekonstruiert wurde, ist allerdings ungewiss. Wenn unsere Entscheidungen und unser Handeln nicht durch die Summierung einzelner Beweggründe, sondern durch unsere Person als Ganzes bestimmt werden, dann besteht zwar kein Widerspruch mehr zur Determiniertheit der materiellen Wirklichkeit, aber unser intuitives Verständnis von Willensfreiheit ist gleichsam diffundiert in die Verästelungen unserer Person. Erklären können wir damit die berühmten, Martin Luther zugeschriebenen Worte «Hier stehe ich und kann nicht anders.» Nicht erklären können wir hingegen, dass zum alltäglichen Begriff der Willensfreiheit auch gehört, dass wir uns auch anders entscheiden können.
Der Wille ist weit eher mit einer Frucht vergleichbar, die sich mühelos vom Ast abnehmen lässt, wenn sie ihre volle Reife erlangt hat.
Willensbildung
Ein Ausweg ergibt sich vielleicht, wenn wir etwas genauer hinschauen, wie sich unser Wille bemerkbar macht. Obwohl Begriffe wie «Willensakt», «Willensimpuls» oder «Willensruck» suggerieren, der Wille sei ein Ereignis, das wie beim Umlegen eines Schalters abrupt zu einer Entscheidung führt, trifft dies in den wenigsten Fällen zu. Der Wille ist weit eher mit einer Frucht vergleichbar, die sich mühelos vom Ast abnehmen lässt, wenn sie ihre volle Reife erlangt hat. Nicht zufällig sprechen wir von der Willensbildung, die unter Umständen lange dauern kann – denken wir an die Berufswahl, die Partnerwahl oder die Einwilligung in einen riskanten medizinischen Eingriff. Die Willensbildung entspricht nicht einem Rechenprozess, in den die Beweggründe unseres Handelns als fixe Grössen eingingen, sondern kommt einem Beratungsprozess gleich, durch den unsere Handlungsprämissen offengelegt und geklärt werden.
Indem uns die Entscheidungssituation veranlasst, mit uns selber zu Rate zu gehen oder auch bei jemand Anderem Rat zu suchen, sind wir als Person, die die Entscheidung trifft, unter Umständen nicht mehr dieselbe Person, die wir waren, als wir in den Entscheidungsprozess eingestiegen sind.
Zwar entscheiden wir uns schliesslich in der Tat als Person, aber gerade als Person können wir uns im Verlaufe des Willensbildungsprozesses verändert haben. Indem uns die Entscheidungssituation veranlasst, mit uns selber zu Rate zu gehen oder auch bei jemand Anderem Rat zu suchen, sind wir als Person, die die Entscheidung trifft, unter Umständen nicht mehr dieselbe Person, die wir waren, als wir in den Entscheidungsprozess eingestiegen sind. Daher ist nicht zum vorneherein klar, zu was wir uns schliesslich entscheiden werden, wenn auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung mit unserem bisherigen Leben übereinstimmen wird, gross ist. Aussenstehende können unter Umständen sogar schon früher erkennen, worauf der Entscheidungsprozess hinausläuft. Das stellt die Freiheit der Entscheidung aber nicht grundsätzlich in Frage. Vorherbestimmt ist der Verlauf der Willensbildung ebenso wenig, wie deren Resultat vorweg feststeht. Das schliesst nicht aus, dass der Willensbildungsprozess eine neurophysiologische Grundlage hat (vgl. Fuchs, 2020, S. 202ff.).

Es gibt daher gute Gründe, nicht die Willensfreiheit in Frage zu stellen, sondern den Determinismus. Wie die Wissenschaftsphilosophin Brigitte Falkenburg (2012) nachweist, stellt der Determinismus keineswegs eine wissenschaftliche Tatsache dar, sondern kommt einem «szientifischen Mythos» (S. XI) gleich. Im Puzzle der kausalen Zusammenhänge zwischen Gehirn und Geist bestehen erhebliche Lücken. Selbst auf der neuralen Ebene des Gehirns ist ein strikter Determinismus unhaltbar. Falkenburg fasst ihre Analyse in den Worten zusammen, dass das «unvorstellbar komplexe neuronale Geschehen in unserem Kopf […] nicht berechenbar» (S. 326) ist und wir «keine zwingenden Gründe (haben) anzunehmen, dass es uns vollständig determiniert» (ebd.). Insofern spricht nichts dagegen, die Beweislast umzukehren und davon auszugehen, dass wir in unserem Willen zwar nicht bedingungslos, aber doch grundsätzlich frei sind (vgl. Keil, 2009). Wer es anders haben will, steht in der Pflicht, uns vom Gegenteil zu überzeugen.