
Nach den entsetzlichen Verbrechen an behinderten Menschen im Zweiten Weltkrieg hatte man in der Schweiz wie in Deutschland versucht, mit einem je nach Standpunkt differenzierenden oder separierenden Sonderschulwesen den besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder und Jugendlicher umfassend Rechnung zu tragen. Kinder mit einer Lernschwäche, andere mit Verhaltens- oder Kontaktstörungen, weitere mit Körperbehinderungen oder Leistungseinschränkungen im Sehen oder Hören wurden in homogen zusammengesetzten Kleinklassen von dafür ausgebildeten Heilpädagogen unterrichtet.
Definition
Integration – Integration bezeichnet die Eingliederung von Schülern mit einer Behinderung oder Lernschwäche in die Regelschule. Der Begriff steht im Unterschied zur separaten Beschulung in Kleinklassen (Sonderschulklassen).
Inklusion – Inklusion geht deutlich weiter und beinhaltet einen Paradigmenwechsel gegenüber dem bisherigen Schulverständnis: Die Jahrgangs- und Niveauklassen werden grundsätzlich aufgehoben. Stattdessen werden Klassen zusammengesetzt, die möglichst divers an Alter und Leistungsniveau sind; auch alle Kinder mit Handicaps gehören dazu. Die möglichst grosse Vielfalt in einer Klasse wird zur Normalität erklärt. (dj)
In der Bevölkerung überwiegt bis heute eine positive Einstellung zu diesen Kleinklassen. Allerdings gab es auch eine leider recht verbreitete, überhebliche Einstellung gegenüber diesen Schülern, die sich insbesondere bei den Regelschülern im gleichen Schulhaus oder Dorf äusserte: Sie seien dumm und wenig bildbar; nicht selten wurden sie despektierlich behandelt und zuweilen gemobbt. Diese Problematik war ein wesentliches Argument für die Reform des Sonderschulwesens. Die Integration sollte den Vorurteilen und der Ausgrenzungstendenz entgegenwirken.
Integration kann funktionieren
Die Einführung des Integrationskonzepts in der Schweiz in den 1990er-Jahren führte zur Schliessung vieler Kleinklassen. Diese Reform war höchst umstritten: Die Praktiker bezweifelten, dass Integration den behinderten Kindern die erforderlichen Rahmenbedingungen zum Lernen bieten könne. Aus der Lehrerbildung hingegen hiess es, Integration sei mit der richtigen Didaktik ohne weiteres erfolgreich umzusetzen.
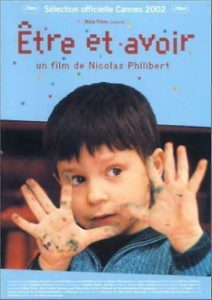
Tatsächlich gab es in der Schweiz und in den umliegenden Ländern vor der flächendeckenden Einführung der Integration bereits einiges an Erfahrung in kleinen Landschulen, wie man Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters und mit sehr unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen zusammen unterrichten kann. Der französische Dokumentarfilm «Être et avoir» von 2002 porträtiert eine solche Dorfschule in der Auvergne. Er zeigt den Alltag eines Dorfschullehrers mit seinen Schülern aus den umliegenden Bauerndörfern und Weilern im Alter von 6 bis 14 Jahren während etwas mehr als einem halben Jahr. Porträts der einzelnen Kinder vermitteln einen authentischen Einblick in das Klassenklima und die Arbeitsweise des Pädagogen, Herrn Lopez. Unterschiedliche Schülerpersönlichkeiten sind in dieser Klasse vertreten, auch das heutige durchschnittliche Spektrum an Kindern mit Diagnosen wie ADHS, ADS oder Autismus gehört dazu. Die Freude der porträtierten Kinder und Jugendlichen am gemeinsamen Unterricht und ihre tiefe Zuneigung zum Lehrer ist augenfällig. Analysiert man die Arbeitsweise dieses Pädagogen, kristallisieren sich drei zentrale Erfolgsfaktoren heraus:
Erstens besteht in dieser Klasse eine freundschaftlich-kooperative Atmosphäre. Gelegentlich kommt es zu Verfehlungen, Missverständnissen und Grobheiten, und es fliessen Tränen. Diese werden aber stets ernst genommen und der väterlich vermittelnde Lehrer Lopez sorgt für Klärung und Versöhnung, so dass keine Ressentiments und Gefühle des Unverstandenseins zurückbleiben. Wenn ein Kind Schwierigkeiten beim Schreiben und Rechnen hat oder beim gemeinsamen Backen das Eigelb auf dem Boden landet, ist die Reaktion der Mitschüler nie spöttisch-abwertend, sondern aufmunternd.
Ob man ein Diktat übt, geometrische Probleme löst oder das Einmaleins wiederholt – immer sind die Schüler geistig präsent und engagiert dabei, weil es einfach interessant ist.
Zweitens versteht es der Lehrer, den Unterricht für die Schüler ansprechend und gut verständlich zu gestalten, so dass deren Interesse geweckt wird. Lehrer Lopez führt seinen Unterricht interaktiv, indem er die Schüler alle zum Mitwirken animiert, jeden im Auge behält und, falls erforderlich, Hilfestellung gibt. In jeder Lektion ist eine vom Lehrer angeregte, erwartungsvolle Dynamik zu spüren. Ob man ein Diktat übt, geometrische Probleme löst oder das Einmaleins wiederholt – immer sind die Schüler geistig präsent und engagiert dabei, weil es einfach interessant ist.

Der dritte entscheidende Aspekt ist die persönliche Beziehung, die der Lehrer zu jedem seiner Schützlinge aufgebaut hat. Dem einen Jungen, der zuhause einen mitunter recht derben Umgang erlebt, begegnet er anders als dem sehr gehemmten Gleichaltrigen, bei dessen Familie die Sprachlosigkeit ins Auge springt. Den Zappelphilipp, der auf seinem Stuhl herumturnt, lässt er nicht aus den Augen, signalisiert volle Präsenz mit verbindlichem Fordern und Fördern. Jedes Kind wird als Persönlichkeit individuell erfasst, so dass auch jede Interaktion eine unterschiedliche Färbung aufweist.
Die Zusammenschau heutiger grundlegender anthropologischer Erkenntnisse zum Lernen liefert eine plausible Erklärung, wieso dieser Lehrer erfolgreich ist. Das Lernen ist ein durch und durch sozialer Prozess, bei dem der junge Mensch eine intensive, erwartungsvolle Ausrichtung auf seine wichtigsten Bezugspersonen hat. Die zentrale Lernmotivation bei Kindern ist laut dem Entwicklungspsychologen Paul L. Harris, von den «kulturellen Mentoren» lernen zu wollen, um möglichst bald am sozialen Miteinander teilhaben zu können. Verknüpft mit dieser Erkenntnis erweist sich die «Bindungssicherheit» eines Kindes oder Jugendlichen als entscheidend für das schulische Lernvermögen, zumal die offene, neugierige Zuwendung des jungen Menschen zur Welt wesentlich vom erworbenen Urvertrauen Menschen gegenüber abhängt.
Die Verarmung dessen, was eine gute Schule für die Schüler erfreulich macht, nämlich das beglückende Erlebnis von Kooperation und gemeinsamer Vertiefung, lässt erahnen, wie problematisch sich dieser Reformtrend auswirkt.
So erfolgreich Integration sein kann, so grandios kann sie auch scheitern, wenn die Lehrperson mit der Dynamik in der Klasse und der Anzahl an Schülern, die eine besondere Zuwendung und enge Betreuung brauchen, überfordert ist. Dann entgleist die angestrebte Integration und bringt negative Folgen mit sich, insbesondere für Schüler, die speziell gefördert werden müssen.
Wo bleibt die Pädagogik?

Bild Adobe Stock
Aus Sicht der Inklusionsbefürworter ist die Integration eine unzureichende Reform, weil sie lediglich die Anpassung der integrierten Schüler an die Regelschule beinhalte, statt eine Situation zu schaffen, in der sie wirklich gleich wie alle anderen eingebunden seien. Die wesentlich weiter gehende Inklusion verlangt deshalb eine veritable Revolution der gesamten, auf Niveaus und Altersgruppen aufbauenden Schulkonzeption. Bei der Inklusion soll das ganze Spektrum an Kindern und Jugendlichen – vom geistig behinderten Schüler bis zum Gymnasiasten – zusammen in einer Klasse unterrichtet werden. Eine solche «Schule für alle» hat dann zur Folge, dass von der alten Schule kein Stein mehr auf dem anderen bleibt.
Ein ernsthaftes gemeinsames, inhaltlich zielführendes Lernen ist bei der Inklusion nicht denkbar. Die inklusive Realität ist, dass die Schüler sich ohne Kooperationsmöglichkeit individuell mit Aufgaben beschäftigen müssen und folglich keinen verbindlichen Bezug zu jemand anderem in der Klasse haben. Dabei sind viele der Schüler mit einer stärkeren Einschränkung oder einer sonstigen Problematik auf einen einzelnen Erwachsenen angewiesen, der viel Unterstützung bieten muss; fehlt diese, fühlen sich die Schüler schnell verloren, resignieren oder beginnen auf eine wenig konstruktive Weise für Aufmerksamkeit zu sorgen. In diesem Zusammenhang ist auch die auffallende Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit psychiatrischen Auffälligkeiten eine Herausforderung.
Echte Prävention gegen Mobbing setzt einen sehr bewussten und engagierten pädagogischen Aufbauprozess voraus, gerade angesichts einer so grossen Heterogenität.
Bei der Inklusion sind sogar die möglichen gemeinsamen Erlebnisse und Aktivitäten zwischendurch eher bescheiden. Laut Theorie sollte allein durch das Setting eine sozial wirksame Stimmung des Eingebundenseins entstehen und diese gar eine präventive Wirkung gegen Mobbing haben. Aus der bisherigen Forschung lässt sich derlei allerdings ganz und gar nicht bestätigen. Echte Prävention gegen Mobbing setzt einen sehr bewussten und engagierten pädagogischen Aufbauprozess voraus, gerade angesichts einer so grossen Heterogenität. Nur wenige Kinder bringen per se so viel Sozialkompetenz und die erforderlichen, emotional verankerten Werte Respekt, Toleranz, Kooperationsbereitschaft und Zivilcourage mit, dass durch das inklusive Setting automatisch ein auf Wohlwollen basierendes Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht.
Das humanistisch orientierte Bildungsverständnis, das die pädagogisch-didaktisch gestaltete Persönlichkeitsbildung jedes Schülers durch eine Lehrperson im Rahmen eines Klassenkollektivs zum Ziel hat, wurde im Laufe der Jahre immer simplifizierender als «lehrerzentriert» und dirigistisch apostrophiert sowie pauschal als «Frontalunterricht» diskreditiert.
Der Kampf gegen den «Frontalunterricht»
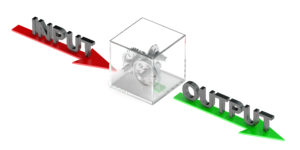
In der Schweiz ist der Schritt hin zur Inklusion noch nicht vollzogen. Es spricht aber viel dafür, dass sich das in naher Zukunft ändern könnte. Der gesamte Reformprozess, dem unsere öffentlichen Schulen seit Mitte der 1990er-Jahre unterzogen wurden, weist in diese Richtung. Spätestens seit der Mitwirkung der Schweiz bei den PISA-Studien hat in unseren Schulen ein weitreichender Paradigmenwechsel stattgefunden. Das humanistisch orientierte Bildungsverständnis, das die pädagogisch-didaktisch gestaltete Persönlichkeitsbildung jedes Schülers durch eine Lehrperson im Rahmen eines Klassenkollektivs zum Ziel hat, wurde im Laufe der Jahre immer simplifizierender als «lehrerzentriert» und dirigistisch apostrophiert sowie pauschal als «Frontalunterricht» diskreditiert.
An dessen Stelle wurde ein vergleichstestbasiertes «Output-Controlling-System» mit immer stärker individualisierenden Lernformen etabliert, das sowohl eine inhaltlich-sachliche als auch eine soziale Verarmung schulischen Lernens zur Folge hatte. Der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung bildet das an den Pädagogischen Hochschulen geförderte «selbstorganisierte Lernen», das durch den offensichtlich erwünschten Hype der schulischen Digitalisierung zusätzlich vorangetrieben worden ist. Das damit verbundene Bildungsideal ist der sich selbst optimierende Schüler, der mit Hilfe von digital zugänglichen «Lernumgebungen» sich die Inhalte, die für die jährlichen Vergleichstests erforderlich sind, möglichst alleine erarbeitet.

In diesem Zusammenhang wurde die Lehrerrolle mit derjenigen eines «Moderators», «Coachs» oder eines «Arrangeurs von Lernprozessen» eingetauscht. So ist gar nicht vorgesehen, den Unterricht vorzugsweise mit der ganzen Klasse gemeinsam durchzuführen. Gut damit zurechtkommen lediglich die vifen, von zuhause aus intensiv geförderten Schüler. Aber auch sie verlieren die Möglichkeit, sich in einem gemeinsamen Lernprozess soziale Kompetenzen anzueignen. Wen erstaunt es, wenn die mit dieser Schulform verbundene Vereinzelung zur Folge hat, dass bei vielen Schülern die Lernmotivation leidet und sie vielfach abends und über das Wochenende mit den Eltern oder im Nachhilfeunterricht den verpassten Lerninhalt nachholen müssen? Die Verarmung dessen, was eine gute Schule eigentlich für die Schüler erfreulich macht, nämlich das beglückende Erlebnis von Kooperation und gemeinsamer Vertiefung, lässt erahnen, wie problematisch sich dieser Reformtrend auswirkt. Die Inklusion vollendet diesen Trend und führt zum Gegenteil von dem, was man angesichts ihrer hochgesteckten ideellen Ziele erwarten würde.
Trendumkehr
Die Ironie dieser Entwicklung manifestiert sich darin, dass sich – vorläufig vorwiegend in den angelsächsischen Ländern – schon länger eine Trendumkehr abzeichnet. Seit einigen Jahren wurde, basierend auf wissenschaftlich fundierten Einsichten der Schulpädagogik, in etlichen öffentlichen Bildungseinrichtungen erfolgreich die Praxis des «dialogischen Lernens» oder des «unterrichtlichen Dialogs» etabliert. Die erziehungswissenschaftlichen Erläuterungen zu dem entsprechenden Unterricht bestätigen, dass ein vom Lehrer psychologisch und pädagogisch-didaktisch verantwortungsvoll geführter, interaktiver Unterricht mit der Klasse den Bedürfnissen der Schüler am besten entspricht. Bei heterogen zusammengesetzten Klassen, wie im Fall der Integration, funktioniert dies durchaus. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen dem Gestaltungsvermögen des Lehrers entsprechen. Inklusion lässt einen dialogischen Unterricht gar nicht zu, im Gegenteil. Es drängt sich also die Frage auf, wieso mit der Inklusion gerade für die besonders bedürftigen behinderten Schüler eine Schulform forciert wird, die diesen jungen Menschen ein förderliches, gleichwertiges Eingebundensein mehr erschwert als erleichtert.
Beat Kissling
ist Erziehungswissenschafter, Psychotherapeut und Dozent für Umweltethik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Zuletzt von ihm erschienen: «Sind Inklusion und Integration in der Schule gescheitert? Eine kritische Auseinandersetzung» (Hogrefe-Verlag, 2022). Dieser Artikel ist zuerst im Schweizer Monat erschienen.






