
Es war in den Achtzigern. Der Besuch des Schulinspektors stand an und ich wollte dem knorrigen Sozialdemokraten etwas Besonderes bieten: Eine in Gruppenarbeit stattfindende Französischlektion, eine intensive Aktivierung grundsätzlich motivierter 8.-Klässler im Fremdsprachenunterricht. Die Lektion wurde ein Desaster, die Mimik des Inspektors verdunkelte sich zunehmend.
Es begann mit einem Desaster
In der Schlussbesprechung war Herr Krebs gnädig gestimmt. Er fragte mich: «Herr Pichard, war das jetzt eine Lektion, in der alle Schüler motiviert und zielstrebig Französisch gelernt haben?»
Natürlich nicht, antwortete ich. Er schmunzelte und gab dem Junglehrer folgende Worte mit: «Es gibt hervorragenden Projektunterricht und miserablen Frontalunterricht. Es gibt aber auch hervorragenden Frontalunterricht und miserablen Projektunterricht.»
Bei der Lektüre von Urs Kalberers Beitrag kam mir diese Aussage dieses Schulinspektors in den Sinn. Vermutlich hat er eine grosse Dosis schlechten Projektunterrichts und unzulänglich konzipierten Gruppenunterrichts eingenommen und empfiehlt nun die Werte des lehrerzentrierten Klassenunterrichts. Das ist natürlich pauschal und auch zu kurz gedacht.
Die Bedenken von Urs Kalberer sind berechtigt
Keine Frage: Einige Einwände von Urs Kalberer sind gerechtfertigt. Es gibt tatsächlich wenige Studien, welche die Wirksamkeit von Projektunterricht belegen. Und die Mängel, die er im Einzelnen auflistet, ähneln genau jenen Vorkommnissen, die mich in meiner «Desaster-Lektion» vor 35 Jahren blamierten.
Das selbstorganisierte Lernen ist keine Unterrichtsmethode, sondern ein Lernziel.
Aber was heisst hier wirksam, auf was bezieht sich das Wort «wirksam»? Zunächst einmal gilt es, mit einem Missverständnis aufzuräumen: Projektunterricht ist nicht in erster Linie dazu angelegt, dass sich die Schüler mehr Wissen aneignen. Projektunterricht stärkt das selbstorganisierte Lernen. Und das selbstorganisierte Lernen ist keine Unterrichtsmethode, sondern ein Lernziel. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, «ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen [und] an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten». Sie sollen in der Fähigkeit gefördert werden, «ihr Lernen selbstständig zu gestalten und dafür zunehmend Verantwortung zu übernehmen». Und sie sollen angeleitet werden, zu planen, mit anderen zusammenzuarbeiten und über ihr Lernen und ihr Arbeiten nachzudenken.

Sollen wir diese Lernziele negieren und nur Wissen und Werte vermitteln? Das kann es ja nicht sein, denn die oben genannten Lernziele waren ja auch schon vor dem Lehrplan 21 Bestandteil unseres Curriculums. Und wie soll man mit den Schülern diese Lernziele erreichen? Antwort: Indem man genau diesen Projektunterricht zulässt, ihn plant und gezielt einsetzt.
Diese Lernziele kann der Projektunterricht und auch die Individualisierung sicher besser erreichen, als eine dozierende, sprich theoretische Variante.
Aber Urs Kalberer empfindet den Projektunterricht vor allem dann als Unterrichtsmethode ineffizient, wenn es darum geht, sich Wissen und Kenntnisse zu erwerben.
Der Lerneffekt
Die Frage des Lerneffekts stellt sich allerdings bei allen Unterrichtsmethoden. Gerade heute habe ich mit meiner Klasse das Atommodell durchgenommen. Es war eine – meiner Ansicht nach perfekt getimte Lektion, mit vielen Problemstellungen, klaren Inputs und Visualisierungen, gefolgt von einem intensiven Klassengespräch. Sicher ist die «Direkte Instruktion» (anstatt «Frontalunterricht» verwende ich den von John Hattie bevorzugten Ausdruck) in dieser Situation wesentlich effektiver, als wenn die Schüler sich dies selber hätten erarbeiten müssen.
Schülerinnen und Schüler sind oft auf erstaunliche Weise lernresistent.
Trotz des didaktisch aufwändigen Settings sah ich in einige desinteressierte Gesichter, und die Qualität mancher Antworten waren sehr ernüchternd.

«Schülerinnen und Schüler sind oft auf erstaunliche Weise lernresistent», stellte schon Professor Juergen Oelkers fest, «in dem Sinne, dass sie trotz aller neuen Methoden nicht das tun, was von ihnen erwartet wird.» (Jürgen Oelkers, Wie man Schule entwickelt, BELTZ, S. 55). Das gilt aber für jede Unterrichtsform, auch für die von Urs Kalberer und Hans-Peter Amstutz so gepriesene «Direkte Instruktion»
Deshalb gibt es beim Projektunterricht auch Abstürze, Fehlschläge und Schüler, die mit der ihnen zugestandenen Freiheit nicht umgehen können. Ist das weiter schlimm? Auch bei der «Direkten Instruktion» kommt es zu Abwesenheiten, Unkonzentriertheiten und innerlichem Abschalten.
Völlig unnötig finde ich den Grabenkrieg, der von den jeweiligen Anhängern einer Unterrichtsform apodiktisch vom Zaum gerissen wird.
Und natürlich wird in jedem Fall viel zu wenig gefragt, wann die Schüler nicht lernen.
Ein völlig unnötiger Grabenkrieg
Die Vertreter reformpädagogischen Modelle unterstellen verschüttete Lernfreude, die im Augenblick der Selbsttätigkeit sofort freigesetzt wird. Die Vertreter der direkten Instruktion sprechen von viel effizienter genutzten Lernzeit, ohne zu berücksichtigen, was die Schüler interessiert, was ihre Interessen bindet, wie sie herausgefordert werden, was sie langweilt und wann sie wirklich nachhaltig lernen. Und natürlich wird in jedem Fall viel zu wenig gefragt, wann die Schüler nicht lernen.
Deswegen ist Unterricht, insbesondere auch der Projektunterricht, eine ständige Anpassungsleistung, die immer wieder reflektiert werden muss.
Eine sehr heterogene Abschlussklasse

Ich unterrichte zurzeit eine 9. Abschlussklasse. Wir arbeiten am OSZ-Orpund in einem integrierten Modell. Konkret heisst das, dass in meiner Klasse angehende Berufsmaturanden (die Gymnasiasten sind bereits weg), solide Sekundarschüler und Realschüler, Schüler mit besonderem Förderbedarf zusammen unterrichtet werden. Von dieser Klasse haben 4 bereits eine Lehrstelle. Drei werden grosse Mühe haben, eine zu finden, und ein Mädchen möchte versuchen, noch einmal den Übertritt ins Gymnasium zu schaffen. Wie soll ich diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden? Und vor allem: Wie kann die Motivation und Leistungsbereitschaft nach 9 Schuljahren bei 14 – 16-jährigen Teenies aufrechterhalten werden?
Das geht nur mit individualisierenden Unterrichtsmethoden und Projekten, bei denen die Schülerinnen auch ihre Interessen und vorhandenen Fertigkeiten einbringen können.
Ein Viertel des Unterrichts

In unserem 9. Schuljahr, dem Abschlussjahr meiner Schüler, ist der Anteil der Projektarbeit und des selbstorganisierten Lernens auf den ersten Blick relativ hoch. Von den rund 1200 Lektionen können rund 300 Lektionen (das sind 25%) dem Projektunterricht zugeordnet werden. Das entspricht in etwa einem Viertel der Unterrichtszeit. Ein persönliches, eigenständig gewähltes Unterrichtsprojekt, Nachtreportagen, das Führen eines Restaurants mit Hotelbetrieb während einer Woche, organisierte Diskussionspodien, vor allem aber die individuelle Vorbereitung auf die Berufslehre, das Schliessen schulischer Lücken und der ganze Bewerbungsprozess verlangt nach Zeitgefässen, in denen die direkte Instruktion zurückstehen muss. Dazu haben wir wöchentlich drei Lektionen IVE-Unterricht (Individuelle Vertiefung und Erweiterung). Ausserdem steht das Abschlusstheater an und die Organisation der Abschlussreise, wobei die Schülerinnen auch einbezogen werden.
Projektunterricht ist eine Königsdisziplin, die der Lehrkraft und den Lernenden viel abverlangt. Die Lehrkraft muss den Prozess unter Kontrolle behalten, muss eingreifen, wenn etwas nicht klappt, muss Hilfestellungen geben und vor allem: Sie muss viel Zeit für die Rückmeldung aufwenden. Die Schüler werden mit ihrer eigenen Bequemlichkeit konfrontiert, müssen Disziplin beweisen, Zeitpläne aufstellen, Termine einhalten, Aufgabenteilungen vornehmen, Projektskizzen- und Projektbeschreibungen abgeben. Es gibt nicht wenige Schüler, welche diese Art Unterricht überhaupt nicht schätzen, gerade weil sie auf Fähigkeiten baut, die noch nicht genügend entwickelt oder herausgefordert wurden. Aber gerade aus Fehlern und Scheitern kann man lernen, wenn die Lehrkraft die richtigen Rückmeldungen gibt.
Beurteilung ist eine Herausforderung
Die Frage der Beurteilung ist in der Tat eine grosse Herausforderung. Eine Note für alle, egal, wer sich wie eingegeben hat, kann ja nicht logisch sein. Hier gibt es intelligente und vor allem differenzierte Beurteilungsvarianten. Am besten sind selbständige Schülerarbeiten immer dann, wenn es sich um Einzelarbeiten handelt. Bei Gruppenarbeiten ist das Feedback der Gruppe sehr wichtig und dient auch als Reflektion. Es kann durchaus sinnvoll sein, ab und zu starken SchülerInnen mit einer guten Arbeitsmoral einen schwachen Schüler zuzuteilen. Der schwache Schüler sieht, wie man auch arbeiten kann, die starke Schülerin übernimmt auch eine Coaching- und Vorbildfunktion. Natürlich darf so etwas nicht die Regel sein. Man kann auch SchülerInnen, welche die Voraussetzungen, über eine längere Zeit selbständig an einem Projekt zu arbeiten, nicht haben, von diesem befreien und ihnen eine «Light-Variante» mit engen Vorgaben zuteilen.
Eigenständig erworbene Erkenntnisse setzen sich nachhaltiger im Gehirn einer Schülerin fest, als wenn man ihnen die Lerninhalte einfach doziert.
Und – bei aller Kritik am «Konstruktivismus» und dem dazu gehörenden «Selbstendeckenden Lernen» – ist es unbestritten, dass eigenständig erworbene Erkenntnisse sich nachhaltiger im Gehirn einer Schülerin festsetzen, als wenn man ihnen die Lerninhalte einfach doziert.
Pädagogischer Kitsch

Der Umkehrschluss, nun alles auf selbstorganisiertes Lernen und Projektunterricht umzustellen und die Lehrkraft als Coach zu definieren, gehört natürlich zu diesem neuzeitlichen reformpädagogischen Duktus, der sich nicht um Wirklichkeiten kümmern muss. Ich nenne es pädagogischer Kitsch oder PH-Wunschprosa.
Philipp Loretz, Vorstandsmitglied des lvb und Redaktionsmitglied unseres Blogs formulierte es folgendermassen:
So banal es klingt: Die situationsgerechte Methodenvielfalt stellt letztlich sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler auf ihre Rechnung kommen und vom Unterricht profitieren. Oder würden Sie sich von einem Arzt behandeln lassen, der lediglich über einen Hammer verfügt? Er würde Sie zwangsläufig für einen Nagel halten.
Und Michael Felten schrieb in der Zeit: «Der eine Lehrer macht zu viel langweiligen Frontalunterricht, der andere zu oft ineffektive Freiarbeit, ein dritter zu häufig Gruppenarbeit auf banalem Niveau. Ein angemessener Mix – mit jeweils hochwertigen Anteilen – bleibt eine beständige Aufgabe für uns Lehrer. » (Zeit 15.1.2015).




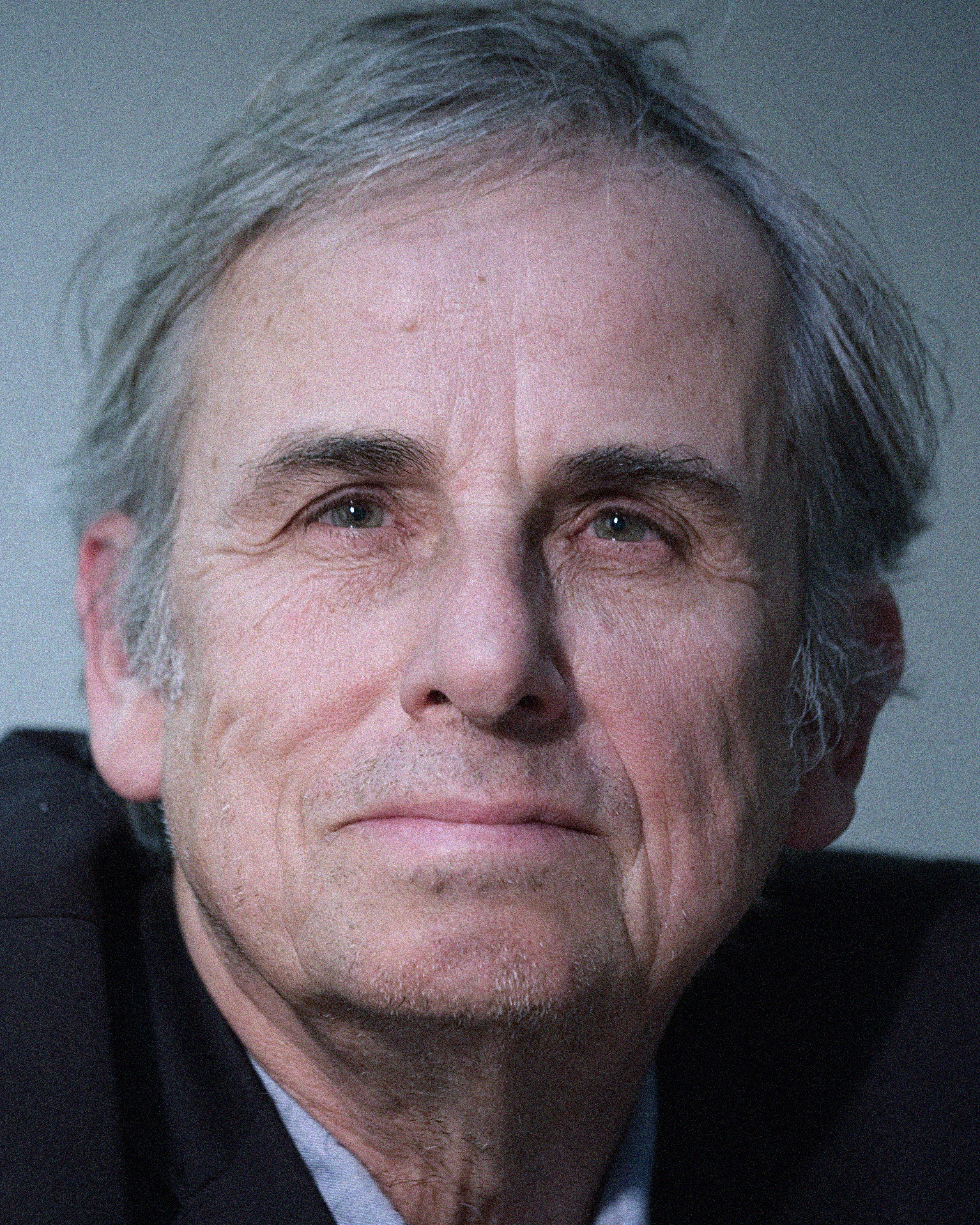

Projektunterricht zum Beispiel in Form einer jährlichen Projektwoche kann sehr hilfreich sein, wenn es gelingt, denjenigen Schülern ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen, die das sonst in den schulischen Fächern kaum erleben. Ich erinnere mich an eine Sek-C Klasse mit schwachen, unruhigen Schülern, die schwer zu motivieren waren. Mit ihnen hat man jedes Jahr eine Ferienwoche in einem alten Bauernhaus im Tessin durchgeführt, wobei man versucht hat, sie soweit wie möglich in die Lagervorbereitungen einzubeziehen: In den vorangehenden Wochen wurden im Rechenunterricht die notwendigen Mengen an Lebensmitteln berechnet, im Deutschunterricht die Menüpläne aufgeschrieben usw. usw.