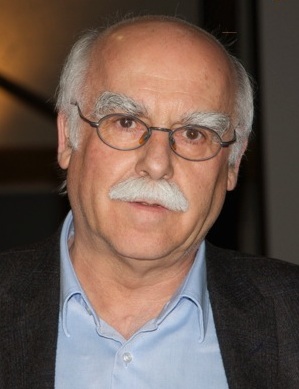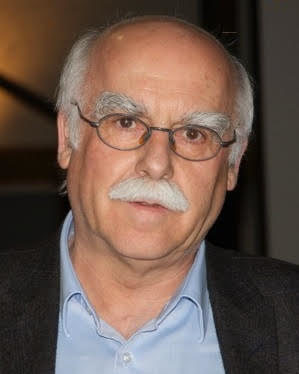Bei allen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten, die uns das Covid-19-Virus zumutet, hat die Corona-Pandemie auch ihre guten Seiten. So bietet sie die seltene Gelegenheit zu beobachten, wie eine Forschungswissenschaft funktioniert. Epidemiologen und Virologen zeigen uns gleichsam in Echtzeit, wie sie arbeiten. Sie versuchen, ein Forschungsobjekt in den Griff zu bekommen, das zwar nicht völlig unbekannt ist, über das aber gemessen an den Erwartungen der Öffentlichkeit noch wenig verlässliches Wissen vorliegt. Genaueres zu den praktisch relevanten Fragen nach Herkunft, Verbreitung, Symptomatik, Gefährlichkeit, Immunität, Übertragbarkeit und Eindämmung des Virus erfahren wir in Abhängigkeit vom Voranschreiten der wissenschaftlichen Forschung.
Was wir sehen
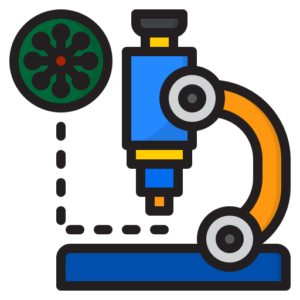
Was wir dabei sehen, sind Disziplinen, die mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, eine Forschungsfront, die in ständiger Bewegung ist, und Forscherinnen und Forscher, die sich nicht selten uneinig sind. Wir sehen, dass Studienergebnisse oft nur für kurze Zeit Bestand haben, weil sie durch neue und bessere Ergebnisse widerlegt werden. Wir sehen, wie wissenschaftliche Forschung von Fördergeldern abhängig ist, wie Erkenntnisse publiziert werden müssen, um wahrgenommen zu werden, und wie das Renommee eines Publikationsorgans wesentlich darüber befindet, ob eine Studie überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Aber selbst hochrangige Zeitschriften verbürgen keine Verlässlichkeit, wie zwei Artikel in den angesehenen medizinischen Zeitschriften The Lancet und New England Journal of Medicine zeigen, die wenige Wochen nach Erscheinen wegen gravierender methodischer Mängel zurückgezogen werden mussten.
Wir sehen auch, dass eine einzelne Studie, wie gut auch immer sie gemacht sein mag, von beschränkter Aussagekraft ist, weil es fast nie gelingt, den Forschungsgegenstand erschöpfend zu erfassen.
Wir sehen auch, dass eine einzelne Studie, wie gut auch immer sie gemacht sein mag, von beschränkter Aussagekraft ist, weil es fast nie gelingt, den Forschungsgegenstand erschöpfend zu erfassen. Wir sehen, wie wichtig Fakten sind, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu belegen, wie sehr Fakten aber methodenabhängig sind und selbst methodisch gut begründete Tatsachen noch wenig über den Wert einer wissenschaftlichen Erkenntnis aussagen. Letztlich ist es der kritische Diskurs in der Gemeinschaft der Forscherinnen und Forscher, der darüber befindet, wie verlässlich ein Untersuchungsergebnis ist. Schliesslich sehen wir, dass die Resultate einer wissenschaftlichen Studie wenig darüber sagen, welche Folgerungen praktischer Natur aus ihr zu ziehen sind. Was die Expertinnen und Experten zum Corona-Virus sagen, kann für sich allein noch nicht begründen, welche gesundheitspolitischen Massnahmen zu treffen sind.
«Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse»
Mitverfolgen zu können, wie wissenschaftliche Forschung funktioniert, ist nicht nur allgemein von Interesse, sondern stellt insbesondere eine Chance für jene dar, die sich von den Leistungen einer modernen Forschungswissenschaft falsche Vorstellungen machen. Dazu gehört insbesondere die Bildungspolitik, teilweise auch die Bildungspraxis. In beiden Fällen ist die Erwartung, durch wissenschaftliche Erkenntnisse könnten Gewissheiten geschaffen werden, die es erlauben, in kontroversen Fragen eindeutige Entscheidungen herbeizuführen, weit verbreitet. Man denke an das schweizerische Bildungsmonitoring, das 2006 eingerichtet wurde und seitdem alle vier Jahre in einen nationalen Bildungsbericht mündet.
Wer sich die Lektüre des nationalen Bildungsberichts zur Pflicht gemacht hat, weiss, wie beschränkt die Aussagekraft der meisten Daten, Tabellen und Grafiken ist.

Wer sich dessen Lektüre zur Pflicht gemacht hat, weiss, wie beschränkt die Aussagekraft der meisten Daten, Tabellen und Grafiken ist, die in den Berichten präsentiert werden. Ein verlässliches Bild über das schweizerische Bildungswesen gewinnt man kaum; der Wissensstand liegt weit unterhalb des Niveaus, das wir aktuell in Bezug auf das Corona-Virus haben. Womit nicht bestritten sei, dass sich die Lektüre der Berichte faute de mieux trotzdem lohnt.
Die geringe Ausbeute steht in krassem Widerspruch zu den hohen Erwartungen, die seitens der Politik an die Bildungsberichte gerichtet werden. So schreiben die behördlichen Auftraggeber im Vorwort zum Bildungsbericht 2014, es würden «wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse benötigt» (S. 8), um das Bildungssystem besser steuern zu können. Bereits in der Pilotversion von 2006 war vom «Fernziel einer evidenzbasierten Bildungspolitik» (S. 195) die Rede. Der Begriff suggeriert, es sei möglich, politische Entscheidungen ausschliesslich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen und die Bildungspolitik gleichsam in die Hände der Bildungsforschung zu legen. Diese völlig verquere Erwartung zeigt, wie notwendig es ist, dass sich in der Bildungspolitik ein Verständnis von wissenschaftlicher Forschung entwickelt, das deren Funktion und Leistung besser gerecht wird.
Der Begriff (evidenzbasierte Bildungspolitik) suggeriert, es sei möglich, politische Entscheidungen ausschliesslich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen und die Bildungspolitik gleichsam in die Hände der Bildungsforschung zu legen.
Das heisst nicht, dass die Bildungspolitik wissenschaftliche Erkenntnisse nicht berücksichtigen soll. Verfehlt ist nicht der Einbezug von Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung, sondern die Erwartung, die Wissenschaft könne der Politik abnehmen, was ihre eigentliche Aufgabe darstellt, nämlich Entscheidungen zu treffen.
Mehrheit vor Wahrheit

Das gilt insbesondere für eine Politik, die auf demokratische Legitimation angewiesen ist. Wenn Demokratie nach einer treffenden Formulierung von Hermann Lübbe (2004) Mehrheit statt Wahrheit bedeutet, dann zeigt sich, dass eine «evidenzbasierte Politik» in einer demokratischen Gesellschaft grundsätzlich verfehlt ist. Denn gäbe es tatsächlich so etwas wie unbezweifelbare wissenschaftliche Erkenntnisse, dann wäre für demokratische Entscheidungen schlicht kein Platz mehr. Aus der Herrschaft des Volkes (Demokratie) würde eine Herrschaft der Wissenschaft (Scientokratie).
Zwar könnte gerade die Corona-Krise den Eindruck erwecken, als hätten in einigen Ländern Virologen und Epidemiologen die Herrschaft übernommen. Es ist aber auch klar, dass in einem demokratischen Land wie der Schweiz die politischen Mechanismen nach kurzer Schockstarre rasch wieder zu spielen begannen und selbst aus der Wissenschaft Stimmen zu hören waren, die verhinderten, dass die politischen Behörden ihre Entscheidungskompetenz aus der Hand gaben. Wissenschaftliche Wahrheit und politische Verantwortung sind zwei verschiedene Dinge, die wir nicht nur ideell, sondern auch institutionell getrennt halten sollten.
Lübbe (2004) gibt zudem zu bedenken, dass mit der Verwissenschaftlichung unseres Alltagslebens demokratische Entscheidungsprozesse nicht weniger, sondern mehr an Bedeutung gewinnen. Denn die Vielfalt an Wissen, die durch die wissenschaftliche Forschung erzeugt wird, eröffnet Handlungsoptionen, zwischen denen nicht ihrerseits durch Wissen entschieden werden kann. «Je wissenschaftsabhängiger wir leben, um so mehr gewinnt die Mehrheit Geltungsvorrang gegenüber der Wahrheit» (S. 160). Substanzielle Weichenstellungen im Bildungswesen der öffentlichen Entscheidungsfindung zu entziehen, indem man sie als wissenschaftlich unumgänglich darstellt, kommt somit einem Angriff auf unsere demokratischen Institutionen gleich.
Wahrheit als regulative Idee

Selbst in der Wissenschaft spielt die Wahrheit lediglich die Funktion einer regulativen Idee. Wie Niklas Luhmann (1992) deutlich macht, liegt in der Wahrheit zwar das Kommunikationsmedium der Wissenschaft, mit dem sie innerhalb der Gesellschaft auf sich aufmerksam machen kann. Sie stellt aber kein Ziel dar, das im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit angestrebt wird. Vielmehr fungiert die Wahrheit als Unruhestifterin, die einer Disziplin ermöglicht, vermeintlich unbestreitbare Tatsachen im Prinzip jederzeit in Zweifel zu ziehen. Dies nicht aus schierer Oppositionslust, sondern weil Argumente vorliegen, die ein Forschungsergebnis in seiner Gültigkeit begrenzen oder in seiner Reichweite schmälern.
Allenfalls mögen wir uns der Wahrheit annähern, aber auch dabei müssten wir eingestehen, dass wir faktisch über keine Mittel verfügen, um zu entscheiden, wie nahe wir der Wahrheit schon gekommen sind.
Auch wenn wir dem Wissenschaftstheoretiker Karl Popper (1963) folgen, stellt die Wahrheit kein Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit dar, da wir gar nicht in der Lage wären festzustellen, ob zwischen unserer Erkenntnis und der Wirklichkeit eine Übereinstimmung besteht. Allenfalls mögen wir uns der Wahrheit annähern, aber auch dabei müssten wir eingestehen, dass wir faktisch über keine Mittel verfügen, um zu entscheiden, wie nahe wir der Wahrheit schon gekommen sind. Es gibt keine «wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse», wie uns die Bildungspolitik weismachen will, in welcher Disziplin auch immer.
Weshalb es in der pädagogischen und pädagogisch-psychologischen Forschung keine abschliessenden Erkenntnisse gibt, möchte ich im Folgenden am Beispiel der Unterrichtsforschung ausführen. Dazu unterscheide ich drei Forschungsparadigmen, die ich mit ‹Experiment›, ‹Statistik› und ‹Fallstudie› bezeichne. Die Unterscheidung hat idealtypischen Charakter, ermöglicht es aber, die Methoden und die Leistungsfähigkeit der Unterrichtsforschung anschaulich darzustellen.
Im zweiten Teil meines Beitrags werde ich mich der experimentellen Forschung und im dritten Teil der Statistik als Forschungsmodell zuwenden. Im vierten und abschliessenden Teil wird es um die Fallstudie gehen. Abrunden werde ich meine Ausführungen mit einem kurzen Resümee.
Literaturverzeichnis
Bildungsbericht Schweiz 2006. Hrsg. von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). Aarau: SKBF.
Bildungsbericht Schweiz 2014. Hrsg. von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). Aarau: SKBF.
Lübbe, Hermann (2004). Mehrheit statt Wahrheit. Über Demokratisierungszwänge. In: Ders.: Modernisierungsgewinner. Religion, Geschichtssinn, Direkte Demokratie und Moral (S. 154-166). München: Fink.
Luhmann, Niklas (1992). Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Popper, Karl R. (1963). Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul.