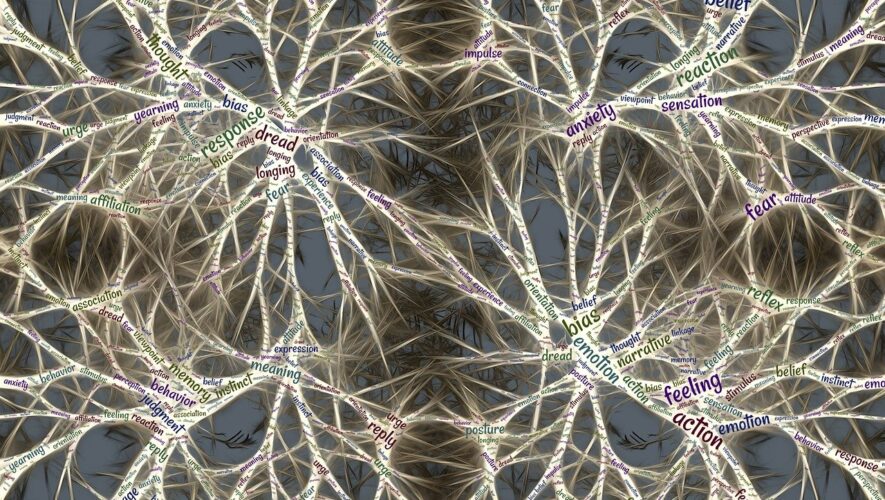Die Coronakrise und mit ihr das aufgezwungene Homeschooling haben der Diskussion rund um die Digitalisierung der Schulen einen enormen Auftrieb gegeben. So schreibt Nils Pfändler in der NZZ: «Die Ausnahmesituation hat der Digitalisierung des Schulbetriebs den Schub verliehen, auf den das Bildungswesen jahrzehntelang gewartet hat».[1] Der Titel eines Artikels von Sandrine Gehriger in der NZZ am Sonntag lautet: «Wie die Corona-Epidemie die Schweizer Schulen in kurzer Zeit zukunftsfähig gemacht hat»[2].
Das Unbehagen
Warum löst diese in einer enormen Krise aufgezwungene Digitalisierung trotz des plötzlich eingelösten Versprechens einer zukunftsfähigen Schule dennoch Unbehagen aus? Warum haben wir die gemäss Pfändler wichtige Transformation des Bildungswesens nicht längst realisiert? Es liegt wohl nicht in erster Linie daran, dass die Budgets nicht gesprochen wurden, die Technologien nicht ausgefeilt genug wären oder die digitalen Lehrmittel fehlten. Es gibt genügend Anbieter, die schon lange bereitstehen, um die Digitalisierung der Schullandschaft voranzutreiben und auch mit entsprechenden Slogans öffentlichkeitswirksam dafür werben. Woran liegt es dann?

Was kann dagegen einzuwenden sein, dass das Wissen von einer Lernsoftware digital aufbereitet, die Lernangebote personalisiert, die Aufgabenstellungen den Fähigkeiten unmittelbar angepasst werden und die Rückmeldungen stets prompt erfolgen?
Wer möchte zu jenen gehören, die den Anschluss verpassen, nicht auf die Zukunft vorbereitet sind, wer möchte nicht innovativ, vernetzt und agil sein?
Notwendigkeit als Argument
Vielleicht ist es genau diese geforderte Notwendigkeit der Digitalisierung des Bildungsbereichs, die dieses Unbehagen verursacht. Die Notwendigkeit wird in Bezug auf eine Welt formuliert, von der angenommen wird, dass sie sich zukünftig unseren Kindern in einer bestimmten, unausweichlichen, aber unbekannten Form präsentieren wird. Eine Welt, für welche die Kinder gewappnet sein sollen.
Das Besondere daran ist, dass wir, die Erwachsenen von heute, Prozesse, die in die Zukunft hineinwirken, initiiert haben, die wir nicht beenden und deren Auswirkungen wir nicht kontrollieren können, weil wir sie nicht kennen.
Damit mitgemeint ist, dass der Mensch nicht mehr in der Lage sei, diese Zukunft selbst zu bauen; zu gestalten im Hinblick darauf, wie wir uns diese wünschen und was wir in Bezug darauf tun wollen und sollen. Es wird suggeriert, diese rolle quasi auf uns zu. Das Besondere daran ist, dass wir, die Erwachsenen von heute, Prozesse, die in die Zukunft hineinwirken, initiiert haben, die wir nicht beenden und deren Auswirkungen wir nicht kontrollieren können, weil wir sie nicht kennen. Früher hatte es die Technik den Generationen ermöglicht, die Welt zu gestalten, indem sie Dinge hergestellt haben, die ein Menschenleben zwar oft überdauerten, dennoch aber grundsätzlich auch zerstört und damit rückgängig gemacht werden konnten. Heute stehen wir vor der Tatsache, dass die Technik der Digitalisierung Entwicklungen in Gang gesetzt hat, die kontinuierlich weiterwirken, sich verselbstständigen und selbstreferenziell weiterentwickeln.

Damit bestimmen die Prozesse unser Handeln, nicht umgekehrt. Womit sich die Frage stellt, ob der Begriff Handeln überhaupt noch der passende ist und ob nicht reagieren, sich anpassen oder sogar unterwerfen angemessener wären.
Unaufhaltsamkeit der Technologisierung
Das Interessante daran ist, dass der Mensch immer Naturprozessen ausgesetzt war, gegen die er sich zu schützen versuchte – die Covid-19-Pandemie ist ein aktuelles Beispiel dafür – ; heute aber ist er auch sich verselbstständigenden Technikprozessen ausgesetzt durch lernende Software und damit der Erschaffung künstlicher Intelligenz.
Es stellt sich die Frage, wie viele Daten aus welchen Bereichen gesammelt werden dürfen und welche Entscheide in welchen Lebensbereichen wir Algorithmen und selbstlernender Software überlassen wollen.
Und wie er sich dagegen schützen soll, wovon er sich so viel Fortschritt erhoffte, ist nicht klar. Dabei stellt sich, neben ganz verschiedenen ethischen Fragen, die sich mit einzelnen Phänomenen der Digitalisierung befassen, die ganz grundlegende Frage, ob es ethisch vertretbar ist, Technologien einzuschränken oder zu stoppen, die Innovationen, welcher Art und in welcher Form auch immer, bringen – und was das kosten darf. Also wie viele Daten aus welchen Bereichen gesammelt werden dürfen und welche Entscheide in welchen Lebensbereichen wir Algorithmen und selbstlernender Software überlassen wollen. Diese Fragen der Ethik gehen nun weit über jene Fragen hinaus, die das Handeln der Menschen und ihr Sein thematisieren und dabei ein gewisses Mass an potentieller Freiheit miteinschliessen. Denn plötzlich ist auch das Entscheiden von Maschinen möglich geworden. Diese ethischen Fragen stellen sich im Rahmen des rasanten Fortschreitens der Möglichkeiten der Technologien immer gleichzeitig zur Entwicklung, was eine ganz neue Herausforderung darstellt.
Diese Ausführungen sollen aufzeigen, dass die Frage nach der Notwendigkeit der Digitalisierung und der sich daraus ergebenden ethischen Fragen hochkomplex sind.
Notwendigkeit bildet keine Entscheidungsgrundlage
Schule unter dem Diktat der Notwendigkeit
Was hat das nun mit der geforderten Notwendigkeit der Digitalisierung von Schulen zu tun? Wenn die Zukunft möglicherweise eine digitale Transformation fast aller Lebensbereiche bringt, was wir nicht wissen, so liegt die Antwort darauf nicht in der Notwendigkeit einer Vorwegnahme dieser Entwicklung an der Schule. Eine drohende Vereinnahmung des menschlichen Daseins durch die Digitalisierung kann nicht reflektiert werden durch eine Übernahme desselben Prozesses an den Schulen. Notwendigkeit bildet deshalb aus zweierlei Hinsicht keine Entscheidungsgrundlage für einen Paradigmenwechsel an Bildungsinstitutionen. Einerseits beruht eine geforderte Notwendigkeit darauf, dass wir davon ausgehen, dass die Geschichte einen Verlauf nimmt, den wir an sich nicht beeinflussen können und dass die Schule als Institution jener Ort sein soll, der diesen Verlauf antizipieren soll. Andererseits kann Notwendigkeit nicht zu einer Leitidee für Schulen werden, weil die Schule – wenn sie neben der Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Erziehung zur Mündigkeit und damit zur Urteilsfähigkeit verfolgen will – auch ein Ort des gemeinsamen Nachdenkens, Diskutierens, Abwägens und Argumentierens sein sollte. Allein darin lernt der Mensch, sich in einen Bezug zur Welt und zu den anderen zu setzen, und wird dabei der Freiräume des Handelns und Denkens gewahr. Wenn Mittel und Zweck von Schule als Bildungsinstitution darin zusammenfallen, dass sie sich an Notwendigkeiten orientieren, dann verliert diese Schule ihre gesellschaftliche Aufgabe und ihren Sinn.
Das Räsonieren schafft einen Raum zwischen den Menschen, in dem die Freiheit wirklich ist[3]

Form und Inhalt nicht zusammenfassen
Der Einsatz digitaler Medien kann situationsabhängig durchaus sinnvoll sein, genauso wie das Programmieren als Lerninhalt, so wie die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Gefahren der Digitalisierung durchaus ihre Berechtigung haben kann. Wenn aber die Form der Vermittlung mit dem Inhalt zusammenfällt, geht jene Distanz verloren, die es braucht, um sich mit der Welt auseinanderzusetzen und diese zu verstehen.
Wenn Kinder und Jugendliche, mit einem Tablet ausgerüstet, individuell hinter dem Bildschirm ihre personalisierten Themen mit adaptiven Aufgabestellungen abarbeiten und ihre sofortigen, automatisierten Rückmeldungen erhalten, während die Lehrerin oder der Lehrer nur noch online kontrolliert, ob alle etwas tun, oder hilft, wenn das WLAN oder das Login der Software nicht funktionieren; wenn das soziale Lernen nur noch das gegenseitige Helfen bei Schwierigkeiten mit den Aufgabenstellungen oder mit der Hardware meint, und wenn die Selbstkompetenz vor allem darin besteht, sich nicht von anderen Möglichkeiten, welche das Tablet auch noch bietet, ablenken zu lassen und eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln, wenn die unmittelbare Belohnung durch eine positive Rückmeldung des Systems ausbleibt, dann stellt sich die Frage, was die Schule überhaupt noch repräsentiert ausser jenen Ort, an welchem diese Geräte bedient werden – Lehrerinnen und Lehrer, welche das Wissen in ihren Köpfen aufbewahren, weitergeben und reflektieren, sind dann überflüssig.
Über Fragen der Notwendigkeit von Entwicklungen und über ethische Fragen kann der Mensch nur nachdenken, solange er Entwicklungen nicht als naturgegeben anschaut, welchen er sich anzupassen hat, sondern noch Platz lässt für Sollen, Wollen und Können und damit eine geteilte Welt, die einen Gestaltungsraum offenlässt. Die Voraussetzungen dafür kann die Schule als Ort der Kultur- und Wissensvermittlung zwischen einer älteren und einer jüngeren Generation und im Kollektiv von Gleichaltrigen, wo auch Zivilität eingeübt wird, leisten, und dies macht auch ihren Sinn aus. Keine Maschine kann das übernehmen, im Gegenteil, sie schaffen diesen Sinn ab.
[1] Pfändler, N. (2020, April 7). Die Schule erhält einen digitalen Schub. Neue Zürcher Zeitung, S. 10.
[2] Gehringer, S. (2020, April 24). Wie die Corona-Epidemie die Schweizer Schulen in kurzer Zeit zukunftsfähig gemacht hat. Neue Zürcher Zeitung. Abgerufen von https://www.nzz.ch…
[3] Arendt, H. (2012). Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I. München und Zürich: Piper, S. 205
[4] Arendt, H. (2012). Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I. München und Zürich: Piper, S. 205
[5] Nida-Rümelin, J. & Zierer, K. (2020, Juni 8). Die Debatte über die digitale Bildung ist entgleist. Neue Zürcher Zeitung, S.8