
Es ist schwierig, bei den Themen Schulreformen und vor allem bei der Fremdsprachenreform Haltung und Anstand zu bewahren. Auch Rechthaberei, verbunden mit einem gerüttelten Mass an «Klugscheissertum», drohen dem Autor dieser Zeilen, wenn er die jüngste Geschichte der bildungsbürokratischen Segnungen an sich vorbeiziehen lässt und dabei auch seinen eigenen Einsatz gegen diesen «Amoklauf im dummschweizerischen Bildungsmassiv» (so ein Bund-Artikel des Autors, 2014) reflektiert. In der Berner Zeitung (2012) bot ich dem damaligen Bildungsdirektor Pulver eine Wette an. Frühfranzösisch werde ein monumentaler Flop, behauptete ich damals, nicht ohne Grundlagen. Ich zitierte mehrere Studien mit Quellen, und auch die Erfahrungen unseres nördlichen Nachbarlandes mit Frühenglisch («Frühenglisch ist ein Murks», Spiegel 2011) liess ich dem Magistraten zukommen. Der Bildungsdirektor ging nicht auf die Wette ein.
Frühfranzösisch war ein Amoklauf im dummschweizerischen Bildungsmassiv.
Zu allem Übel noch diese Mehrsprachendidaktik
Als dann noch die Mehrsprachendidaktik in Form der Passepartout-Lehrmittel folgte, mit all den Nachfolgeinvestitionen, verfasste ich in der Berner Zeitung 2015 einen ersten Erfahrungsbericht eines ratlosen Französischlehrers:
«Es war für mich ernüchternd, als ich feststellte, dass die Schüler nicht wussten, dass man ‹au› als ‹o› ausspricht oder ‹ou› als ‹u›. Gestaunt habe ich, dass ich mit meinen SchülerInnen zwar komplexe Texte über Erfindungen der Zukunft (‹aéolienne géante›) lesen sollte, diese aber nicht wussten, was ‹gestern›, ‹heute› und ‹morgen› auf Französisch heisst (wohlgemerkt, nicht schriftlich, sondern mündlich).»
Ich bekannte mich zu einem geordneten Aufbau der Sprache und kündigte an, der Didaktik dieses Lehrmittels nicht zu folgen. Am Schluss schrieb ich: «Ich lade die AutorInnen zu einem Unterrichtsbesuch ein und stelle mich jeder Evaluation.» Selbstredend kam es nie zu einem Unterrichtsbesuch.

Bild: Uni Basel
Die Evaluationen kamen, knüppeldick
Die Evaluationen hingegen kamen, und zwar knüppeldick. Die Lehrmittelreihe fiel in allen relevanten unabhängigen Untersuchungen völlig durch. Und Georges Lüdi, ein glühender Vertreter des Frühfremdsprachenerwerbs, bekannte: «Internationale Studien haben in der Tat nachgewiesen, dass innerhalb des klassischen Fremdsprachenunterrichts ‹Frühstarter› am Schluss der Schulzeit ohne zusätzliche Massnahmen bezüglich ihrer Sprachkompetenzen kaum mehr messbare Vorteile haben». (Babylon, Oktober 2018)
100 Millionen Franken in den Sand gesetzt
100 Millionen Franken hat uns dieser Spass gekostet. Gelder, die man in den Spracherwerb in Asylheimen, in die Ausbildung von Heilpädagoginnen oder direkt in die Bekämpfung des Illetrismus hätte investieren können. «100 Millionen Franken in den Sand gesetzt», würde es bei einer Privatinvestition eines Unternehmens heissen.
Beschimpfungen habe ich schön aufbewahrt
Meine Mitstreiter und ich gingen vorher durch ein Bad der Verunglimpfungen. In meiner Mailbox sind – gut aufbewahrt – alle Beschimpfungen und hämischen Bemerkungen fein säuberlich gespeichert, die ich in den vergangenen Jahren erhalte habe.
Die Verteidiger sind verstummt

Die Protagonisten des frühen Fremdsprachenunterrichts und der Mehrsprachendidaktik wollen allerdings von ihren damaligen Voten nichts mehr wissen. «Die Verteidiger von ‹Mille feuilles› sind verstummt», schrieb der Journalist von Bergen am 20. Dezember 2019 in der Berner Zeitung. Reto Furter, bis 2018 Projektleiter für das Lehrmittel «Passepartout», ist heute Verantwortlicher für die Bereiche obligatorische Schule, Kultur und Sport bei der Erziehungsdirektorenkonferenz. Auf Anfrage erklärt er, er wolle sich in seiner neuen Funktion nicht mehr zum Lehrmittel äussern. Und Bernhard Pulver meinte gegenüber der Berner Zeitung: «Als Alt-Regierungsrat will ich heute zu aktuellen politischen Debatten nicht mehr Stellung nehmen.»
Die Karawane zieht weiter: Obligatorischer Sprachaustausch heisst das neue Zauberwort
Im Prinzip könnte das Beispiel dieser beiden Herren auch ein vorbildliches Leitmotiv für die heutigen selbsternannten Bildungspolitiker sein: Einfach mal die Klappe halten!

Doch weit gefehlt, die Karawane zieht weiter und Politiker wollen nun eben mal gestalten, und die desavouierten Dozenten, Kursanbieter und Fremdsprachenexperten suchen neue Einkommensquellen und Beschäftigungsfelder. Gestreng nach dem Sponti-Motto: «Wenn wir etwas vorschlagen und es nicht klappt, versuchen wir was Neues, vielleicht klappt es ja auch nicht,” vernimmt man aus den Politsälen des Landes beunruhigende Voten. Assistiert werden sie durch eine «newsorientierte» Presse, welche jeden Reformgedanken weiterhin aufsaugt und ihn unreflektiert wiedergibt. Schon 2014 forderte der NZZ-Journalist Andreas Diethelm einen obligatorischen Sprachaustausch für jeden Schweizer Schüler. Letztes Jahr postulierte der frühere Chefredakteur der Tribune de Lausanne, Peter Rothenbühler, in der Basellandschaftlichen Zeitung ebenfalls einen obligatorischen Sprachaustausch (Oktober 2019). Und das Migros-Magazin kürte den Studenten Christian Siegenthaler in einem Wettbewerb mit dem vielsagenden Namen «Wunschschloss» zum Preisträger 2019 für die innovativste Idee. Er forderte – dreimal dürfen Sie raten – einen obligatorischen Schüleraustausch zwischen den Landesteilen.
Natürlich darf jetzt auch die Politik nicht fehlen. Neu gewählte Nationalrätinnen aus allen Parteien wollen – keine Überraschung – einen obligatorischen Sprachaustausch der SchülerInnen unseres Landes fördern. Der Bund, so eine Nationalrätin, müsse jetzt endlich vorwärts machen. Im Dezember 2019 verlangte Martin Rufer (FDP) im Solothurner Kantonsparlament, dass die Französischkompetenzen der Volksschüler verbessert und der Sprachaustausch gefördert werden sollten. Und der Regierungsrat erklärte eilfertig, dass er sich der Wichtigkeit von Austauschprojekten bewusst sei. Es seien bereits Schritte zur Förderung solcher Aktivitäten unternommen worden. Der stets euphorische Tagesanzeiger schliesslich beklagte: Nur 2 % der Schüler machen einen Sprachaustausch. Das Ziel müsse aber 100% sein (13.5.19).
Es bedarf wohl keiner grossen Phantasie, sich vorzustellen, wie rasch es gehen wird, bis die ersten Fachgremien gebildet, die ersten Kredite gesprochen, die ersten Grosskonzepte geschrieben sind.
Sprachaustausch ist ein Gewinn, aber schwierig zu organisieren

Damit keine Missverständnisse entstehen. Der Autor dieser Zeilen hält sehr viel von Sprachaustauschen. Er pflegt Kontakte zu Genfer Partnerklassen, führt gemeinsame Skilager mit französischsprachigen Klassen durch und plant seine Abschlussreisen des Öfteren in Südfrankreich. Vor allem aber installierte er an seiner Schule, dem OSZ-Orpund, den traditionellen Sprachaustausch mit den französischsprachigen Walliser Schulen. Vier Tage verbringen unsere Schüler bei ihren welschen Kollegen und beherbergen diese ebenso lange bei sich. Ausserdem besuchen sie jeweils den Unterricht in den beiden Schulen, schreiben sich vorher mehrere Briefe und absolvieren zu zweit einen Postenlauf. An einem Samstag im Januar fahren die Eltern mit ihren Zöglingen und den Lehrkräften ins Wallis, wo sie von den Eltern ihrer Partnerkinder empfangen werden. Dies ist ein grosser Anlass, der die Leute zusammenbringt. Auch wir Lehrkräfte kennen uns mittlerweile und freuen uns schon jetzt auf das Wiedersehen. In wenigen Fällen geht dieser Austausch schief, in den meisten profitieren unsere Lernenden aber ungemein von diesen Begegnungen. Und manchmal entstehen sogar Freundschaften fürs Leben, gehen die Familien zum Beispiel gemeinsam in die Skiferien.
Austausch ist Knochenarbeit und bedeutet einen grossen Zeitaufwand
Was hier wie ein Werbeprospekt tönt, ist in Wirklichkeit Knochenarbeit. Deshalb empfehle ich den praxisfernen Gestaltern dringend, sich vorerst einmal mit den immensen Vorbereitungen unseres Austausch-Verantwortlichen an unserer Schule zu beschäftigen.
«Mein Sohn hat mit ‹Mille Feuilles› so wenig Französisch gelernt, dass ich ihm diese Erfahrung ersparen möchte.»

In beiden Sprachregionen beteiligen sich trotz intensiver Werbung lediglich 50% – 70% an diesem Austausch, Tendenz sinkend. Es gibt Familien, denen man eine Austauschschülerin nicht anvertrauen kann. Es kommt immer mehr zu angsterfüllten Panikabsagen, Spezialwünschen und kurzfristigen Abmeldungen. Die Abmeldung einer Mutter lässt tief blicken: «Mein Sohn hat mit ‹Mille Feuilles› so wenig Französisch gelernt, dass ich ihm diese Erfahrung ersparen möchte.» Auch religiöse Bedenken muslimischer Familien stellen oft ein Hindernis dar. Selbst im zweisprachigen Biel ist es nie gelungen, einen solchen Austausch voranzutreiben. Eine Schulleiterin der Oberstufe meinte: «Bei uns lassen die sozialen Verhältnisse einen solchen Austausch in vielen Fällen gar nicht zu. Und wir haben hier andere Probleme, wie z. B. das Erlernen und Beherrschen von Deutsch.»
Die organisatorischen Vorbereitungen sind gewaltig und die Reibungsflächen nehmen zu. Es kommt auch zu Abmeldungen von Schulen, die sich an dem Austausch nicht mehr beteiligen wollen.
Gesamtschweizerischer obligatorischer Sprachaufenthalt ist Wunschprosa in Reinform.
Trotzdem möchten wir dieses Projekt nicht missen. Es ist für uns ein wirkungsmächtiger und herzerwärmender Anlass, der neben dem Spracherwerb viele weitere positive Effekte für die Reifung der Persönlichkeiten hervorbringt.
Bitte keine Masterpläne mehr
Ein gesamtschweizerischer obligatorischer Sprachaustausch ist Wunschprosa in Reinform. Bitte keine Masterpläne mehr. Stattdessen sollte man die bereits bestehenden Projekte fördern, den Praktikern zuhören, sich für ihre Arbeit interessieren und sie in eine eventuelle Ausweitung des Sprachaustausch-Gedankens einbeziehen. Und ansonsten einfach mal die Klappe halten.




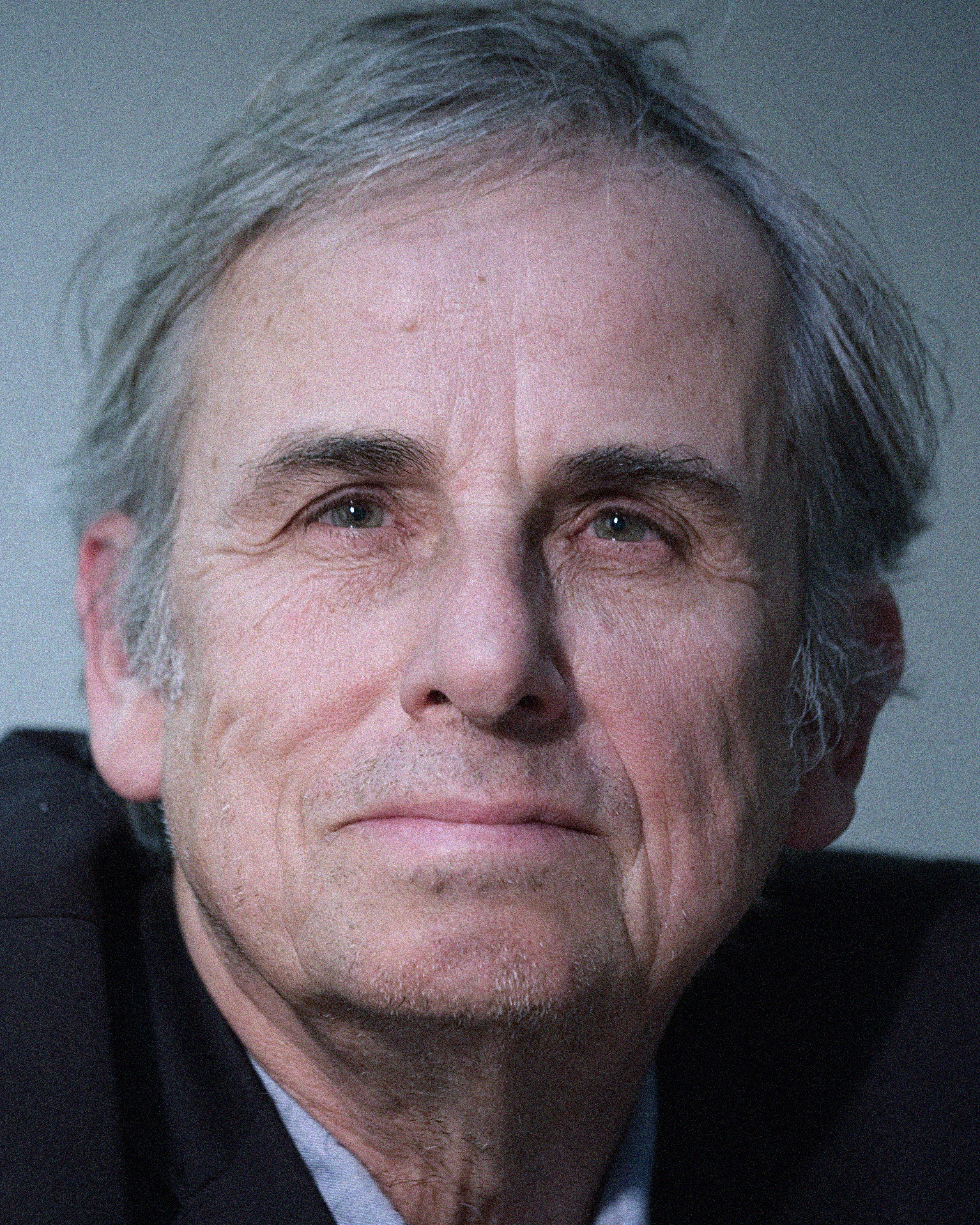


Sie schreiben “Schon 2014 forderte der NZZ-Journalist Andreas Diethelm einen obligatorischen Sprachaustausch für jeden Schweizer Schüler.”
Dass dies nicht möglich ist, versteht sich von selbst, dieser Aspekt ist im NZZ-Beitrag leider dem knappen Platz zu Opfer gefallen.
Am 29.10.14 schrieb ich in der BAZ:
“Freilich gestaltet sich der Unterricht generell
und ein Schüleraustausch erst recht bei der
heutigen Kultur- und Sprachenvielfalt im
Klassenzimmer ungleich schwieriger als noch vor
dreissig Jahren. Man kann nun schulterzuckend
beklagen, die Chance sei nun eben verpasst,
denn es wäre kaum realistisch, alle an solchen
Programmen beteiligen zu wollen. Nun braucht
der Erwerb einer zweiten Landessprache an der
Volksschule ja nicht für alle obligatorisch zu sein,
viele sind ja bereits dabei, eine zweite Muttersprache
zu lernen, eine Leistung die genauso
Würdigung verdient.”
Meine Forderung: Jede/r Schüler/in die welche/r Unterricht in einer zweiten Landessprache erhält, muss auch die Möglichkeit eines Sprachaufenthalts erhalten. Aber nicht jedes Kind soll zum Erwerb einer zweiten Landessprache gezwungen werden.
FG ADiethelm