«Kann das sein?» Diese einfache Frage legte der geschätzte, mittlerweile pensionierte 5./6.-Klassenlehrer unseren Kindern ans Herz – nicht nur im Mathematikunterricht.

Dieselbe Frage stelle ich mir regelmässig. Insbesondere dann, wenn sich «Bildungsexperten» auf evidenzbasierte Forschungsergebnisse berufen und bspw. behaupten, Studien würden zweifelsfrei belegen, dass sich die Integrative Schule auf alle Beteiligten ausschliesslich positiv auswirke. Der Befund einer breit angelegten Metastudie aus dem Jahr 2022, wonach weder hinsichtlich Leistung noch Diskriminierung ein Nachteil für separativ beschulte Kinder mit besonderem Bildungsbedarf bestehe, wird gänzlich ausgeblendet. Die nachgewiesenen schweren Mängel (nicht randomisiert, «biased», methodisch fragwürdig) vieler dabei untersuchten Einzelstudien ebenfalls.
Die von John Hattie erstellte Rangordnung in Form von Effektivitäts-Barometern, die u.a. auf einer nicht statthaften Gleichsetzung von Korrelation und Kausalität beruhen, bescherten der Schulentwicklungsindustrie lukrative Aufträge und den Kollegien zeitintensive schulinterne Fortbildungen oft zweifelhaften Inhalts. In einem SPIEGEL-Interview gab Hattie kürzlich zu Protokoll, er habe den Eindruck, seine Studienergebnisse seien missinterpretiert worden.
Unter Schweizer Forschenden erfreut sich das Konzept des «Selbstregulierten Lernens» – kurz SRL – derzeit grosser Beliebtheit. Hochschulexponenten sind davon überzeugt, dass bereits jüngere Kinder über ein hohes Mass an metakognitiven Fähigkeiten wie Selbstdisziplin, Selbstreflexion und Eigenverantwortung verfügen, was ihnen erlaube, selbstreguliert zu lernen – vorausgesetzt, die Lehrpersonen würden es auf der Grundlage von Theorie und Empirie richtig machen. Der hochdekorierte Neuropsychologe Lutz Jäncke hingegen, zu dem einen Prozent der weltweit meistzitierten Wissenschaftler gehörend, erläuterte in seinem Referat an der letzten LVB-DV, wie der Frontalkortex spät reift und Kinder und Jugendliche den Impulsen aus den Tiefen des limbischen System noch wenig entgegenzusetzen haben.
Bekanntlich ist ein von unten falsch geknöpftes Hemd auch oben falsch geknöpft. Fehlerbehaftete Datenerhebungen führen zwangsläufig zu verfälschten Auswertungsresultaten – und, schlimmer noch, zu falschen Rückschlüssen und politischen Entscheiden, «untermauert» mit beeindruckend wirkenden Statistiken und farbigen Balkendiagrammen. Alles im Namen der Evidenz.
Designfehler, Missinterpretationen, Simplifizierung, gegenteilige Befunde – alles Realitäten, die uns in Erinnerung rufen, dass Geistes- und Sozialwissenschaften keine exakten Wissenschaften sind.
Den jüngsten Vogel der Gattung «Empiricus inexactus» haben die Verantwortlichen der vierkantonalen Checks abgeschossen. Dank der Überzeugungsarbeit des LVB hätten diese im Bereich Schreiben heuer erstmals an einheitlichen Terminen durchgeführt werden sollen. Im Baselbiet hat das nicht einmal annähernd funktioniert. An manchen Sekundarschulen wurden Checks bis zu elf Tage früher durchgeführt als an anderen. In der Folge wurden die unverändert bleibenden Aufgabenstellungen von Lernenden rege geteilt, etwa in WhatsApp-Gruppen, im Sporttraining etc. Im Zeitalter von ChatGPT, Perplexity und Co. war es ein Leichtes, die Aufgaben 1:1 zu prompten, die entsprechende Fremdsprache samt Sprachniveau auszuwählen und den durch KI in Sekundenschnelle erstellten Text auswendig zu lernen. Bei einer Textlänge von lediglich 80 bis 120 Wörtern ein Kinderspiel.
Bekanntlich ist ein von unten falsch geknöpftes Hemd auch oben falsch geknöpft. Fehlerbehaftete Datenerhebungen führen zwangsläufig zu verfälschten Auswertungsresultaten – und, schlimmer noch, zu falschen Rückschlüssen und politischen Entscheiden, «untermauert» mit beeindruckend wirkenden Statistiken und farbigen Balkendiagrammen. Alles im Namen der Evidenz.
Umsichtige Erziehungswissenschaftler sind sich der Grenzen der Bildungsforschung bewusst und plädieren deshalb für einen sorgsamen Umgang mit der sogenannten Empirie – ganz im Geiste von Nietzsches Leitspruch, wonach jedes Sehen perspektivisch sei.
Ihnen, liebe Praktikerinnen und Praktiker, lege ich ans Herz, empirisch «belegte» Befunde nicht einfach für bare Münze zu nehmen. Schauen Sie genau hin, prüfen Sie die Theorie auf deren Schulalltagstauglichkeit – und stellen Sie sich immer wieder die Frage: «Kann das sein?»
Dieser Artikel erschien zuerst in der März-Ausgabe des «lvb inform», der Verbandszeitschrift des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland LVB





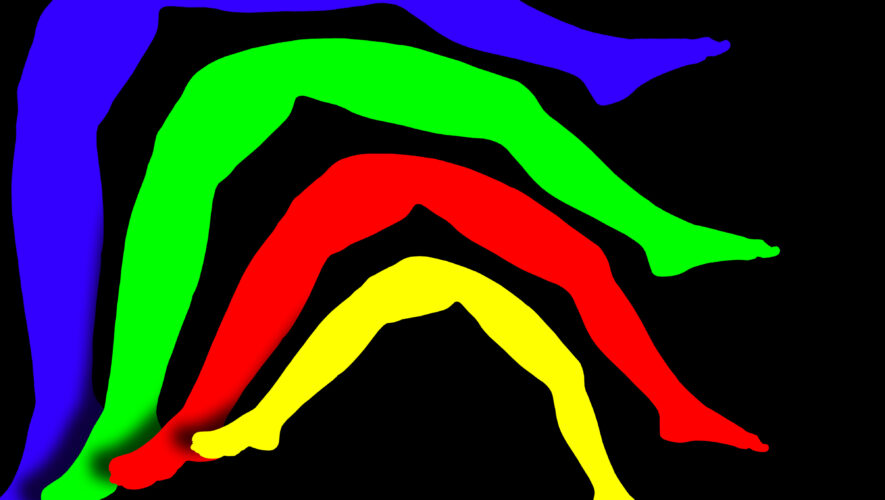

Vor allem kommt ein von oben her geknüpftes Hemd unten auch falsch an, nichts passt, alles ist verzogen. Und so läuft es doch – oben wird falsch geknüpft, erzählt wird aber allen, es müsse so sein. Wird es offensichtlich, dass falsch geknüpft worden ist, so bemüht man bezahlte Knüpfexperten, die die Richtigkeit der Knüpferei bestätigen.
Erfrecht sich nun einer der Unteren, das falsch Geknüpfte zu lösen und neu zu knüpfen, so geht er das Risiko ein, selbst aufgeknüpft zu werden.