Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht mussten sich Gesellschaften neuen Realitäten stellen: Viele Kinder, deren Eltern Analphabeten waren, lernten mühelos lesen, schreiben und rechnen. Es konnte den Lehrern nicht entgehen, dass sich manches Kind aus einfachsten Verhältnissen sehr viel leichter mit dem Lernen tat als ein Kind aus privilegierten Ständen. Gleichzeitig gab es auch Kinder, die offensichtlich nicht in der Lage waren, die angebotenen schulischen Lerngelegenheiten gewinnbringend zu nutzen. Daraus ergaben sich zwei grundlegende Erkenntnisse, die die wissenschaftliche Intelligenzforschung bis heute prägen. Erstens kann man die Unterschiede im geistigen Potenzial nicht allein mit Unterschieden in den Förderangeboten erklären. Zweitens braucht es anregende Lerngelegenheiten, damit sich das kognitive Potenzial von Menschen in seiner ganzen Breite entfalten kann.

Veränderungen in der Bildungs- und Arbeitswelt erforderten Prognosen zum zukünftigen geistigen Potenzial von Menschen auf der Basis bestehender und messbarer Kompetenzen. Möchte man möglichst zuverlässig vorhersagen, wie gut jemand neue Anforderungen bewältigen kann, eignen sich Aufgaben zum schlussfolgernden Denken, wie sie in Intelligenztests gestellt werden.
Hier geht es beispielsweise darum, die Beziehung, die zwischen den Wörtern Wald und Bäume besteht, auf ein weiteres Wortpaar zu übertragen. Dabei ist der erste Begriff vorgegeben: Wiese. Hat man nun die Wahl zwischen Gräsern, Heu, Futter, Grün, Weide, so könnte man denken: Die gemeinsame Farbe von Wald, Bäume und Wiese ist Grün! Diese Wahl wäre aber falsch, da es nicht um die Gemeinsamkeit der drei Wörter geht, sondern um die Gemeinsamkeit der Beziehung zwischen den Wortpaaren. Dies zu erkennen, erfordert eine zusätzliche Abstraktionsstufe.
Wiese steht allerdings auch zu den anderen Begriffen in enger Beziehung und weckt vielleicht Erinnerungen an die Heuernte. Solche Überlegungen gehen aber ebenso in die falsche Richtung, da sie nichts mit der Beziehung zwischen Wald und Bäumen zu tun haben. Intelligente Menschen erkennen, dass Wald durch die Existenz von Bäumen definiert ist, so wie die Wiese durch die Existenz von Gräsern.
Die Herausforderung bei dieser Aufgabe besteht also darin, gewisse Assoziationen zu hemmen und die abstrakte Beziehung “wird definiert durch” zu aktivieren. Intelligenzaufgaben basieren auf Material, das allen bekannt ist, das aber unter einer neuen Perspektive verarbeitet werden muss. In dieser Art von schlussfolgerndem Denken unterscheiden sich Menschen sehr deutlich, wobei es keinen grossen Unterschied macht, ob sprachliche, numerische oder figurale Aufgabenformate vorgegeben werden.
In der Gehirnarchitektur angelegte Fähigkeiten
Aus den in einem Intelligenztest gelösten Aufgaben leitet man den Intelligenzquotienten (IQ) auf der Grundlage statistischer Überlegungen ab. Die Aufgaben werden einer grossen repräsentativen Bevölkerungsgruppe vorgegeben. Wer dem Durchschnitt entspricht, hat einen IQ von 100, und je nachdem, in welche Richtung und wie stark der Wert einer Person vom Mittelwert abweicht, steigt oder sinkt der IQ. Für mit der Statistik vertraute Leser/-innen: Intelligenzleistungen sind normalverteilt und der IQ wird in Standardabweichungen gemessen, typischerweise entsprechen 15 IQ-Punkte einer Standardabweichung.
Intelligenzunterschiede zwischen Menschen lassen sich mit grundlegenden Prozessen beim Problemlösen und beim zielgerichteten Handeln erklären. Man muss sein Gedächtnis nach brauchbarem Wissen absuchen und nicht zielführende Assoziationen hemmen. Ebenfalls muss man sich gegen Ablenkungen von aussen abschirmen, und gleichzeitig muss man das übergeordnete Ziel im Blick behalten, während man Teilaufgaben ausführt.
Eineiige Zwillinge stimmen in sehr hohem Masse in ihrer Intelligenzleistung überein, während es zwischen gleichgeschlechtlichen zweieiigen Zwillingen so grosse Abweichungen gibt wie zwischen Geschwistern, die sich im Alter unterscheiden.
Diese Fähigkeiten sind in der Architektur unseres Gehirns angelegt, und Unterschiede lassen sich durch Genvariationen erklären. Hier sprechen die Vergleiche zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen eine klare Sprache: Eineiige Zwillinge stimmen in sehr hohem Masse in ihrer Intelligenzleistung überein, während es zwischen gleichgeschlechtlichen zweieiigen Zwillingen so grosse Abweichungen gibt wie zwischen Geschwistern, die sich im Alter unterscheiden.
Genetische Unterschiede zwischen Menschen treten aber erst zutage, wenn diese die Gelegenheit bekommen, ihre geistige Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, und dabei spielt der Schulbesuch eine entscheidende Rolle. Das in Intelligenztests gemessene schlussfolgernde Denken setzt die Fähigkeit zum Lesen, Schreiben und Rechnen voraus sowie den Umgang mit abstrakten Ideen und logischen Erklärungen. Aber je besser die genetischen Voraussetzungen eines Menschen sind, umso besser kann er oder sie diese Lerngelegenheiten nutzen. Gleichzeitig zeigt sich: Wenn eine Umwelt geboten wird, die für die Intelligenzentwicklung förderlich ist, lassen sich Unterschiede in der Intelligenz auf Unterschiede in der Genetik zurückführen.
Intelligenztests können Erfolg vorhersagen
Es gilt als gesichert, dass Intelligenz polygenetisch vererbt wird, d.h. sehr viele Genvariationen, die wohl auch über das gesamte Genom verteilt sind, müssen zusammenwirken. Selbst wenn es eines Tages gelingen sollte – wovon wir derzeit noch meilenweit entfernt sind –, alle Genorte zu lokalisieren und die Genvariationen zu identifizieren, die zur Intelligenz beitragen, könnte man aus der DNA eines Menschen nicht zuverlässig auf seine Intelligenz schliessen, da diese sich aus der Interaktion von Genen und Umwelt entwickelt. Die grosse Zahl von Genen und ihren Variationen, von denen zudem angenommen wird, dass sie sich über alle Chromosomen verteilen, erklärt auch die grosse Variation der Intelligenz innerhalb von Familien.
Setzt sich dagegen die in entwickelten Ländern in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz fort, wonach im Zweifelsfall bei Bildungsentscheidungen wie dem Übergang zum Gymnasium eher die soziale Herkunft als die Intelligenz die berufliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bestimmt, wird dies nicht ohne Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft bleiben.
Sehr viele in unterschiedlichen Ländern durchgeführte Studien zeigen, dass die Leistung in Intelligenztests den Berufs- und Lebenserfolg gut vorhersagen kann. Intelligente Menschen sind innovativ, können Risiken besser abwägen und komplexe Zusammenhänge durchschauen. Gelingt es einer Gesellschaft, das Potenzial besonders intelligenter Menschen zu nutzen, kann sich die Lebensqualität für alle verbessern. Setzt sich dagegen die in entwickelten Ländern in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz fort, wonach im Zweifelsfall bei Bildungsentscheidungen wie dem Übergang zum Gymnasium eher die soziale Herkunft als die Intelligenz die berufliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bestimmt, wird dies nicht ohne Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft bleiben. Verantwortungsvolle Positionen müssen dann mit Menschen besetzt werden, die zwar das Bildungssystem durchlaufen haben, aber nicht ausreichend in der Lage sind, sich auf neue Situationen einzustellen.
Elsbeth Stern ist Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung und Leiterin des Instituts für Verhaltensforschung der ETH Zürich. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Intelligenzforschung, Kognitionspsychologie und Lehr-Lern-Forschung.


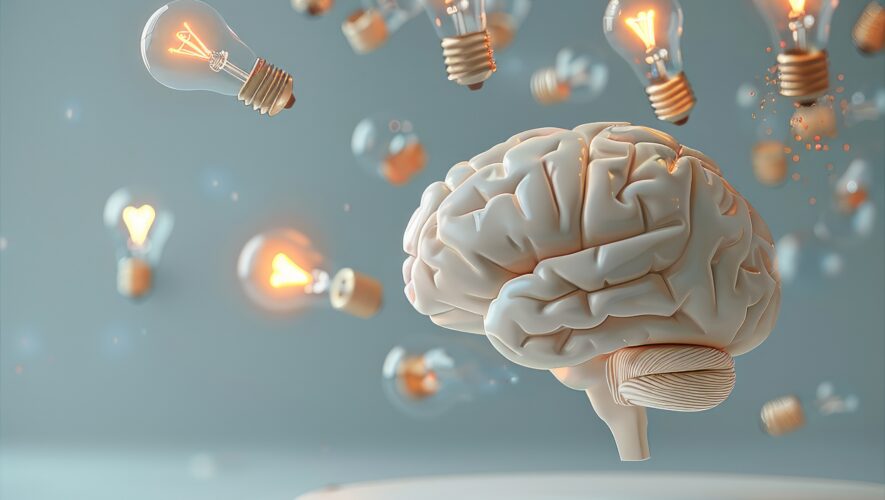




Obwohl ich generell die Ausführungen von Frau Stern sehr wichtig finde in einer Gesellschaft, die die Rolle von Intelligenz eher tabuisiert, so muss ich leider sagen, dass ich ihre letzten beiden Sätze oben als eine Anpassung an den Zeitgeist rot-grüner Schulpolitik empfinde.
Zum einen sehe ich es nicht als begründet an, dass die “verantwortungsvollen Positionen” in den genannten Gesellschaften mit Leuten besetzt sind, denen es an Intelligenz mangelt. Darunter wären ja herausgehobene und leitende Positionen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu verstehen. Was soll darauf hindeuten? Wir sehen ja sogar das Phänomen, dass organisierte Verbrecher bei ihrer Tätigkeit erstaunlich raffiniert vorgehen, was ohne Intelligenz nicht möglich sein dürfte. Da kann man auch an die berüchtigten Cum-Ex-Geschäfte denken.
Zum zweiten vermeidet Frau Stern konsequent die Diskussion eines (auch umstrittenen) Phänomens wie folgt:
“Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen IQ und Sozialschicht. Mitglieder der unteren Sozialschichten und deren Kinder erreichen auf standardisierten Intelligenztests einen niedrigeren IQ als Leute aus den oberen Sozialschichten und deren Kinder.” Quelle: Wikipedia
Umstritten ist dabei insbesondere, ob die üblichen Intelligenztests vielleicht die höheren sozialen Schichten begünstigen. Aber das könnte Frau Stern ja thematisieren und erläutern. Wenn sie es nicht tut, ergibt sich ein Paradoxon: Die Intelligenz korreliert mit der sozialen Schicht und mit dem Schul- und Lebenserfolg, wenn aber die beiden letzteren miteinander korrelieren, dann heißt es bei denen, die die “richtige” politische Einstellung haben: Das darf einfach nicht sein, das ist eine schreiende Bildungsungerechtigkeit !! Warum darf das nicht sein? Auch angesichts der von Frau Stern genannten “polygenetischen Vererbung” ist das eher plausibel als prinzipiell ungerecht.
Damit bestreite ich nicht Ungerechtigkeiten aller Art (gegenüber den einen oder auch den anderen) in einem solchen großen System mit seinen lokalen Besonderheiten und Traditionen, aber die Diskussion der in Deutschland angeblich bestehenden gigantischen Bildungsungerechtigkeit empfinde ich als verkrampft und Dogmen-beherrscht. Auch der erste Satz in dem obigen Artikel passt nicht dazu: Dass Kinder von Analphabeten mühelos lernen können, wird doch immer bestritten, gerade weil sie von ihren Eltern nicht “unterstützt” werden können. Das soll bei Beginn der allgemeinen Schulpflicht so anders gewesen sein? Das bedarf wohl noch einer Klärung.