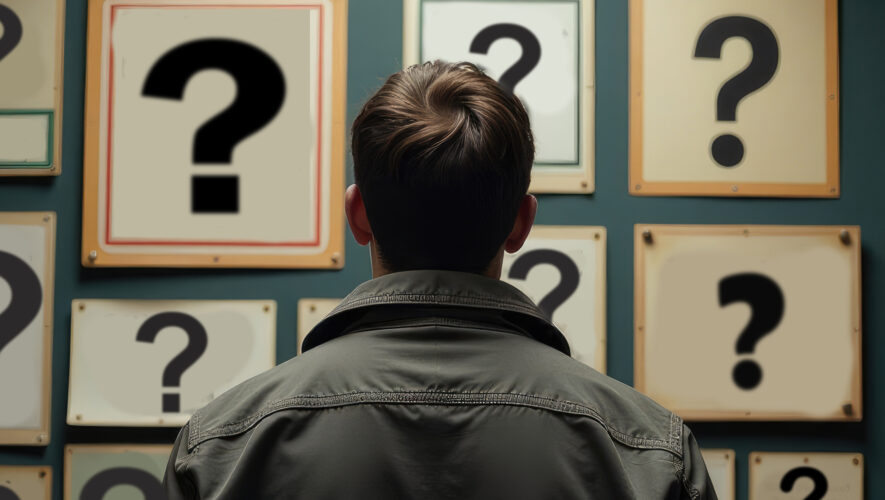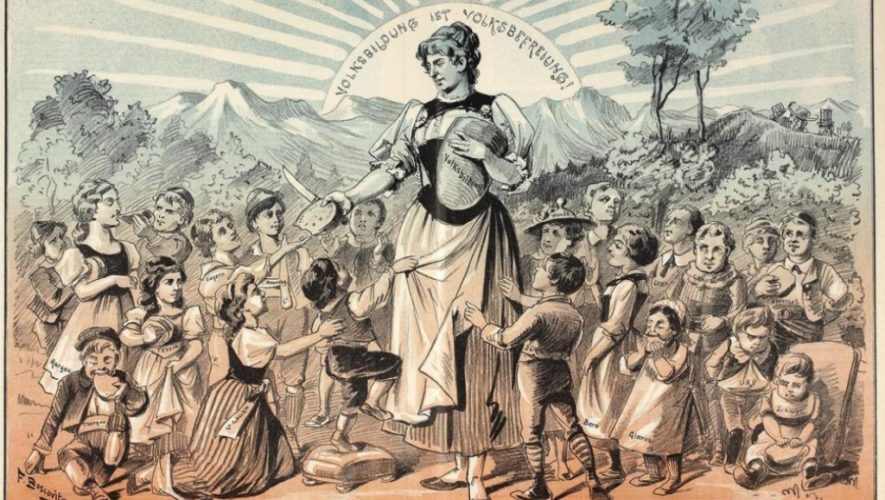Viele Jahre zurück bekam ich als junger Lehrer in meine Klasse (7. Schuljahr) einen Jungen, der removiert worden war. Ich kannte ihn schon, denn in seiner vorherigen Klasse hatte ich Französisch unterrichtet. Nennen wir ihn Lucien Thévenot (Name geändert). Trotz seines welschen Namens war er nicht frankophon, sondern musste Französisch wie seine Klassenkameraden in der Schule lernen. Die andern nannten ihn Lucki, weil sie dem Nasallaut ausweichen wollten.

Seine Eltern führten einen Quartierladen in Kleinbasel und waren viel beschäftigt und schon nahe dem Pensionsalter. Lucien war ein Nachzügler. Er hatte einen vierzehn Jahre älteren Bruder. Die Mutter rief mich vor seinem erzwungenen Übertritt in meine Klasse an und fragte mich ängstlich: «Gibt es bei Ihnen auch das Klassengericht?»
Der Kollege, der bisher Luciens Klassenlehrer gewesen war, pflegte nämlich Jugendliche, die störten oder sich sonst etwas zuschulden kommen liessen, vor dem Klassengericht anklagen zu lassen. Mitschüler(innen) mussten dann über den Fehlbaren oder die Fehlbare «zu Gericht sitzen». Was uns heute ungeheuerlich erscheint, weil es an die Volksgerichte totalitärer Staaten erinnert, war damals ein propagiertes pädagogisch-erzieherisches Verfahren, auf das sich progressiv eingestellte Lehrpersonen einiges einbildeten.
Ich beruhigte die Mutter also: «Nein, gibt es bei mir nicht.» Bald fiel mir auf, dass Lucien sich wie in der vorherigen Klasse phlegmatisch verhielt, oft seine Aufgaben vergass, Material nicht immer mitführte. Er störte jedoch nicht, war ein sehr verträglicher Junge, schien vor sich hin zu träumen, ein stilles Wasser. Irgendwie spürte ich, dass ihn irgendetwas hinderte, seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber was?
Es gelang mir, die Mutter zu einer Anmeldung beim erfahrenen Schulpsychologen, Dr. Franz Schnieper, zu überreden, mit dem ich schon mehrmals zusammengearbeitet hatte. Von seinen Tests und seinem Urteil erhoffte ich mir Vorschläge, was Lucien allenfalls helfen würde, aus seiner Lethargie aufzuwachen und nicht nochmals schulisch zu scheitern.
Nach zwei Sitzungen mit dem Jungen erhielt Dr. Schnieper die Erlaubnis, sich mit mir über die Resultate austauschen zu können. Ich fand den Psychologen ratlos. Er hatte sehr gründlich mit dem Jungen gearbeitet. Er traute ihm das erforderliche Leistungsprofil durchaus zu. Dann zeigte er mir zwei Zeichnungen, die er seine Klienten immer anfertigen liess, über deren Deutung er sich jedoch in Luciens Fall keinen wirklichen Reim machen konnte.
Die eine Zeichnung zeigte Luciens Familie in Tieren. Da war der Vater ein Schaf, die Mutter eine Tigerin, der erwachsene Bruder ein Hund. Lucien stellte sich selbst als kleines Vögelchen dar, das dabei war, aus dem Bild hinauszuschweben. Ein Junge, der sich als kleines Vögelein in der Familie sieht?! Wir rätselten, was das bedeuten könnte. Spielte das etwa auf seine Rolle als Nachzügler an?
«… mir fuhr der Schreck in alle Glieder: Auf Luciens rechter Baumseite herrschte ein Chaos inmitten einer düsteren Gewitterlandschaft. Ein riesiger Blitz zickzackte in den Baum und liess ihn explodieren.»
Noch eigenartiger war die zweite Zeichnung. Lucien sollte einen Baum zeichnen: Auf der linken Seite, wie der Baum heute aussieht, auf der rechten Seite, wie er in fünf Jahren aussehen würde. Das Resultat liess Schnieper und mich erschauern.
Der Psychologe schreibt in seinen unveröffentlichten Memoiren:
«… mir fuhr der Schreck in alle Glieder: Auf Luciens rechter Baumseite herrschte ein Chaos inmitten einer düsteren Gewitterlandschaft. Ein riesiger Blitz zickzackte in den Baum und liess ihn explodieren.»
Das Bild war nicht schnell hingeworfen, sondern sehr sorgfältig ausgeführt. Gegen den Willen der Mutter wies Schnieper den Knaben ins Kinderspital ein und liess eine sorgfältige Untersuchung von Kopf bis Fuss durchführen, ohne Befund.
Lucien wechselte Ende Schuljahr das Schulhaus. Einige Monate später hörten wir, dass er auf dem Nachhauseweg mit dem Mofa in der Rheingasse ganz unvermittelt ohne Fremdeinwirkung auf die Strasse gestürzt und sofort tot war. Sein Herz hatte plötzlich ausgesetzt und für immer aufgehört zu schlagen.
Damit wurde klar, was sich in den Zeichnungen schicksalhaft angekündigt hatte.